|
|
|
Umschlagtext
Nach „Formgeschichte" fragt jeder, der mit biblischen und anderen wichtigen Texten zu tun hat. In den letzten 30 Jahren ist eine „Neue Formgeschichte" entstanden. Dieser Band faßt die bisherige Diskussion um Theorie und Methode und die Neuorientierung zusammen. Er bezieht grundsätzlich alle Texte des Urchristentums ein. Die Frage nach den Rede- und Literaturformen des Neuen Testaments wird so auf eine neue Grundlage gestellt. Die Beschreibung der Formen und Gattungen dient nicht mehr der Scheidung von vermeintlich echtem und unechtem Jesusgut, vielmehr ist „Form" ein wesentlicher Faktor dessen, was wir „Inhalt" nennen. Die Register erlauben es, das Buch auch zur Vorbereitung von Predigt und Unterricht zu gebrauchen.
Rezension
Der Heidelberger Neutestamentler Klaus Berger ist nicht nur ein religiöser Vielschreiber, der zu fast jedem theologischen Thema ein populär zu lesendes Büchlein verfasst hat und landauf landab durch die Republik in Vortragsreisen unterwegs ist, diese Erkenntnisse zu verbreiten, und er ist auch nicht nur dieser religiös-bigotte Sonderling, der als Krypto-Katholik einen evangelischen Lehrstuhl besetzt oder theologisch skuril-absonderliche Thesen verbreitet wie: "Am Anfang war Johannes", demzufolge das Johannesevangelium chronologisch vor die Synoptiker zu stehen kommt ... Klaus Berger denkt auch in der Methodik der neutestamentlichen Formgeschichte (erfreulich) quer und verficht seit Jahrzehnten den Ansatz einer Revision der klassischen Formgeschichte (für die die Namen Dibelius und Bultmann stehen). Und so stellt denn dieses jetzt in der UTB-Reihe erschienene Buch ein update von Bergers 1983 bei Quelle & Meyer in Heidelberg erschienenen "Formgeschichte des Neuen Testaments" dar, erweitert um Kapitel A. und im Detail überarbeitet, z.B. heißen "Sammelgattungen" jetzt "Gemischte Gattungen" (Kap. B), - aber die Grundanlage ist erhalten geblieben. Diese Formgeschichte orientiert sich wesentlich an der griechischen Rhetorik, wie die Kap. C bis E zeigen: Symbuleutische, Epideiktische und Dikanische Gattungen. Durchaus mit Gewinn entsteht so ein neuer Ansatz der Formgeschichte.
Thomas Bernhard, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Formgeschichte ist eine der zentralen exegetischen Methoden. Dieses Buch analysiert das gesamte NT auf seine Formen und Gattungen hin, skizziert ihre Geschichte und unternimmt eine sozialgeschichtliche Einordnung. Auf diese Weise wird die neutestamentliche Form- und Gattungskunde instruktiv in den für sie unverzichtbaren Methodenverband eingebettet und eröffnet sowohl verschiedene Zugänge als auch neue Perspektiven für die exegetische Arbeit. Daraus entsteht eine kompakte Zusammenfassung des Wissensstandes auf diesem Gebiet sowohl für das Studium als auch für die Praxis. Inhaltsverzeichnis
Vorwort V
A. Methodische Einführung 1 I. Was ist Formgeschichte? 1 § 1 Formen und Gattungen 1 § 2 Zur Klärung des Begriffs „Formgeschichte“ 2 § 3 Zur Diskussion über den Begriff „Form“ 7 § 4 Gattungen und Gattungsgeschichte 10 1. Gattungen als Oberbegriffe mit historischer Grundlage 10 2. Gattungsgeschichte auf der Grundlage des Vergleichens von Texten 11 3. Wichtige Merkmale von Gattungen12 4. Zur exegetisch-theologischen Bedeutung der Ermittlung von Gattungen und Gattungsgeschichte 12 5. Andere Ansätze von Gattungen- und Gattungsgeschichte 13 § 5 Der ästhetische Ansatz. Vorläufer und bleibendes Ärgernis 15 1. Der Ansatz Paul Fiebigs 15 2. Hermann Jordan als Vollstrecker des Ansatzes von F. Overbeck 17 3. Methodische Ansätze bei August Boeckh 19 § 6 Die Faszination durch die „reine Form“ in der klassischen Formgeschichte 21 1. J. G. Herder und die romantische Ästhetik 21 2. Die Berufung auf F. Overbeck 24 3. Die „reine Form“ zu Beginn des 20. Jh 25 § 7 Form und Inhalt 27 § 8 Zusammenfassung: Die wichtigsten Grundsätze der herkömmlichen und der neuen Formgeschichte 28 1. Grundsätze der herkömmlichen Formgeschichte 28 2. Grundsätze der neuen Formgeschichte 30 II. Die Einzelprobleme 32 § 9 Formgeschichte und Literarkritik 32 § 10 Mündlichkeit und Schriftlichkeit 35 1. Die Forschungspositionen 35 2. Hypothesen über die Inhalte mündlicher Tradierung 39 3. Zur Einschätzung des Verhältnisses Mündlichkeit/Schriftlichkeit im neutestamentlichen Zeitalter 41 4. Neue Wege zur Ermittlung nicht-schriftlicher Traditionen im frühen Christentum 43 4.1 Gattungen 43 4.2 Gemeinsame Traditionen 45 4.3 Bemerkungen zur Situation der Forschung46 § 11 Anonymität und Kollektivität 47 1. Anonymität und Urliteratur47 2. Kollektivität und Individualität 50 III. Wichtige Grundentscheidungen des Neuansatzes in der Formgeschichte 54 § 12 Zur Entstehung literarischer Gattungen 54 1. Zur bisherigen Diskussion 54 2. Ein Neuansatz 54 3. Die Entstehung literarischer Gattungen in religiöser und theologischer Literatur, nach Entstehungstypen gesondert 55 4. Nachahmende Gattungen 55 5. Die Bedeutung formelhafter Elemente für die Entstehung von Gattungen 61 § 13 Zur Diskussion über den „Sitz im Leben“ 62 1. Zur Kritik an der herkömmlichen Position 62 2. Ein neuer Vorschlag 64 § 14 Rhetorik und Formgeschichte. Zu Theorie und Praxis 66 1. Zur Forschungsgeschichte 66 2. Zu den theologischen Einwänden gegen Rhetorik 67 3. Die Bedeutung der Dimension der „Wirkung“ 68 3.1 Differenz zur traditionellen Formgeschichte 68 3.2 Zur Analyse der „Wirkung“ 69 4. Praktische Ermittlung der Gattung eines Textes 70 4.1 Eine Hierarchie von Kriterien 70 4.2 Zu viele neue kleine Gattungen? 70 5. Sinn und Bedeutung der Rahmengattungen (symbuleutisch, epideiktisch, dikanisch) 71 IV. Formgeschichte im Verhältnis zu anderen exegetischen Arbeitsschritten. Exegese im Methodenverbund 73 § 15 Formgeschichte und die Arbeit des Historikers 73 1. Zur Forschungsgeschichte 73 2. Die notwendige Ergänzung der Formgeschichte durch die Arbeit des Historikers 74 3. Zum Verfahren des Historikers bezüglich der von der Formgeschichte gestellten Aufgaben 75 3.1 Historisch ungeeignete Kriterien aus dem Erbe der älteren Formgeschichte 75 3.2 Vorschläge für sinnvolle historische Fragen im Gegenüber zur Formgeschichte 76 § 16 Formgeschichte und soziologische Fragen 77 1. Zur Forschungsgeschichte 77 2. Zur Kritik der soziologischen Position der älteren Formgeschichte 78 2.1 Kritik des Anti-Individualismus 78 2.2 Kritik an der These, daß die Evangelien Urliteratur seien 79 3. „Neue“ Formgeschichte und Soziologie 80 B. Gemischte Gattungen 81 I. Analogische und bildhafte Texte 81 § 17 Vergleich 83 § 18 Beispiel 84 § 19 Exemplarische Mahnung 87 § 20 Metaphern 87 § 21 Metaphorische Mahnrede 92 § 22 Metaphorische Personalprädikationen 94 § 23 Gleichnisse (allgemein) 95 § 24 Gleichnisse im engeren Sinne 101 § 25 Gleichnis und Sentenz 105 § 26 Gleichniserzählungen 106 § 27 Gleichnis-Diskurse 115 § 28 Allegorie und Allegorese 117 II. Sentenzen 121 § 29 Allgemeine Merkmale von Sentenzen 121 § 30 Funktion der Sentenzen 124 § 31 Zur Form der Sentenzen 124 § 32 Die historische Relevanz der Sentenzen 125 III. Reden 127 § 33 Reden in den Evangelien und in Apg127 § 34 Testamentarische Reden 134 IV. Chrie und Apoftegma 140 § 35 Allgemeines zur Gattung Chrie 142 § 36 Probleme der Einteilung der Chrien 144 § 37 Chrien in der Geschichte des Urchristentums 145 § 38 Zur Form der Chrien 148 § 39 Gruppen von Chrien 150 V. Argumentation 153 § 40 Symbuleutische Argumentation 153 § 41 Epideiktische Argumentation 161 § 42 Apologetische Argumentation 166 § 43 Argumentation und Diatribe 170 VI. Formgeschichtliche Aspekte des Umgangs mit der Schrift (Altes Testament) im Neuen Testament 172 § 44 Schriftgelehrte Gattungen und Techniken 172 § 45 Verwendungsweisen und Sitz im Leben der Schriftzitate im Neuen Testament und im Judentum 173 C. Symbuleutische Gattungen 178 § 46 Die einfache Aufforderung 178 § 47 Allgemeine Merkmale von Paränese 182 § 48 Zum Verhältnis von Torah, Paränese und Recht 182 § 49 Kleinere paränetische Gattungen 185 § 50 Postconversionale Mahnrede 190 § 51 Haustafel und Pflichtenspiegel 196 § 52 Briefliche Schlußparänese 201 § 53 Der paränetische Ketzerschluß in Briefen 203 § 54 Die Warnung vor falschen Lehrern 205 § 55 Martyriumsparänese 205 § 56 Paränese im Jakobusbrief 207 § 57 Tugendkataloge und Lasterkataloge 208 § 58 Abschließende Bemerkungen zur Bedeutung der griechischen Gnomik für die neutestamentliche Paränese 215 § 59 Begründete Mahnrede217 § 60 Mahnungen für besondere Situationen 224 § 61 Mahnungen im Tat-Folge-Schema 226 § 62 Seligpreisungen 247 § 63 Mahnung und Schelte 252 § 64 Unheilsansage als Mahnung 257 § 65 Weheworte260 § 66 Zur Bedeutung der Gattungen prophetischer Mahnrede im Neuen Testament 265 § 67 Paideutikon 268 § 68 Normendiskurs269 § 69 Persönliche Mahnrede 271 § 70 Gemeindeordnung 272 § 71 Der neutestamentliche Brief als symbuleutische Gattung 273 § 72 Protreptische Mahnrede 276 D. Epideiktische Gattungen 280 § 73 Beschreibung des Aussehens und der Gestalt 280 § 74 Abstraktere Beschreibung und Vergleich zweier Gestalten 281 § 75 Listen und Kataloge 282 § 76 Peristasenkatalog 284 § 77 Proklamation 287 § 78 Akklamation, Prädikation und Doxologie 290 § 79 Hymnus und Gebet 297 § 80 Kommentar und Kommentierung 305 § 81 Dialog 308 § 82 Ich-Rede 315 § 83 Epistolaria (persönliche Elemente in Briefen) 335 § 84 Beschreibung des Heilsstands der Gemeinde 337 § 85 Berichte über Visionen und Auditionen 338 § 86 Vaticinien 347 § 87 Apokalyptische Gattungen 353 § 88 Zur Problematik der Gattungsbegriffs „Wundererzählung“ 362 § 89 Die erzählende Gattung Epideixis/Demonstratio 367 § 90 Deesis/Petitio 370 § 91 Die erzählende Gattung Mandatio372 § 92 Erzählungen in visionären und apokalyptjschen Gattungen 375 § 93 Erzähltes Zeremoniell (Liturgie) 377 § 94 Zeichenhandlungen 378 § 95 Beispielerzählungen aus dem Jüngerkreis 379 § 96 Erzählungen über das Handeln eines Kollektivs 380 § 97 Konflikterzählungen 381 § 98 Erzählungen zur Veranschaulichung der Macht und Eigenart einer Größe 382 § 99 Erzähltes Erkennen und Wiedererkennen des Gegenübers 382 § 100 Reiseberichte, Berichte über Wanderungen („Itinerare“) 383 § 101 Berichte über die Tätigkeiten Einzelner und ihr Geschick 384 § 102 Entstehungsbericht (summarisch) eines Buches als Überschrift 385 § 103 Berichte über das Handeln Gottes 385 § 104 Selbstgespräch 387 § 105 Ätiologie 388 § 106 Basis-Bericht (Summar)388 § 107 Märtyrerbericht 391 § 108 Erzählungen über Leiden und Rettung des Gerechten und schematische Kurzfassungen 397 § 109 Enkomion 401 § 110 Evangelium und Biographie 403 § 111 Evangelienform und Altes Testament 421 § 112 Apostelgeschichte und Historiographie 423 E. Dikanische Gattungen 425 § 113 Apologien und apologetische Texte 425 § 114 Die Verbindung von Apologie und Anklage (Schelte) 427 § 115 Begründete Unheilsansagen 428 § 116 Begründete Heilsansagen 429 § 117 Urteile und Beurteilungen 429 § 118 Zeugenberichte und Ernennung zu Zeugen 430 F. Schlußwort: Die Zukunft der Formgeschichte 432 Wichtige Literatur zur Formgeschichte 433 Weitere abgekürzt zitierte Literatur 438 Register 1. Die typischen Situationen und Funktionen für die neutestamentlichen Gattungen (sozialgeschichtlicher Index) 439 2. Neutestamentliche Gattungen und Formen 446 3. Neutestamentliche Schriftstellen 455 Weitere Titel aus der Reihe UTB |
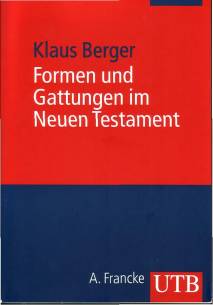
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen