|
|
|
Rezension
Facetten ist ein ansprechend gestaltetes Deutschbuch für die Oberstufe, das die neusten Erkenntnisse der Fachdidaktik sowie die veränderten Rahmenbedingungen und Richtlinien berücksichtigt.
Das Buch gliedert sich in drei Teile. Im ersten Teil werden Arbeitstechniken, wie sie in der Oberstufe verlangt werden, vermittelt. Der zweite Teil bietet anhand einer Fülle von sorgfältig ausgewählten Texten bzw. Textausschnitten die Möglichkeit sich umfassend mit Literarischen Werken auseinanderzusetzen. Der dritte Teil bietet Fakten, Daten und Informationen, die zu einer umfassenden und fundierten Auseinadersetzung mit dem gebotenen Material benötigt werden. Den aktuellen Entwicklungen und Empfehlungen sowie Richtlinien folgend ermöglicht Facetten durch seine Konzeption eine umfassendere Behandlung des Gegenstandfeldes Sprache. Durch das reichhaltige Angebot von Textausschnitten statt der Ganzschriftenlektüre, die auch weiterhin erfolgen soll, aber eben in reduzierter Form, kommt Facetten der Forderung nach Effizienz auch im Fach Deutsch nach. Durch den Zugriff auf die Literaturgeschichte über Epochenumbrüche wird ein zeitökonomisches Erfassen unterschiedlicher Strömungen und Entwicklungen ermöglicht. Gelungen ist die kontrastive und kontroverse Darstellung einzelner Themen durch unterschiedliche Positionen, die in besonderer Weise zur Auseinandersetzung mit dem gebotenen Material anregt und eine miltiperspektivische Betrachtungsweise ermöglicht. Zahlreiche Arbeitsaufträge, besonders im ersten Teil des Buches, leiten zum Erarbeiten des Stoffes und der Lernziele an. Die Auswahl der Texte bzw. Textausschnitte ist gelungen und deckt ein breites Spektrum ab. Die Schüler dürften sich außerdem von zahlreichen Themen wie z.B. der Auseinandersetzung mit dem Film „Der Name der Rose“ von Umberto Eco angesprochen fühlen. Die Textausschnitte sowie die Literaturhinweise regen zum selbständigen Weiterlesen auch außerhalb des Unterrichts an. Darüber hinaus steht den Schülern mit dem Lehrwerk Facetten eine Orientierungshilfe Verfügung, die die Anforderungen im Fach Deutsch in der Gymnasialen Oberstufe rechtzeitig erkennen lässt und somit ein gezieltes Vorgehen ermöglicht. Fazit: Ansprechend gestaltetes Deutschbuch für die Oberstufe, das durch seine Fülle an sorgfältig ausgewähltem Material, aber auch durch seinen strukturellen Aufbau sowohl eine intensive und anregende dabei effiziente Auseinandersetzung mit literarischen Werken ermöglicht, als auch die Beherrschung wichtiger Arbeitstechniken sicherstellt. Björn Hillen, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Autoren: B. Bialkowski, G. Einecke, J. U. Meyer-Bothling, D. Post, E. Thürmann, Chr. Walther, unter Mitarbeit von H. Klösel und R. Lüthen Im ersten Teil enthält "Facetten" didaktisch-methodisch ausgearbeitete Sequenzen, die als Bausteine imRahmen von Kursprogrammen variabel einsetzbar sind und Unterricht strukturieren. Im zweiten Teil bietet "Facetten" in aspektreich arrangierten Textszenarien exemplarische Zugänge zu Literatur, Sprache und Medien. Hier stehen die Texte im Vordergrund und laden zum Lesen ein. Eine Methodisierung erfolgt sparsam über Kontrasttexte, Zusatzinformationen und Handlungsimpulse aufden Randspalten. Der dritte Teil ist ein Nachschlageteil mit eigenständigem Gewicht. Die hier versammelten "Fakten, Daten, Informationen" bieten einen vielfältigen Service, der im Unterricht und vor allem beim selbstständigen Arbeiten mit dem Buchgenutzt werden kann. Facetten setzt besondere Akzente mit: • der methodisch geführten Begleitung der Schreibprozesse von der Planung bis zur Überarbeitung von Texten (Interpretationen, Erörterungen, Facharbeiten); • der Förderung selbstständigen Arbeitens; • der Sequenz zum fachübergreifenden Arbeiten; • dem Schwerpunkt Lesen - Leseförderung; • der Einbeziehung von Weltliteratur; • der Epochen übergreifenden Perspektive durch die Konzentration auf Epochenumbrüche; • der Thematisierung von Mehrsprachigkeit; • dem Blick auf die moderne Medienvielfalt sowie die Verfilmung von Literatur. Inhaltsverzeichnis
UNTERRICHTVORHABEN UND PROJEKTE
LESEN – LESEN – LESEN 1. Umwerfende Leseerlebnisse 11 Dante Alighieri – Italo Calvino – Klaas Huizing, Tor Age Bringsvaerd 2. Lebenslänglich Bücher 15 Günter Grass* – Peter Weiss – Helmut Krausser – Felicitas Hoppe 3. Bücher sind Gefährlich 19 Stefan Heym – Umberto Eco – Klaas Huizing 4. Meine Bücher – meine Lebenserfahrung 24 TEXTE PLANEN, SCHREIBEN, ÜBERARBEITEN 1. Schreibsituationen und Schreibaufgaben analysieren 27 2. Eigene Kenntnisse aktivieren, recherchieren, Informationen aufbereiten 30 3. Gestaltungsideen sammeln und strukturieren 33 4. Beispiele erkunden und dabei Ideen und Strategien für eigene Texte entwickeln 37 5. Texte und Materialien erarbeiten und deuten 40 GESPRÄCHE FÜHREN, VORTRAGEN, PRÄSENTIEREN 1. Gespräche führen 45 1.1 Kaufen – Verkaufen: Verzerrte Kommunikation 45 1.2 Das müssen Sie erklären … - Schulische Kommunikation 50 1.3 Gesprächslabor 52 2. Vortragen 56 2.1 Statements abgeben 56 2.2 Kurzvorträge halten 56 2.3 Mündliches Referat nach schriftlicher Ausarbeitung 60 3. Präsentieren und visualisieren 62 3.1 Auf Körpersprache achten 62 3.2 Ergebnis-Folien zu Arbeitsergebnissen im Unterricht oder zum Referat 63 3.3 Hand-out (Paper, Thesenpapier) zu einem Referat 64 3.4 Wandzeitung zu einer Gruppenarbeit oder einem Projekt 65 ICH/NATUR – UMGANG MIT GEDICHTEN 1. Erfahrungen mit Gedichten 67 Hans Magnus Enzenberger* - Joseph Brodsky – Friedrich Schiller – Peter Wapnewski – Rose Ausländer – Texte von Schülerinnen und Schüler 2. Gedichte verstehen und beschreiben 70 2.1 Der Sprecher im Gedicht 70 Johann Wolfgang Goethe – Christine Lavant – Sarah Kirsch* - Rainer Maria Rilke – Jürgen Becker 2.2 Die Formen des Gedichts 72 Andreas Gryphius – Georg Trakl – Rainer Maria Rilke 2.3 Sprache im Gedicht 74 Joseph von Eichendorff – Johannes Bobrowski 2.4 Bildlichkeit im Gedicht 75 Heinrich heine – Johann Wolfgang von Goethe – Conrad Ferdinand Meyer – Friedrich Hölderlin – Peter Huchel – Günter Eich – Michael Krüger 3. Ein Gedicht interpretieren 79 Ingeborg Bachmann – Schülertext – Peter Huchel – Sarah Kirsch* - Eduard Mörike – Rose Ausländer 4. Gedicht-Werkstatt 86 Johann Wolfgang von Goethe – Karl Krolow – Reinhard Lettau – Günther Eich – Friederike Mayröcker – Tristan Tzara – Schülertext UNHEIMLICHES – UMGANG MIT ERZÄHLENDEN TEXTEN 1. Die fiktionale Welt des Erzählens 89 Umberto Eco 2. Erzählende Texte untersuchen und verstehen 92 2.1 Erzählbeginn und Erzählperspektive 92 Franz Kafka – Edgar Allan Poe – Gabriel Garcia Marquez 2.2 Person und Handlung 95 E.T.A. Hoffmann 2.3 Zeit und Ort 98 Heinrich von Kleist 3. Einen Erzähltext interpretieren und darüber schreiben 100 3.1 Individuelle Lesearten 100 H.C. Artmann – Jean Paul Sartre 3.2 Vorarbeiten am Text 102 3.3 Entwürfe von Teilen einer schriftlichen Interpretation 104 4. Erzählwerkstatt 106 REDEN UND SCHWEIGEN – UMGANG MIT SZENISCHEN TEXTEN 1. Was ist ein Drama? 109 William Shakespeare 2. Dramatische Texte untersuchen und verstehen 11 2.1 Der dramatische Auftakt: Problemstellung und Handlungsansätze 111 Gotthold Ephraim Lessing 2.2 Figurenkonzeption und Konfliktentwicklung 113 Gotthold Ephraim Lessing 2.3 Figurenkonstellation und Dialogstruktur 116 Friedrich Schiller 3. Auflösung der Form 122 Georg Büchner – Friedrich Schiller 4. Eine Szene interpretieren 126 4.1 Den Inhalt einer Dramenszene wiedergeben 126 4.2 Die Dialogstruktur einer Szene analysieren und beschreiben 126 4.3 Die Funktion einer Szene analysieren und erläutern 127 4.4 Eine Interpretation gliedern 127 5. Theaterwerkstatt 128 Wolf Wondratschek – Günther Guben – Botho Strauss – Giorgio Manganelli – Ernst Jandl – Wolf Biermann – Peter Handke – Ulla Hahn – Harald Hurst – Anton Čechov – Reinhard Lettau – Georg Tabori – Flann O’Brien THEMA „ZEIT“ – UMGANG NIT SACHTEXTEN 1. Vorwissen und Ideen zu einem Thema entfalten – Ideenbörse zum Thema „Zeit“ 133 2. Informationen zu einem Thema recherchieren 134 2.1 Nachschlagen – in Lexika, Wörterbüchern und CD-Rom-Enzyklopädien recherchieren 134 2.2 Bibliograhieren – in Katalogen und Datenbanken suchen 135 2.3 Hyperlesen – im Internet surfen oder navigieren 136 3. Effektive Lesetechniken einsetzen – Sachtexte gezielt lesen 137 Norbert Elias – Julius T. Fraser 4. Inhalte eines Sachtextes verfügbar machen 140 4.1 Einen Text markieren 140 Ernst Pöppel 4.2 Zu einem Text einen Konspekt anlegen 141 Peter Conveney/Roger Highfield 4.3 Paraphrasieren und resümieren 142 Norbert Elias 5. Statistische Informationen verarbeiten – Daten verbalisieren 144 6. Die Verwertbarkeit von Sachtexten einschätzen 146 6.1 Darstellende und erklärende Textteile unterscheiden 146 Norbert Elias 6.2 Argumentierende und appellierende Textteile unterscheiden 147 Norbert Blüm 6.3 Darstellende und deutende Textteile unterscheiden 148 Martin Burckhard – Peter Gendolla STRITTIGE THEMEN – ERÖRTERN 1. Das Strittige erkennen 153 Henryk M. Boder 2. Eine Argumentation analysieren 156 2.1 Position klären 156 Marcel Reich-Ranicki – Elfriede Jelinek – Hartmut von Henting 2.2 Die Argumentationsstruktur untersuchen158 Ulrich Greiner 2.3 Einen argumentativen Text beurteilen 161 3. Eine textbezogene Erörterung schreiben 162 Ruth Klüger 4. Eine textbezogene Erörterung überarbeiten 166 5. Einen Essay schreiben 168 Günter Kunert WAS DARF SATIRE? – EINE FACHARBEIT SCHREIBEN 1. Worum es bei der Facharbeit geht 171 2. Themenfindung und –eingrenzung 172 3. Suchstrategien zur Informationsbeschaffung 175 4. Texte und Materialien auswerten 178 5. Gliederung 181 6. Die Facharbeit zu Papier bringen 182 6.1 Einleitung und Schluss formulieren 182 6.2 Den Hauptteil formulieren 183 6.3 Formale Anlage der Arbeit 185 7. Planen und Organisieren 186 8. Die Präsentation der Facharbeit 187 DER FALL GALILEO GALILEI – FACHÜBERGREIFENDES ARBEITEN 1. Galileio Galilei: Zeit, Leben und Werk im Überblick 189 2. O früher Morgen des Beginnens … 193 Bertold Brecht* 3. Disput der Wissenschaftler 197 Bertold Brecht* - Christoph Helferich 4. Inquisition 200 Bertold Brecht* - Isabelle Stengers – Mario Biagioli – Papst Johannes Paul II. 5. Galileis Verbrechen 204 Bertold Brecht* - Lewis Mumford TEXTE UND THEMEN KONTINENTE – AUSFLÜGE IN DIE WELTLITERATUR 1. Isabell Allende 208 Das Geisterhaus 2. Tahar Ben Jelloun 211 Die Nacht der Unschuld 3. Don DeLillo 213 Unterwelt 4. Marguerite Duras 216 Der Liebhaber 5. Nuruddin Farah 217 Geheimnisse 6. Gabriel Garcia Márquez 219 Chronik eines angekündigten Todes 7. Imre Kertész 220 Roman eines Schicksallosen 8. António Lobo Antunes 224 Der Tod des Carlos Gardel 9. Margriet de Moor 226 Bevorzugte Landschaft 10. Toni Morrison 228 Sehr blaue Augen 11. Haruki Murakami 230 Mister Aufziehvogel 12. Thomas Pynchon 233 V. 13. Salman Rushdie 235 Mitternachtskinder EUROPÄISCHE LIEBESSZENEN – VON DER ANTIKE BIS ZUR MODERNE 1. Aristophanes 238 Lysistrata 2. Das Tagelied – eine Spielart des mittelalterlichen Minnesangs 242 Dietmar von Aist – Oswald von Wolkenstein 3. William Shakespeare 245 Romeo und Julia 4. Andreas Gryphius 247 Absurda Comica oder Herr Peter Squentz 5. Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux 250 Das Spiel von Liebe und Zufall 6. Johamm Wolfgang von Goethe 252 Faust. Der Tragödie erster Teil 7. Heinrich von Kleist 254 Amphitryon 8. Georg Büchner 256 Leonce und Lena 9. Anton Čechov 258 Der Heiratsantrag 10. Bertold Brecht* 260 Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny 11. Jean Tardieu 262 Die Liebenden in der U-Bahn 12. Ana Diosdado 264 Die Achtzigerjahre gehören zu uns 13. Heiner Müller 266 Herzstück WEGE IN DIE AUTONOMIE – EPOCHENUMBRUCH 18./19. JAHRHUNDERT 1. Natur erfahren 268 Barthold Heinrich Brocks – Georg Christoph Lichtenberg – Johann Wolfgang von Goethe – Joseph von Eichendorff – Karoline von Günderode – Anette von Droste-Hülshoff – Heinrich Heine 2. Fesseln spüren – Fesseln sprengen 277 Immanuel Kant – Jean-Jacque Rousseau – Gotthold Ephraim Lessing – Johann Wolfgang von Goethe – Friedrich Schiller – Jakob Michael Reinhold Lenz 3. Wege in die Freiheit 285 3.1 Revolution 285 Johann Kaspar Lavater – Friedrich Hölderlin – Adolph Freiherr von Knigge – Johann Heinrich Voß/Friedrich Schulz – Matthias Claudius – Johann Wolfgang von Goethe – Friedrich Schiller – Georg Büchner – Heinrich Heine 3.2 Bildung 294 Friedrich Schiller - Johann Wolfgang von Goethe – Johann Gottfried Herder - Karoline von Günderode – Friedrich Schlegel - Novalis 4. Nachseiten 300 August Klingemann – Ernst Theodor Amadeus Hoffmann – Jean Paul DAS JANUSGESICHT DER MODERNE – EPOCHENUMBRUCH 19./20. JAHRHUNDERT 1. Großstadterfahrungen 306 1.1 Umbrüche 306 Julius Hart – Ernst Stadler 1.2 Erzählte Stadterfahrungen 308 Wilhelm Raabe – Alfred Döblin – Irmgard Keun 1.3 Stadterfahrungen im Gedicht 312 Georg Heym – Oskar Loerke – Alfred Wolfenstein- Erich Kästner 1.4 Nachdenken über die Großstadt 314 Ödön von Hórvath* - Siegfried Kracauer 2. Erfahrungen in der Industriegesellschaft 316 2.1 Der Weberaufstand als Modell 316 Gerhart Hauptmann – Heinrich Heine – Rezensionen zu „Die Weber“ 2.2 Im „Sumpf“ der Schlachthöfe Chicagos 320 Upton Sinclair – Bertolt Brecht* 2.3 Gedanken zur Lage der Gesellschaft 326 Georg Büchner – Guntram Vesper – Karl Marx/Friedrich Engels 3. Erfahrungen von Sinn- und Sprachlosigkeit 3.1 Sinnkrise des Individuums 330 Else Lasker-Schüler – Gottfried Benn* - Bertold Brecht* - Franz Kafka – Frank Wedekind 3.2 Krisenbewusstsein 334 Friedrich Nietzsche – Siegmund Freud – Hugo von Hofmannsthal – Joseph von Eichendorff – Gottfried Benn* - Christian Morgenstern – Richard Huelsenbeck – Kurt Schwitters – Joachim Ringelnatz – Robert Musil SPIEGELUNGEN – DEUTSCHE LITERATUR SEIT 1945 1. Im Schatten von Krieg und Holocaust 342 1.1 Die Stimmen der Überlebenden 342 Anna Seghers – Paul Celan – Nelly Sachs – Gunter Eich – Wolfgang Borchert – Walter von Molo – Thomas Mann 1.2 Nachforschungen 349 Helmut Heisenbuttel – Peter Weiss – Alexander Kluge – Bernhard Schlink 2. Ankunft im Alltag 355 Eduard Claudius – Brigitte Reimann – Wolfgang Koeppen – Martin Walser – Ingeborg Bachmann – Gunter Grass* – Hans Magnus Enzensberger* – Peter Huchel – Wolf Biermann – Volker Braun* – Thomas Bernhard* 3. Wunderbare Jahre 366 Heinrich Boll – Reiner Kunze* – Elfriede Jelinek – Gabriele Wohmann* 4. Im Rückblick 372 Zoe Jenny – Herta Muller – Judith Hermann CHRISTA WOLF* – EINE SCHRIFTSTELLERIN IN IHRER ZEIT 1. Die Auseinandersetzung mit der DDR-Wirklichkeit 378 Der geteilte Himmel 378 Nachdenken über Christa T 381 Dokumente zur Zensurgeschichte 384 2. Kindheitsbewältigung und Selbstbefragung 386 Kindheitsmuster 386 3. Gegen-Welten 389 Kein Ort. Nirgends 389 Medea. Stimmen 391 4. Die Christa-Wolf-Debatte 396 Kontroverse Standpunkte 396 Ulrich Greiner – Volker Hage Die Akte Margarete 398 REFLEXIONEN ÜBER LITERATUR 1. Verstehensweisen von Literatur 402 Carsten Schlingmann – Veit-Jakobus Dieterich – Umberto Eco – Thomas Graff 2. Probleme der Literaturgeschichtsschreibung 406 Rainer Rosenberg – Karl Otto Conrady 3. Probleme der Gattung 408 3.1 Allgemeines 408 Klaus Muller-Dyes – Johann Wolfgang von Goethe 3.2 Lyrik 410 Peter Wapnewski – Bertolt Brecht* – Hans Magnus Enzensberger* – Gunter Eich 3.3 Epik (Roman) 414 Marcel Reich-Ranicki – Theodor Fontane – Uwe Johnson – Max Frisch* – Klaus Modick 3.4 Drama 420 Aristoteles – Gotthold Ephraim Lessing – Friedrich Schiller – Bertolt Brecht* – Friedrich Durrenmatt* – Augusto Boal 4. Zur Rolle des Schriftstellers in der Gesellschaft 426 Gottfried Benn* – Bertolt Brecht* – Peter Handke* – Bodo Kirchhoff SPRACHE UND BEEINFLUSSUNG 1. Kolonisierung mit Worten – sprachliche Macht und Ohnmacht 432 Dieter Kuhn – Jorge Zalamea 2. Propaganda im Nationalsozialismus – argumentative Rhetorik in der Gegenwart 436 2.1 Kämpfen und gleichschalten – Helden- und Feindbilder aufrichten 436 Adolf Hitler – Joseph Goebbels 2.2 Durchschauen – Redeanalyse 442 Victor Klemperer – Hans Dieter Zimmermann 2.3 Gedenken und erinnern – Konflikte in Sprache fassen 447 Martin Walser – Ignatz Bubis 3. „Begriffe besetzen“? – semantische Analyse 453 Roman Herzog – Hans-Olaf Henkel – Ulrich Nitschke – Josef Klein 4. Sich mit Worten wehren – Rhetorik von Opfern-Tätern-Opfern 459 Robert Schneider SPRACHE UND IHRE FUNKTIONEN 1. Sprache: Was den Menschen zum Menschen macht 462 Dieter E. Zimmer – Steven Pinker 2. Was Sprache ist und was sie kann 465 Dieter E. Zimmer – Karl Buhler – Wolf Schneider 3. Wie man mit Sprache denkt 469 Helmut Gipper – Lew S. Wygotski – Heinrich von Kleist – Wilhelm von Humboldt 4. Wie man mit Sprache handelt 473 Paul Watzlawick/Janet H. Beavin/Don D. Jackson – Dieter D. Wunderlich – Werner Kallmeyer/Wolfgang Klein – Johannes Bobrowski – Gotthold Ephraim Lessing 5. Wie man mit Sprache spielt 476 David Crystal – Friedhelm Kandler – Henry Jelinek – Fred Ensikat VIELFALT DER SPRACHE(N) 1. Anfänge 480 David Crystal – Valentin Braitenberg – Bibeltexte 2. Viele Sprachen, eine Welt 484 Thomas Finkenstaedt/Konrad Schroder – Claude Hagege – Peter Nonnenmacher – Hans Muller – Friedrich Schleiermacher – Jean Paul 3. Sprachenbiografien, Schicksale 490 Alber Schweitzer – Heinrich Schliemann – Elias Canetti – Hannah Arendt 4. Wanderungen und ihre sprachlichen Folgen 494 Hans Magnus Enzensberger* – Sjaak Kroon/Ton Vallen – Mojca Posavec – Ertunc Barin 5. Sprachbeziehungen 498 Kim Lan Thai – Chantal Estran-Goecke – Abdolreza Madjderey – Elisabeth Goncales MEDIEN: ERFAHRUNGEN UND REFLEXIONEN 1. Mediengeschichten – audiovisuelle Erinnerungen 500 Friedrich Christian Delius – Georg Heinzen – Charles Lewinsky – Umberto Eco 2. Fallstudie: Talkshows 505 Sabine Bode – Gary Bente/Bettina Fromm 3. Medien nutzen – Medien reflektieren 510 Hans Magnus Enzensberger* – Marie-Anne Berr – Bernd Scheffer – Heinz Mandel/Gabi Reinmann- Rothmeier – JosephWeizenbaum – Dieter E. Zimmer „DER NAME DER ROSE“ – LITERATURVERFILMUNG Ein Blick ins Mittelalter 521 Umberto Eco –Knut Hickethier – Rainer Werner Fassbinder* – Jean-Jacques Annaud – Hans D. Baumann/Arman Sahiki FAKTEN, DATEN, INFORMATIONEN Glossar zur Arbeit mit literarischen Texten 536 Rhetorische Figuren 550 Epochen und Epochenumbrüche 552 Literarische Landkarte 554 Übersichten zur fachlichen Orientierung Umgang mit Gedichten 556 Umgang mit erzählenden Texten 558 Umgang mit szenischen Texten 560 Umgang mit Sachtexten 562 Elemente der Filmanalyse 564 Vorschläge für Facharbeiten und Projekte 566 Tipps zum Nachschlagen und Recherchieren 568 Textsortenverzeichnis 570 Autoren- und Quellenverzeichnis 573 Bildnachweis 584 Weitere Titel aus der Reihe Facetten |
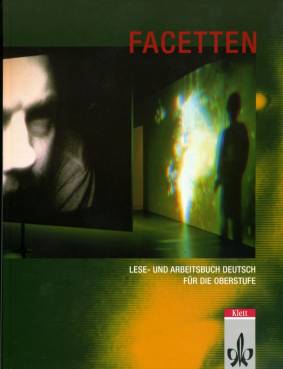
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen