|
|
|
Umschlagtext
»Schnurre ist ohne Zweifel einer der besten Kurzgeschichten-Schreiber; seine Geschichten sind von europäischem Rang, ebenbürtig auch den berühmten amerikanischen short-storys eines Faulkner oder Hemingway. Ich las seine Geschichten mit Bewunderung.«
Hermann Kesten »Man staunt über die Exaktheit, mit der hier eine Welt demonstriert wird, die man immer zu kennen glaubte und von der man doch jetzt erst weiß: so ist die Wirklichkeit« Walter Jens »Lesen Sie diesen Dichter. Sie haben es mit einem starken Charakter und großen Künstler zu tun.« Hessischer Rundfunk Rezension
Wolfdietrich Schnurre (*1920 in Frankfurt am Main; † 1989 in Kiel) arbeitete seit 1950 als freier Schriftsteller, war 1947 Mitbegründer der Gruppe 47 und Mitglied des P.E.N.-Zentrums der Bundesrepublik Deutschland, aus dem er 1962 aus Protest gegen dessen Schweigen zum Bau der Berliner Mauer austrat. Neben satirisch-zeitkritischer Lyrik veröffentlichte Schnurre insbesondere auch Erzählungen und zahlreiche Kurzgeschichten, die ihn zu einem bedeutenden Erzähler und Lyriker der westdeutschen Nachkriegsliteratur werden ließen, wovon dieser Band eindrucksvoll Zeugnis gibt. 1983 erhielt Schnurre den Georg-Büchner-Preis.
Jens Walter, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Über das Buch Kieler Nachrichten, 12.11.2008 Wolfdietrich Schnurres Werk bleibt aktuell Der 1920 geborene und 1989 verstorbene Wolfdietrich Schnurre war einer der wichtigsten Autoren der deutschen Nachkriegsliteratur. Der Mitbegründer der legendären Gruppe 47 machte in Erzählsammlungen wie Die Rohrdommel ruft jeden Tag als einer der ersten und erfolgreichsten die amerikanische Form der Short Story in Deutschland bekannt und populär. (...) An den Storyteller und Parabeldichter erinnert eine Anthologie, die jetzt im Literaturhaus Schleswig-Holstein vorgestellt wurde: Dreimal zur Welt gekommen. Marina Schnurre, Witwe des Schriftstellers, und Fritz Bremer, Herausgeber der Zeitschrift Brückenschlag, wählten die Erzählungen aus, Schnurres neun Jahre jüngerer Kollege Günter Kunert steuerte ein Vorwort bei. Kunert und die Herausgeber erinnerten im Literaturhaus Schleswig-Holstein an die Aktualität Schnurres. (...) Wolfdietrich Schnurre: Der Mann hat gefälligst wiederentdeckt zu werden. Marcus Jensen in: „Am Erker“ Nr. 54, 30. Jg. 2007 Dem kann man sich nur anschließen. Fazit: Lesen! Michael Schnieder-Braune in: Der Kultur-Herold, Nr. 57, 26. Jg. 2009 Wie viele aus seiner Schriftstellergeneration misstraute auch Wolfdietrich Schnurre der pathetischen Sprache, die durch die Nazipropaganda misskreditiert war. Seine Sprache ist nüchtern und sparsam im Umgang mit Adjektiven. „Man staunt über die Exaktheit, mit der hier eine Welt demonstriert wird, die man immer zu kennen glaubte und von der man doch jetzt erst weiß: so also ist die Wirklichkeit.“ Walter Jens „Ich las seine Geschichten mit Bewunderung“, schreibt Hermann Kesten. „Schnurre ist ohne Zweifel einer der besten Kurzgeschichten-Schreiber; seine Geschichten sind von europäischem Rang, ebenbürtig auch den berühmten amerikanischen short-storys eines Faulkner oder Hemingway.“ „Lesen Sie diesen Dichter. Sie haben es mit einem starken Charakter und großen Künstler zu tun.“ Hessischer Rundfunk Rezensionen Thomas Kirschstein in: BrückenBote: Schnurre schreibt packend, direkt und unverstellt über seine Erlebnisse im 2. Weltkrieg und unmittelbar danach. Beinahe schockierend und doch von einer Unbekümmertheit lotet Schnurre alle (un)menschlichen Möglichkeiten aus. Gerade dieses macht die Spannung aus, die beim Lesen nie abreißt. Es ist das Erlebnis von geradezu schreiender Ungerechtigkeit in der Entwicklung einiger seiner Geschichten. (...) Schnurre schreibt oft in direkter Rede, also Dialogform. Seine Sprache ist bildhaft und oft lässt er Naturbeschreibungen in seine Gerschichten einfließen. (...) Welche Perspektive man auch beim Lesen einnehmen mag, unverwechselbar bleibt Schnurre der kritische Beobachter der Realität. (...) Der Grund, warum der Paranus Verlag ein Buch mit Erzählungen von Schnurre herausgibt, mag sein, dass sich Schnurre für die Arbeit der "Brücke" in Neumünster interessierte und selber in der Zeitschrift "Brückenschlag" schrieb. Kieler Nachrichten, 12.11.2008 Wolfdietrich Schnurres Werk bleibt aktuell Der 1920 geborene und 1989 verstorbene Wolfdietrich Schnurre war einer der wichtigsten Autoren der deutschen Nachkriegsliteratur. Der Mitbegründer der legendären Gruppe 47 machte in Erzählsammlungen wie Die Rohrdommel ruft jeden Tag als einer der ersten und erfolgreichsten die amerikanische Form der Short Story in Deutschland bekannt und populär. (...) An den Storyteller und Parabeldichter erinnert eine Anthologie, die jetzt im Literaturhaus Schleswig-Holstein vorgestellt wurde: Dreimal zur Welt gekommen. Marina Schnurre, Witwe des Schriftstellers, und Fritz Bremer, Herausgeber der Zeitschrift Brückenschlag, wählten die Erzählungen aus, Schnurres neun Jahre jüngerer Kollege Günter Kunert steuerte ein Vorwort bei. Kunert und die Herausgeber erinnerten im Literaturhaus Schleswig-Holstein an die Aktualität Schnurres. (...) Marcus Jensen in: Am Erker, Zeitschrift für Literatur, Nr. 56, 2008: Neben "Das Begräbnis" – eine Jahrhundertgeschichte – verblüffen vor allem "Der Ausmarsch" über eine Truppe Kleinkindersoldaten, die noch schnell bewaffnet in den Krieg geschickt werden und den Hauptmann "Onkel" nennen, außerdem "Die Reise zur Babuschka" über das fast gleichzeitige und halluzinierende Sterben eines deutschen und russischen Soldaten auf einem schaukelnden Karren: Die drei sind zeitlos genau, fettfrei, schnell und von einer Erbarmungslosigkeit wie bei Samuel Beckett. Stuttgarter Zeitung: Die Geschichten, die in den Nachkriegsjahren entstanden, vor allem „Der Ausmarsch“, „Man sollte dagegen sein“, „Die Reise zur Babuschka“, zählen zu den besten Zeugnissen der antimilitaristischen deutschen Literatur ... Der ausgedrückte Respekt vor der Kraft der Schwachen, der Entdeckung der Bedeutung der sogenannten Unbedeutenden, die Achtung ihrer Eigenarten und Sehnsüchte, stellen in der Literatur unseres Landes her, was selten ist, Lebensfreude. „Geschichten erzählen“, schreibt Schnurre, „ist ein menschenfreundlicher Akt.“ Horst Hartmann im Main-Echo: Wolfdietrich Schnurre ist ein Poet der schöpferischen Widersprüche zwischen Idylle auf Widerruf und Sarkasmus, ein nüchterner Realist, verschmitzter Fabulierer, Verteidiger der Menschenwürde. ... Auf die Frage, warum er schreibe, hat Wolfdietrich Schnurre eine wahrhaft poetische Antwort gegeben: „Aus Angst vor der Vergänglichkeit. Um meine Schuldgefühle wachzuhalten. Um nicht tatenlos mit ansehen zu müssen, wie der Einzelne immer mehr in der Masse verkommt. Aus Trauer. Aus Zorn. Aus Verzweiflung.“ Hajo Steinert im Kölner Stadt-Anzeiger: Engagiert schreiben, das hieß für Schnurre, „betroffen machen von allem, was gegen die Menschenwürde verstößt“, und gezwungen sein, „den Menschen in Bedrängnis“ zu zeigen. Wolfdietrich Schnurre im Gespräch, in: Brückenschlag 6/1990: Ich schreibe nicht für die literarische Elite, und ich habe eine wesentlich andere Auffassung von Literatur als meine Kritiker. Es ist eine lebendige Sache und macht Spaß. Literatur hat nie aufgehört, mir richtigen Spaß, Freude, zu bereiten. Mathias Adelhoefer über Schnurre in: Brückenschlag 7/1991: Schnurre kämpfte sein Leben lang gegen das Vergessen und Verdrängen – im „Schattenfotografen“ heißt es dazu zur Rolle des Lesers: „Er ist meine Hoffnung. Ohne ihn bin ich verloren. Nur er kann mich aus meinem Ich-Gehäuse erlösen: Gelesen bin ich gerettet.“ Geschichte der deutschen Dichtung: Schnurres Erzählungen mischen Wirkliches mit heiter-bösartigen Surrealismen, prangern Einrichtungen und Verhaltensweisen an, ohne dabei ihren spielerischen Charakter zu verlieren. ... Mit Phantasie und Sarkasmus wird eine kleine Welt des Absonderlichen und Ausgefallenen gegen die "große" Geschichte ausgespielt. Inhaltsverzeichnis
Über Schnurre, Geleitwort von Günter Kunert 7
Dreimal zur Welt gekommen 12 Ein Leben 18 Die Nacht 18 Der Kittel 19 Das Wanderkleid 21 Der Ausmarsch 24 Die Reise zur Babuschka 30 Auf der Flucht 47 Das Haus am See 52 Das Versäumnis 95 Freundschaft mit Adam 104 Das Begräbnis 121 Steppenkopp 129 Das Manöver 153 Reusenheben 162 Eine Rechnung, die nicht aufgeht 168 Das Staatswesen 177 Eine Hinrichtung 178 Der neue Heilige 182 Das Los unserer Stadt 183 Eine verlässliche Reparatur 184 Der gerade Weg 186 Editorische Notiz von Marina Schnurre und Fritz Bremer 190 Wolfdietrich Schnurre: Leben und Werk 192 Leseprobe: Dreimal zur Welt gekommen Statt einer Biografie Ich bin 1920 in Frankfurt am Main geboren worden. Mein Erinnerungsvermögen setzt mit drei Jahren ein. Es hat aus dieser Zeit einen Teich festgehalten, in dem gelbe Trauerweidenblätter schwammen. Am Rand stand, unter einem schwarzen Tuch verborgen, ein Fotoapparat. Er hatte manchmal drei, manchmal fünf dürre Beine. Hatte er fünf, war der Fotograf mit unter dem Tuch. Ich schlief in einem Gitterbett, das aufregend nach rostigem Eisen und öligem Werg roch. Neben mir saß ein Teddybär. Er hatte eine Schelle um den Hals, und waren Männer mit Elchgeweihen und Katzen mit brennenden Augen in meinen Träumen gewesen, schüttelte ich den Bären; dann kam mein Vater auf das Klingeln herein und beruhigte mich wieder. Er war sehr viel jünger als ich heute bin, hatte gerade seinen naturwissenschaftlichen Doktor gemacht und fuhr jeden Morgen, eine längs gefaltete Aktentasche, in der die Kaffeeflasche gluckerte, auf dem Gepäcksitz des Fahrrads, in eine Fabrik, die Glühbirnen machte. (...) Ich war häufig krank damals und sehr oft in Heimen. In Hirschhorn am Neckar umsorgten mich Nonnen. Sie hängten mir ein Laken über den Kopf, in das ich hineingemacht hatte und ließen mich von den anderen Kindern verhöhnen. Im Allgäu später war es dann schöner. Dort lebte ein geistesschwacher Mann mit im Heim, der fallsüchtig war und wunderbar Ziehharmonika spielte. Wir weinten immer, wenn er seine Krämpfe bekam. Als mich dort mein Vater besuchte, wurde ihm zu Ehren die Kapellenglocke geläutet. Er war Bibliothekar geworden inzwischen, aber es gefiel ihm nicht mehr in Frankfurt; mit einer neuen Freundin zusammen, die Malerin war, zogen wir um nach Berlin. In Berlin kam ich 1928 ein zweites Mal auf die Welt. Wir wohnten ganz im Nordosten, in Weißensee, einem Arbeiterviertel. Es gab viele Mauersegler am Himmel und fast ständig politische Unruhen auf den Straßen. Im Haus arbeitete ein jüdischer Glaser. Wenn er einen Spiegel reparierte, setzte er sich immer erst eine dunkle Brille auf, wegen der fremden Blicke, die den Spiegel unrein gemacht hatten. Es war ein Eckhaus mit einer Kneipe darin. Alle paar Tage kehrten vom nahegelegenen Friedhof die Trauergemeinden zum Totengedenkessen dort ein. Es gab immer dasselbe: Eisbein mit Sauerkraut, und dazwischen tauchten die Frauen ihre verweinten Gesichter in die großen besänftigend kühlen Weiße-Gläser hinein. (...) Ein Jahr später zog man mich ein. Ich musste in Ostpreußen Flugplätze planieren. Während des deutschen Angriffskrieges auf Polen hatten wir die Schlachtfelder von den Toten zu säubern. Auf dem Kasernenhof in Potsdam lernten wir dann, mit aufgepflanztem Bajonett in einen Sandsack zu stechen. Auf dem Sack prankte ein waagrechter Kreidestrich, der die Gürtellinie markierte. Einige numerierte Kreise unterhalb der Gürtellinie bezeichneten die für den Einstich anatomisch wirksamsten Stellen. Ich bin sechseinhalb Jahre Soldat gewesen. Die ganze Zeit hindurch hat auf unseren Koppelschlössern die Lästerung „Gott mit uns“ gestanden. Zuletzt war ich in der Strafkompanie. Man warf mir vor, ich hätte die Manneszucht untergraben. Mit der Zivilbevölkerung zusammen haben wir Minen geräumt. Während die sowjetischen Panzer uns jagten, gelang es mir, verloren zu gehen; ich zog Zivilkleidung an und bin weiter nach Westen gelaufen. Während dieser letzten Kriegstage kam ich zum dritten Mal auf die Welt. Es war eine Zangengeburt: die Freiheit zerrte, und der Krieg gab einen nicht frei. (...) |
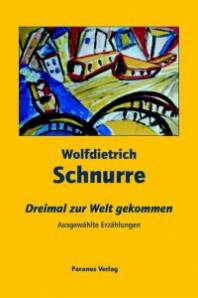
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen