|
|
|
Umschlagtext
Der polnische Erzieher, Literat und Kinderarzt Janusz Korczak hat ein umfangreiches reformpädagogisches und gesellschaftskritisches Werk hinterlassen. Die fachwissenschaftliche Analyse und Aktualisierung der Pädagogik Korczaks wird jedoch bis heute - auch international - vernachlässigt. Diesem Forschungsdesiderat begegnet Silvia Ungermann mit ihrem Buch. Unter Berücksichtigung der historischen, politischen und gesellschaftlichen Entstehungsbedingungen erschließt die Autorin wesentliche Elemente der Korczak-Pädagogik auf der Basis einer Analyse des Gesamtwerks. Sie arbeitet Zusammenhänge zwischen dem auf praktischer Erziehungserfahrung und deren Reflexion gegründeten Werk und Elementen der diesem Werk zugrundeliegenden Theorie heraus. Ein Werk, das Korczaks Pädagogik als »Pädagogik der Achtung« und nicht-bürgerliche Pädagogik ganz neu entdeckt.
Rezension
Im Gütersloher Verlagshaus erscheinen seit 1996 Janusz Korczaks "Sämtliche Werke". Mitherausgeber und Leiter der Korczak-Forschungsstelle an der Bergischen Universität Wuppertal ist Prof. Dr. Friedhelm Beiner, in desen Umfeld diese Habilitationsschrift vom Fachbereich Bildungswissenschaften im WS 2004/05 angenommen worden ist. Sie ist, - gemessen an einer akademischen Qualifizierungsschrift -, verständlich verfasst, stellt die wohl intensivste, aktuellste und umfassendste Darstellung des polnischen Reformpädagogen dar und darf als ein Meilenstein in der Forschungsgeschichte gelten, weil sie umfassend auf Archivarbeit und Analyse des Gesamtwerks gründet und Korczaks Pädagogik im Gesamtkontext neu entdeckt und würdigt als eine "Pädagogik der Achtung" und als nicht-bürgerliche Pädagogik.
Oliver Neumann, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Die erste umfassende Darstellung des wissenschaftlichen und literarischen Werkes Janusz Korczaks. Korczaks Pädagogik als »Pädagogik der Achtung«. Das Standardwerk der Korczak-Rezeption. Die Wahrnehmung und Aktualisierung der reformpädagogischen und gesellschaftskritischen Arbeiten des polnischen Erziehers, Literaten und Kinderarztes Janusz Korczak steht erst in den Anfängen. Diesem Forschungsdesiderat begegnet die hier vorliegende Gesamtdarstellung der Pädagogik Korczaks. Sie erschließt die wesentlichen Elemente seines Pädagogik-Ansatzes auf der Basis einer Analyse des Gesamtwerks unter Berücksichtigung der historischen, politischen und gesellschaftlichen Entstehungsbedingungen. Es werden Zusammenhänge zwischen dem auf praktischer Erziehungserfahrung und deren Reflexion gegründeten Werk und Elementen der diesem Werk zugrundeliegenden Theorie herausgearbeitet. Eine Konturierung der Pädagogik Korczaks als »Pädagogik der Achtung« und ein Gegenentwurf zur bürgerlichen Pädagogik schließen das Werk ab. Dr. Silvia Ungermann (*1967) ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der Korczak-Forschungsstelle an der Universität Wuppertal. Inhaltsverzeichnis
Vorwort 15
1. Einleitung 17 1.1 Zur Textgrundlage und Methode der Analyse 18 1.2 Zielsetzung und Aufbau der vorliegenden Arbeit 22 Teil A: Die gesellschaftskritischen Grundlagen der Korczakschen Pädagogik 1. Korczaks kritische Auseinandersetzung mit den ungleichen Lebensbedingungen der verschiedenen Bevölkerungsgruppen in Polen als Ausgangspunkt seiner Gesellschaftskritik 28 1.1 Die familiären Wurzeln 28 1.2 Die politische und soziale Situation Polens um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert 31 2. Die sozialkritische Publizistik des jungen Korczak 34 2.1 Der Beitrag zur geistigen und ethischen Entfaltung der gesellschaftlichen Kultur 34 2.1.1 Bekämpfung des Übels durch Satire 35 2.1.2 »Bildung für alle« und »Arbeit für andere« 42 2.1.3 Philanthropische Bemühungen um die Kinder der Straße 47 2.1.4 Soziales Handeln im Warschauer Elend 50 2.2 Die Sinnsuche des jungen Korczak in Kind des Salons 52 2.3 Die Verschärfung der Gesellschaftskritik: Der Ruf nach sozialer Verantwortung 55 2.4 Der utopische Entwurf einer neuen Gesellschaft: Die Schule des Lebens 65 3. Sozialmedizinische Schriften 75 3.1 Gesellschaftskritik aus medizinischer Sicht 75 3.2 Pädiatrische Arbeiten zur Säuglingspflege 77 3.3 Beiträge zur Gesundheitshygiene 78 4. Praktische Sozialpädagogik 81 4.1 Korczaks Mitgliedschaft in sozialen Gesellschaften 81 4.2 Sommerkolonieaufenthalte 87 5. Gesellschaftskritik nach der Übernahme des Dorn Sierot 92 5.1 Satirische Reflexionen über die Verhältnisse im zeitgenössischen Polen 92 5.2 Zustand und Zukunft der Menschheit: Eine Diskussion im Senat der Verrückten 93 Teil B: Begründung einer neuen Erziehung I. Das Erziehungsmodell Dom Sierot und Nasz Dom 101 1. Die Entstehung und Entwicklung des Erziehungsmodells auf der Folie der Bedingungen der Waisenfürsorge im damaligen Polen 107 1.1 Die Anfänge des erzieherischen Systems im Dom Sierot 108 1.2 Die Verschlechterung der Entwicklungsbedingungen des Dom Sierot während des Ersten Weltkriegs 111 1.3 Die Jahre 1918 und 1919 112 1.4 Der Höhepunkt der erzieherischen Tätigkeit in den zwanziger Jahren 113 1.4.1 Die Weiterentwicklung des Erziehungsmodells im Dom Sierot 113 1.4.2 Die Anwendung des Erziehungsmodells in den Institutionen der »Rozyczka« 114 1.4.3 Das Nasz Dom in Pruszkow 115 1.5 Die Divergenzen zwischen Korczak und seinen Mitarbeiterinnen bei der Entwicklung des Erziehungssystems in den dreißiger Jahren 117 1.5.1 Veränderungen im Nasz Dom in Bielany 117 1.5.2 Kontinuität trotz Kontroverse: Die Fortsetzung des erzieherischen Systems im Dom Sierot 119 1.6 Die Bemühungen um Beständigkeit in der pädagogischen Arbeit während der Okkupationsjahre 1939-1942 120 1.7 Der experimentelle Charakter des Erziehungsmodells 121 2. Die zentralen Elemente des erzieherischen Systems 123 2.1 Zur Rezeption 124 2.2 Das Kameradschaftsgericht 128 2.2.1 Vorläufer 128 2.2.1.1 Kindergerichte in frühneuzeitlichen Schulrepuhliken . 129 2.2.1.2 Das Kindergericht in radikal-demokratischen Erziehungsrepubliken 132 2.2.1.3 Zur Entwicklung der Schülergerichte in Polen 133 2.2.2 Erste praktische Versuche in den Sommerkolonien 135 2.2.3 Das Kindergericht in den Waisenhäusern 137 2.2.3.1 Zwei Jahre Tätigkeit des Gerichts im Dom Sierot 138 2.2.3.2 Zur Entwicklung des Gerichtskodex 143 2.3 Das Kinderparlament 146 2.4 Die Zeitungen und andere Medien schriftlicher Kommunikation in den Waisenhäusern 147 2.4.1 Das Wochenblatt des Dom Sierot, die Zeitung Nasz Dom und deren Nachfolgeorgane 149 2.4.2 Korczaks Beiträge in den hausinternen Zeitungen 152 2.4.3 Die Artikel der Kinder 155 2.5 Die Dienste 157 2.5.1 Kinder als Helfer in den Ferienkolonien 157 2.5.2 Die pädagogischen Funktionen des Dienstleistungssystems im Waisenhaus 159 2.6 Das Betreuungssystem 164 2.7 Weitere Anregungen zur Selbstkontrolle und Selbstvervollkommnung 165 2.8 Zusammenfassung: Die Institutionen der Selbstverwaltung als Mittel indirekter Erziehung 169 3. Eine andere Ausbildung von Erziehern: Die Burse 172 3.1 Die Burse aus der Sicht der Praktikanten und Erzieher 173 3.1.1 Die Aufnahme 173 3.1.2 Die Aufgaben der Bursisten 174 3.1.3 Reflexion des Erziehungsalltags 175 3.1.3.1 Die Tagebücher 175 3.1.3.2 Die Treffen der Bursisten 177 3.1.3.3 Seminare bei Korczak 178 3.2 Die Merkmale der Praktikanten-und Erzieherausbildung 180 4. Die Erziehungspraxis Janusz Korczaks aus der Sicht von Zeitzeugen - Würdigung und Kritik 181 4.1 Der Kontrast zwischen den Lebensbedingungen der Zöglinge vor und nach der Aufnahme ins Waisenhaus 181 4.2 Der Beginn der fürsorglichen Betreuung in den ersten Tagen im Waisenhaus 184 4.2.1 Die Aufnahmeprozedur 185 4.2.2 Das Betreuungssystem 186 4.3 Das pädagogische System aus der Sicht ehemaliger Zöglinge 187 4.3.1 Die Institutionen der Selbstverwaltung 187 4.3.2 Weitere Erziehungsmittel 192 4.3.3 Die Atmosphäre im Waisenhaus 198 4.3.4 Kritik am erzieherischen System 200 4.3.5 Dankbarkeit 206 II. Erziehungsliterarische Arbeiten für Kinder 209 a) »Romane« für Kinder 212 1. Die Lebensbedingungen der Kinder des Proletariats und ihre Verbesserung 215 1.1 Literarische Reportagen über Sommerkolonien 215 1.2 Ruhm. Erzählung 218 2. Gestaltung einer friedlicheren Welt durch verantwortungsbewußten Umgang mit Macht: Die König-Macius-Romane 221 2.1 Der historisch-politische Entstehungshintergrund 221 2.2 Der nicht immer erfolgreiche Einsatz des Kinderkönigs für Gleichberechtigung und Demokratie 228 3. Minderung des Elends durch Selbstverwaltung: Der Bankrott des kleinen Jack 234 4. Veränderung der Welt durch Zauberei? Kajtus Wandlung vom eigensinnigen Lausbub zur selbstverantwortlichen Persönlichkeit 236 5. Eine Biographie als Identifikationsmodell: Die Lebensbeschreibung des Louis Pasteur 239 b) Publizistik für Kinder und Jugendliche 246 1. Politische Journalistik für Jugendliche 248 2. Über die Schulzeitung 250 3. Radiosendungen als Anlaß für einen Dialog mit den Kindern . 255 3.1 Die Zusammenarbeit mit dem Polnischen Rundfunk 255 3.2 Korrespondenzen mit jungen Radio-Hörern 258 4. Eine Anleitung zum solidarischen Handeln: Beiträge über Genossenschaftsarbeit in der Schule 261 5. Publizistik für jüdische Kinder 264 5.1 Zur Textgenese: Korczaks Aufenthalte in Palästina 265 5.2 Ansätze zur Begründung einer neuen Gesellschaft: Die Leistungen der Siedler in Eretz Israel 270 5.2.1 Die Menschen sind gut 271 5.2.2 Beiträge in der jüdischen hebräischen Pressein Polen 272 5.3 Das Judentum als Religion der Tat 273 5.3.1 Drei Reisen Herscheks 273 5.3.2 Kinder der Bibel: Mose 276 c) Die Kleine Rundschau, eine Zeitung von Kindern für Kinder 279 1. Die Beiträge Korczaks zur Kinderzeitung 283 2. Die Redaktion 288 3. Zur Erfolgsgeschichte der Kleinen Rundschau: Von der Zeitung für Kinder und Jugendliche zur Kinder-und Jugendzeitung 291 III. Erziehungsliterarische Arbeiten für Erwachsene 295 1. Bobo - Eine entwicklungspädagogische Trilogie 297 1.1 Frühkindliche Entwicklung 297 1.2 Die Sorgen eines Schülers 302 1.3 Das Tagebuch eines Pubertierenden 305 2. Wenn ich wieder klein bin - Ein Autor wird wieder Kind 310 3. Lebensregeln - Ein Versuch, beratend zwischen den Generationen zu vermitteln 316 4. Über die Einsamkeit - In jedem Alter ist der Mensch auf sich selbst gestellt 324 4.1 Die Einsamkeit des Kindes 325 4.2 Die Einsamkeit der Jugend 326 4.3 Die Einsamkeit des Alters 327 IV. Zusammenfassung: Korczaks Bemühungen um eine Erziehungsreform 329 1. Frühe Äußerungen zu den Themen Schule und Erziehung in der Familie 330 2. Die Begründung eines Modells für die Erziehung in Gruppen 335 3. Förderung der Teilhabe des Kindes durch erziehungsliterarische Arbeiten 338 4. Zur Zielperspektive der Korczakschen Erziehungsbemühungen 341 Teil C: Elemente der Pädagogik Janusz Korczaks 1. Das Bild des Kindes als Grundlage des erzieherischen Verhältnisses 347 1.1 Das »Ursprungsdenken vom Kinde aus« in der reformpädagogischen Bewegung 347 1.1.1 Die Enthüllung der »wahren Natur« des Menschen. Das Kind als Erlöser und Heilbringer bei Maria Montessori 351 1.1.2 Das Kind als Subjekt und »Majestät« - Ellen Keys Kindbild zwischen Anthropologie und Mythos 355 1.1.3 »Demokratische Erfahrung« als Grundlage der »zweiten Natur« des Kindes bei John Dewey 357 1.1.4 Möglichkeiten und Grenzen des »pädagogischen Ursprungsdenkens« 362 1.2 Janusz Korczaks Kindbild 364 1.3 Erziehungsphänomenologie versus Ursprungsdenken? 369 2. Die Rechte der Kinder 372 2.1 Der Ausgangspunkt der Korczakschen Kinderrechtsdiskussion 373 2.2 Das Recht des Kindes auf Verbesserung seiner Lebensbedingungen 374 2.3 Die Proklamation der Grundrechte des Kindes 375 2.3.1 Der Weg zur Kinderrechtsproklamation 375 2.3.2 Die Interpretation der »Magna Charta Libertatis« 376 2.3.3 Das »Grundgesetz« der Kinderrechte als Schutz- und Sicherungsinstanz 381 2.3.4 Die Bedeutung der Rechte des Kindes für die Gestaltung des pädagogischen Verhältnisses 382 2.3.5 Die Kinderrechte als Weg in eine gewaltfreie Erziehung 383 2.4 Korczaks Wandel zu einem radikal-emanzipatorischen Kinderrechtler 384 2.4.1 Das Mitspracherecht des Kindes 385 2.4.2 Gesellschaftliche Einflüsse: Die Forderung nach Kinderrechten in Polen in den zwanziger Jahren 386 2.4.3 Das Recht des Kindes auf Achtung 387 2.5 Die Menschenrechte des Erziehers 390 2.6 Die Rechte des Kindes in den Kinderbüchern 392 2.6.1 Wege aus der Rechtlosigkeit 393 2.6.2 Die Konkretisierung der Rechtsforderungen 395 2.7 Die Entwicklung des Kinderrechtsgedankens bei Janusz Korczak 398 2.8 Die Rechte der Kinder bei Janusz Korczak und in der internationalen Diskussion 399 3. Der Beitrag Korczaks zur Kindheitsforschung 406 3.1 Die pädagogische Kinderforschung Korczaks 408 3.1.1 Der experimentell-pädagogische Ansatz 408 3.1.2 Narrativ-verstehende Kinderforschung 411 3.1.2.1 Der ethnographisch orientierte Ansatz 412 3.1.2.2 Hermeneutische Pädagogik als Anleitung für eigene Forschungen des Erziehers 415 3.1.2.3 Zum emanzipatorischen Interesse ethnographisch orientierter Kinderforschung 416 3.2 Zum gegenstandstheoretischen Schlüsselbegriff der Korczakschen Kinderforschung 417 3.2.1 Das Kind in der sozialwissenschaftlichen Kindheitsforschung des 20. Jahrhunderts 418 3.2.1.1 Das Kind als Wesen in Entwicklung 418 3.2.1.2 Das Kind als »Person aus eigenem Recht« 419 3.2.1.3 Grenzen des neuen Forschungsparadigmas 421 3.2.2 Das Paradigma in der Kinderforschung Korczaks 422 3.3 Soziometrische Befragungen zur Erfassung der Beziehungen in Kindergruppen 422 3.3.1 Erhebung der Daten 423 3.3.2 Darstellung und Auswertung der Daten 425 3.3.3 Zur Kritik der Kinder und anderer Zeitzeugen an der Veröffentlichung der Erhebungsergebnisse 430 3.3.4 Korczaks soziometrische Befragungen im Kontext der Soziometrie 431 4. Der Beitrag Korczaks zur Theoriebildung in der Erziehungswissenschaft 436 4.1 Möglichkeiten und Grenzen pädagogischer Theorie 438 4.2 Reflexion der eigenen Erziehungspraxis 441 4.3 Das Problem der Übernahme von Fremderfahrung 446 4.4 Systematische Versuche der Kinderbeobachtung in der Schule, im Kindergarten und beim Einzelunterricht 447 4.4.1 »Momentaufnahmen« im Schulunterricht 448 4.4.2 Beobachtungen im Kindergarten 449 4.4.3 Verstehensbemühungen im Einzelunterricht 452 4.5 Zum Verhältnis von Theorie und Praxis bei Janusz Korczak 455 5. Achtung als ethische Grundlage der Korczak-Pädagogik 460 5.1 Zum Begriff der Achtung 460 5.2 Zur Entfaltung des erzieherischen Handelns bei Janusz Korczak aus dem Prinzip der Achtung 464 5.2.1 Der Ausgangspunkt: Anprangerung von Mißachtung 465 5.2.2 Erziehung als komplexes System von Beziehungen und Einflüssen 466 5.2.3 Korczaks Arbeitsprinzipien und Erkenntnismethoden als Bedingungen eines achtungsvollen Umgangs mit Kindern 472 6. Die gesellschaftsrefbrmerischen Implikationen der Korczak-Pädagogik - oder: Demokratische Erziehung für eine autonome Gesellschaft 476 Anhang 1. Stefania Wilczynska - Haupterzieherin im Dom Sierot 485 1.1 Korczaks Mitarbeiterin im Spiegel der Forschung 487 1.2 Die Auswertung neuer Quellen 489 1.2.1 Das erste Jahr im Dom Sierot 489 1.2.2 Das Waisenhauses während des Ersten Weltkrieges 491 1.2.3 Stefas Aufgaben in den Jahren 1918-1929 492 1.2.3.1 Verpflichtungen innerhalb des Dom Sierot 493 1.2.3.2 Stefas Engagement außerhalb des Dom Sierot 496 1.2.4 Die Entwicklung in den 3oer Jahren 496 1.2.5 Die Trennung vom Dom Sierot 501 1.2.6 Die Rückkehr ins Dom Sierot angesichts der drohenden Vernichtung 504 1.2.7 Die Übersiedlung ins Ghetto 505 1.2.8 Der letzte Weg 506 1.3 Zusammenfassung: Stefania Wilczyhskas Beitrag zur Waisenhauspädagogik des Dom Sierot 507 2. Korczaks Bemühungen um Kontinuität in der pädagogischen Arbeit im Kontext der sozialen Gegebenheiten während der Okkupationsjahre 1939-1942 510 2.1 Die letzten Jahre des Dom Sierot 510 2.1.1 Die Vorkriegszeit 510 2.1.2 1939/1940-Noch in der Krochmalna-Straße 92 512 2.1.3 Chiodna-Straße 33 517 2.1.4 Sienna-Straße 16/Sliska-Straße 9 520 2.2 Beständigkeit in der pädagogischen Arbeit 529 2.3 Exkurs: Korczaks Engagement außerhalb des Waisenhauses 531 Literatur 537 |
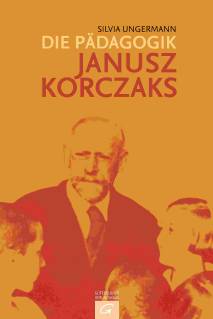
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen