|
|
|
Umschlagtext
Cassirers Auseinandersetzung mit dem Mythos in den zwanziger Jahren erschloss eine grundlegende Erweiterung und Neuorientierung der Erkenntnistheorie. Durch die Analyse des Mythos als einer der Wissenschaft, der Sprache und der Kunst beigeordnete Wirklichkeitserschließung bahnte Cassirer den Weg von einer Kantischen Kritik der Vernunft zur Kritik der Kultur. In den vierziger Jahren vertiefte und bereicherte er seine Mythosphilosophie durch eine erneute Auseinandersetzung mit den anthropologischen Quellen. Hieraus entfaltete Cassirer den Begriff des modernen politischen Mythos zur Beschreibung der politischen Technik des Nationalsozialismus. Die Kulturphilosophie Cassirers zeichnet sich aus durch die Betonung der Vielheit der Perspektiven zur Weltgestaltung und dem Weltverstehen. Gerade der Mythos stellt den vielleicht wichtigsten Prüfstein dieser neuschöpfenden und pluralen Theorie der Erkenntnis und des Lebens dar.
Die Autorin Esther Oluffa Pedersen (geboren 1975) ist Absolventin und Doktorin der Philosophie der Universität Kopenhagen, Dänemark. Heute ist sie am Institut für Philosophie und Ideengeschichte an die Universität Aarhus, Dänemark angestellt. Rezension
Nach Ernst Cassirer ist der Mensch ist nicht nur durch Erkenntnis (Vernunft) geprägt, sondern auch durch Erleben (Mythos, Symbol, Religion, Kunst). Das hat er in seinem dreibändigen philosophischen Hauptwerk "Philosophie der symbolischen Formen" vor allem im Zweiten Teil: "Das mythische Denken" herausgearbeitet. Der Kultur-Philosoph Ernst Cassirer (1874-1945), der von 1919-33 Professor in Hamburg war und dann zunächst nach Oxford emigrierte, später nach Göteborg und seit 1941 in die USA (Yale University und Columbia University in New York), hat in den vergangenen 40 Jahren eine Art Renaissance bzw. erst die eigentliche Entdeckung erlebt. Seine Beschreibung des Menschen als Symbol verwendendes Tier und der symbolischen Formen hat z.Zt. Konjunktur, - nicht nur im Kontext einer religionspädagogischen Symboldidaktik; Symbol und Mythos wurden überhaupt wiederentdeckt. Im Gegensatz zur üblichen Ansicht in der Philosophie von der objektiven Nichtigkeit und Irrelevanz mythischen Denkens für die Philosophie kommt dem Mythos nach Ernst Cassirer eine besondere Bedeutung zu als Denkform, als Anschauungsform und als Lebensform. Gleichwohl ist sich auch Cassirer der Dialektik des mythischen Denkens bewußt.
Thomas Bernhard, lehrerbibliothek.de Inhaltsverzeichnis
Einleitung 11
Texthinweise 14 Erster Teil — Die Philosophie der symbolischen Formen und der Kantische Einfluss 15 Kapitel 1 — Auseinandersetzungen mit der Kritik der reinen Vernunft 19 1. Die Diagnostik der Metaphysik — synchrone und diachrone Analyse 20 2. Die Fackel der Vernunftkritik — Spuren einer Thematik der Philosophie der symbolischen Formen in Cassirers Deutung der Kritik der reinen Vernunft von 1918 24 Verdoppelungen der Fragestellung 26 Die Funktionen der Einheit in den Urteilen 27 Das naturwissenschaftliche Paradigma — Cassirers Neukantianismus 29 Die Pluralität der kritischen Philosophie — eine alternative Lesart 31 Dualismus oder Monismus 34 Cassirer und Kant 35 Cassirer und Heidegger 40 Cassirer und Kant — erneut bedacht 41 3. Cassirers wiederholtes Ringen mit der Kritik der reinen Vernunft in der Philosophie der symbolischen Formen 43 Mythos, Sprache, Erkenntnis — drei Funktionen des Geistes 45 Systematik des Geistes 49 Konflikte der Kultur 52 Die Sinnlichkeit der symbolischen Formen 54 Das Verhältnis zwischen Zeichen und Bewusstsein 56 Die Spannung zwischen Erfahrung und Erkenntnis 58 Kapitel 2 — Die theoretischen Denkanstöße aus der Kritik der Urteilskraft zur Grundlegung einer Kritik der Kultur 63 Gangbare Wege der Philosophie — Krisis und Ur-Teilung 64 1. Der Gefühlsboden der Welterschließung 68 Die Technik der Natur 70 Eine Historisierung der Naturerkenntnis 74 Das Gefühl der Lust als Grund a priori für die Fasslichkeit der Natur 77 Die Einbeziehung des Gefühls in den Kreis des apriorisch Bestimmbaren 80 Mythos und Gefühlsleben als Basis der Kultur 82 2. Symbol, Bild, Schema 83 Das doppelte Geschäft der Urteilskraft 84 Hypotypose, eine Versinnlichung der Vernunft 86 Symbolische Erkenntnis 88 Cassirers Inversion der Kantischen Philosophie 90 Ansatzpunkt in der Sinnlichkeit 92 Polarisierung des Erfahrungsbegriffs 94 3. Teleologie, Metaphysik und Kritik 96 Zweckmäßigkeit und die Setzung eines göttlichen Intellekts 97 Cassirers zwei Interpretationsstrategien 98 Intellectus ectypus und intellectus archetypus 101 Immanente Unendlichkeit der menschlichen Endlichkeit 104 Goethe, Unendlichkeit und Urphänomen 105 Kapitel 3 — Symbolische Formen, Repräsentationen der Welt 110 Characteristica generalis 110 1. Die Funktion des Symbols 115 Drei Richtungen der Erfahrung 118 2. Relationalität zwischen Individuum und Geist 123 Intellektualismus 127 Die Kantische Formel: Synthesis 128 Doppelcharakteristik des Ausdrucks, der Darstellung und der Bedeutung 130 Problem des Intellektualismus Cassirers 135 Die Rationalisierungsannahme der Philosophie der symbolischen Formen 137 3. Symbolische Formen, Zeichen und Zeichengebung 140 Die symbolischen Formen und die Zeichengebung 142 Unmittelbarkeit und Distanzierung in der Zeichengebung 144 Abschließende Bemerkung 151 Zweiter Teil — Die Verästelungen der Mythosphilosophie Ernst Cassirers 153 Kapitel 1 — Der Mythos, seine Bedeutung und Leistungen 157 1. Mythos als Mutterboden der Kultur 160 Kulturelle Evolution 164 Die Logik der Götternamen — eine Theorie der Urprädikation 170 Augenblicksgötter, Sondergötter und persönliche Götter 172 Sondergötter — die Ausbildung der Klassifikation durch das tätige Tun 179 Lebensgefühl, Sozialität und Praxis des mythischen Denkens 182 2. Der Aufbau der mythischen Lebenswelt 192 Der Grundgegensatz zwischen Heiligem und Profanem 195 Das konkrete Denken — die mythische Zeichensetzung 201 Kapitel 2 — Der politische Mythos 206 1. Einsatz des Mythos — eine Reaktion auf Gefahr 213 2. Der Mythos des Staates 219 Der politische Erfahrungsraum 224 Die Pendelschläge der Kultur 230 Mythos als eine mentale Waffe des Politischen 231 3. Die Mythosphilosophie Cassirers im Ausblick 236 Literaturverzeichnis 241 |
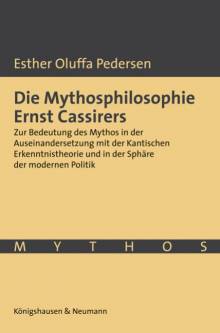
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen