|
|
|
Umschlagtext
Siehe Verlagsinformation.
Rezension
„Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmenden Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt: Der bestirnte Himmel über mir, und das moralische Gesetz in mir.“, heißt es im „Beschluss“ zur Kritik der praktischen Vernunft“ von Immanuel Kant (1724-1804). Dieses Zitat ist auch auf dem Grabstein des Philosophen in Königsberg verewigt.
Aufklärung, Autonomie, guter Wille, kategorischer Imperativ, Zweck an sich selbst, Pflichten, Ding an sich, Transzendentalphilosophie und Urteilskraft zählen zweifelsohne zu den zentralen Begriffen der Philosophie Kants. Der Theoretiker der Humanität, Kosmopolit und Begründer des ethischen Universalismus gilt als einer der größten Philosophen der Welt. Bekanntheit erlangte er durch seine drei großen Kritiken: „Kritik der reinen Vernunft“(1781/1787), „Kritik der praktischen Vernunft“(1788) und „Kritik der Urteilskraft“(1790), durch seine „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“(1785/1786), seine Schrift „Zum ewigen Frieden“(1795/96) und insbesondere durch seinen Aufsatz „Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?“(1784). Kants Begriffsprägungen, Ideen und Argumentationen haben die deutsche und internationale Philosophie seit Ende des 18. Jahrhunderts entscheidend geprägt und beeinflussen noch heute aktuelle philosophische, gesellschaftliche und politische Diskurse. Was versteht Kant unter Aufklärung? Warum kritisiert er die Metaphysik seiner Zeit? Wie kommt der Mensch zu Erkenntnissen? Hat der Mensch einen freien Willen? Ist der kategorische Imperativ das höchste Moralprinzip? Besitzen alle Menschen eine Würde und sind als „Zweck an sich selbst“ zu behandeln? Entwirft Kant ein Modell einer Weltrepublik? Wie steht der Philosoph zu einem Menschenrecht auf Immigration? Entwirft er eine eigene Religionsphilosophie? Was ist das Schöne? Besitzt Kants Art und Weise des Philosophierens noch Aktualität? Fundierte Antworten auf diese Fragen liefert Otfried Höffe (*1943) in seinem Buch „Der Weltbürger aus Königsberg. Immanuel Kant heute. Person und Werk“. Dieses erschien im September 2023 im S. Marix Verlag. Bekanntheit erlangte der emeritierte Philosophie-Professor der Eberhard-Karls-Universität Tübingen u.a. durch seine zahlreichen Publikationen zur politischen Philosophie, zur Ethik, zur Praktischen Philosophie des Aristoteles, zu Rawls` Theorie der Gerechtigkeit und insbesondere zu Kants philosophischem Gesamtwerk. Besondere Erwähnung verdienen hier Höffes Gesamtdarstellungen von Kants „Kritik der praktischen Vernunft“ und „Kritik der reinen Vernunft“ sowie die von ihm herausgegebenen kooperativen Kommentare zu seinen philosophischen Werken. Zur Zeit lehrt der emeritierte Tübinger Philosophieprofessor noch an der Tsinghua-Universität in Peking und betreut dort Doktoranden. In seinem jüngsten Werk zu Kant, publiziert im Jahr vor dessen 300. Geburtstag, gelingt es Höffe hervorragend, das Leben und philosophische Œuvre des Aufklärers zu erschließen. Insbesondere zeichnet sich das Buch durch eine auch für philosophische Lai:innen verständliche Sprache aus. So konzentriert sich der Kant-Experte bei seinen Ausführungen primär auf die Originalschriften des Philosophen. Höffe zeigt überzeugend auf, dass Kant ein Vertreter des Weltbürgertums und der Demokratie war. Dessen „epistemischer Kosmopolitismus“ und moralischer Universalismus kann angesichts der Verbreitung postmodernen Denkens besondere Aktualität für sich reklamieren oder in Worten Höffes in Anlehnung an einen Song der Rolling Stones: „You K`ant get no satisfaction“. Auch auf die Debatte, ob Kant ein Rassist war, geht Höffe in einem eigenen Exkurs ein. Er verteidigt Kant gegen den Rassismus-Vorwurf, in dem er darauf verweist, dass dessen rassistische Äußerungen nicht aus seinen Hauptwerken stammen und für seine Philosophie systematisch keine Rolle spielen. Auf die in der Fachliteratur diskutierten Grenzen und Probleme von Kants Ethik, zum Beispiel auf seinen Anthropozentrismus, seine kognitivistische Ethik und seine Ablehnung eines Menschenrechts auf Immigration hätte in dem Buch genauer eingegangen werden können. Auf Seite 75 wird die Abbildung zur Architektonik der „Kritik der reinen Vernunft“ fälschlicherweise als „Kants Urteils- und Kategorientafel“ deklariert. Lehrkräfte der Fächer Ethik und Philosophie werden durch die vorliegende Darstellung motiviert, sich mit dem Œuvre Kants problemorientiert auseinanderzusetzen. Die Beschäftigung mit Kants deontologischer Ethik gehört zu den zentralen Gegenständen des schulischen Ethik- und Philosophieunterrichts der Oberstufe. Zudem werden dort vielfach seine Anthropologie, seine Erkenntnistheorie, seine Ästhetik, seine Religionsphilosophie, seine Friedensschrift, sein Aufklärungsaufsatz oder seine pädagogischen Vorlesungen thematisiert. Ethik- und Philosophie-Lehrkräfte motiviert der Band von Höffe, sich differenziert mit den Begriffen, Argumentationen und Positionen Kants auseinanderzusetzen. Die Lektüre des Buches kann Lehrkräfte zudem vor didaktischen Verfälschungen im Unterricht bewahren. Fazit: Otfried Höffes Buch „Der Weltbürger aus Königsberg“ kann allen an der Philosophie des großen Aufklärers Interessierten nur zur Lektüre empfohlen werden. Zudem unterstreicht dieses Werk eindrücklich die Aktualität eines Philosophierens mit und nach Kant. Dr. Marcel Remme, für lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Was hat ein Philosoph der Aufklärung uns im 21. Jahrhundert noch zu sagen? Unser Autor hat sich zeit seines Lebens ausführlich mit dem Königsberger Denker, nach dem man die Uhr stellen konnte, wie eine populäre Anekdote lautet, auseinandergesetzt und ist sich sicher: Die Aktualität Kants liegt in seinem Kosmopolitismus. Kant war Weltbürger und überzeugter Demokrat und seine Philosophie, die er mit einer großen Fülle und Tiefe an Argumenten dargelegt hat, wird im Gegenzug auch weltweit anerkannt, da sie kulturübergreifend verständlich und einleuchtend ist, was ihn zu einem der wichtigsten Denker unter allen Philosoph:innen macht. Zu seinem runden Geburtstag sollen diese kantischen Gedanken aus sich selbst heraus zum Leuchten gebracht werden. Für die Lektüre benötigt man keine Vorkenntnisse in Kants Philosophie und er selbst wird ausführlich zitiert. Der umfangreiche und klar gegliederte Text geht auf viele Themen anhand der Hauptwerke ein, denn Kant hat sich mit fast allem befasst. Dabei sind die Fragen, die er aufwirft, auch noch heute radikal und provokant, was auch für viele seiner Antworten zutrifft. Inhaltsverzeichnis
Vorwort 11
Die Person als Vorbild 1. Aufstieg aus einfachen Verhältnissen 19 2. Enzyklopädische Wissbegier 23 3. Bürgerliche Tugenden - mit Geselligkeit 3.1 Sekundärtugenden 29 3.2 Der »elegante Magister« 32 4. Der Philosophielehrer 34 5. Antriebskräfte 36 5.1 Aufklärung 37 5.2 Richterliche Kritik 40 5.3 Moral 43 5.4 Ortsgebunden und dochKosmopolit 46 5.5 Eine demokratische Grundhaltung 51 I. Was kann ich wissen? - Theoretische Philosophie 55 1. Der Mensch rückt ins Zentrum 56 2. Wider den »Eigendünkel der Spekulation« 62 2.1 Eine tragische Situation 63 2.2 Metaphysik revolutionieren, nicht abschaffen 64 3. Mathematik: kein Vorbild für die Philosophie 66 4. Aufwertung der Sinnlichkeit 4.1 Kants Aktualität 69 4.2 Neubewertung der Mathematik 70 4.3 Individualität 72 4.4 Apologie der Sinnlichkeit 73 5. Reine Verstandesbegriffe: die Kategorien 5.1 Das neue Programm 74 5.2 Bleibende Bedeutung 78 5.3 Das transzendentale »Ich denke« 81 6. Philosophische Naturgesetze 6.1 Fundamentalphilosophie ist erfahrungsunabhängig 82 6.2 Ein erstes Naturgesetz: Die Natur ist mathematisch verfasst 85 6.3 Zwei weitere Naturgesetze: Substanz- und Kausalitätsprinzip 88 7. Eine alternative Philosophie des Geistes 7.1 Kritik der Unsterblichkeitsbeweise 93 7.2 Zwei kleine Einsichten 96 7.3 Wo bleiben der moralische und der ästhetische Geist? 98 7.4 Kritik eines neueren Klassikers: Gilbert Ryle 99 8. Astrophysik und Mikrophysik 8.1 Über Newton hinaus: rein säkular 101 8.2 Die Biologie vermag weniger als die Physik 104 8.3 Logik der Forschung: »Abgrund der Unwissenheit« 105 9. Revolution der philosophischen Theologie 9.1 Ein überholtes Thema? 110 9.2 Ein Gott für Naturforscher 112 9.3 Weder die Existenz Gottes noch seine Nichtexistenz sind beweisbar 116 10. Zur Würde der Philosophie 118 10.1 Aufklärung, demokratisch 120 10.2 Ein epistemischer Kosmopolitismus 123 10.3 Metaphysik in nachmetaphysischer Zeit 125 10.4 Ein theorieinterner Übergang zur Praxis 127 10.5 Die weltbürgerliche Philosophie 129 11. Ein Vorbild für wissenschaftliche Prosa? 11.1 Für Fachkollegen: ein ciceronisches Deutsch 131 11.2 »Wahre Popularität« 137 11.3 Studentenfreundliche Vorlesungen 139 11.4 Kant: Ein Kandidat für den Sigmund-Freud-Preis 140 II. Was soll ich tun? - Moral und Recht 1. Kants Doppelrolle: Vorbild und Provokation 143 2. Der kategorische Imperativ: Nur eine neue Formel 146 2.1 Unbescheiden: eine erfahrungsfreie Moralphilosophie 147 2.2 Drei Imperative, drei Stufen von Freiheit 148 2.3 Bescheiden: eine Entdeckung, keine Erfindung 150 2.4 Eine Maximenethik 153 2.5 Fünf Vorteile 155 2.6 Der Demokratie-Wert 159 3. Zwei Beispiele 3.1 Lügeverbot 161 3.2 Kein Recht, aus Menschenliebe zu lügen 164 3.3 Das Depositum-Beispiel 166 4. Determinismus oder Freiheit? 170 4.1 Die Herausforderung 170 4.2 Freiheit 1: Denkbar, nicht erkennbar 173 4.3 Freiheit 2: objektiv real 175 4.4 Radikale Freiheit: Autonomie des Willens 180 5. Wider die Überhöhung des Wir 182 6. Ein Vernunftbegrif des Rechts 6.1 Paradox: positiv-überpositiv 184 6.2 Reine praktische Vernunft: Das Recht als Moral 186 6.3 Der kategorische Rechtsimperativ 189 6.4 Menschenwürde und Menschenrechte 193 6.5 Warum Eigentum? 198 7. Zwangsbefugnis, legitime Herrschaft, Kriminalstrafe 205 7.1 Braucht Kant eine Hermeneutik des Wohlwollens? 205 7.2 Ärgernis 1: Zwangsbefugnis des Rechts 208 7.3 Ärgernis 2: Politische Herrschaft 212 7.4 Ärgernis 3: Strafe als Vergeltung 215 7.5 Der Rechtsstaat 221 7.6 »Den Staat braucht selbst ein Volk von Teufeln« 223 8. Ein ewiger Friede 225 8.1 Vorbild eines politischen Denkers 226 8.2 Welche Ewigkeit ist im »Ewigen Frieden« gemeint? 229 8.3 Der Staat 230 8.4 Völkerbund oder Weltrepublik? 232 8.5 Ist jede humanitäre Intervention ein Unrecht? 240 8.6 Sind Republiken beziehungsweise Demokratien per se friedfertig? 244 8.7 Ein Besuchsrecht, kein Gastrecht 246 III. Was darf ich hoffen? - Geschichte, höchstes Gut, Religion 251 1. Ein verlorenes Thema: Hat Geschichte einen Sinn? 253 1.1 Säkular 254 1.2 Kosmopolitisch 255 1.3 Rechtsfortschritt 258 1.4 Die Antriebskraft: ungesellige Geselligkeit 266 2. Eine Provokation: das höchste Gut 270 2.1 Vom Sollen zum Hoffen 271 2.2 Zwei Postulate: Unsterbliche Seele und Existenz Gottes 276 2.3 Der moralische Glaube 278 3. Religionsphilosophie für eine säkulare Gesellschaft 280 3.1 Revolution der philosophischen Theologie 282 3.2 Christentum ohne Offenbarung 283 3.3 Ein verdrängtes Thema: das Böse 286 3.4 Ein Philosoph liest die Bibel 291 3.5 Ein ethisches Gemeinwesen: die unsichtbare Kirche 296 IV. Was ist der Mensch? 299 1. »Anthropologie in pragmatischer Hinsicht« 1.1 Die neue wissenschaftliche Disziplin 302 1.2 Vom Erkenntnisvermögen 308 1.3 Vom Gefühl der Lust und Unlust 312 1.4 Leidenschaften 313 1.5 Humanität: Eine gelungene Tischgesellschaft 314 1.6 Über Charaktere 317 2. Kultivieren, Zivilisieren, Moralisieren 3 2.1 Eine kosmopolitische Pädagogik 321 2.2 Leitzweck: Aufklärung 322 2.3 Drei Erziehungsziele und eine Voraufgabe 323 2.4 Der dreifache Wert des Menschen 331 2.5 Das Kind soll spielen, aber auch arbeiten lernen 333 2.6 Bürger bilden 336 3. Nur der Mensch als Endzweck 3.1 Ein fremdes Thema? 337 3.2 Allein der Mensch, kein Tier 338 3.3 Gattungsegoismus? 341 V. Zweckdenken 1. Eine verlorengegangene Denkweise erneuern 349 2. Das Schöne und das Erhabene 2.1 Geschmacksurteile 352 2.2 Eine ästhetische Revolution: Kunst des Genies 354 2.3 Das Schöne 357 2.4 Das Erhabene 361 3. Zweckmäßigkeit in der Natur: Biologie 364 3.1 Biologische Zweckmäßigkeit 365 3.2 Kausalität plus Teleologie 369 4. Der Endzweck der Natur: der Mensch 4.1 Teleologie der Gesamtnatur 372 4.2 Welcher Mensch als Endzweck? 376 4.3 Noch einmal: Ein moralischer Glaube 380 (K)Ein Schlusswort 384 Siglen 386 Literatur 387 Sachregister 393 |
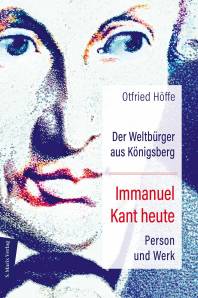
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen