|
|
|
Umschlagtext
Dorothea Weltecke, Dr. phil., ist Professorin für die Geschichte der Religionen und des Religiösen an der Universität Konstanz und arbeitet dort im Exzellenzcluster "Kulturelle Grundlagen von Integration".
Rezension
Dorothea Welteckes umfangreiche und intensiv auf die historischen Quellen zurückgreifende Arbeit ist eine im Detail durchgeführte Kritik an der geschichtsphilosophisch konzipierten Darstellung des Atheismus in der Neuzeit. Wie sie schreibt, kommt "es vor allem darauf an, der Vorstellung von einer notwendigen Fortschrittsentwicklung des menschlichen Geistes hin zur Rationalität und zum Atheismus alternativ Historisierungen zur Seite zu stellen." (25)
Nicht nur im populären Denken stellt sich das Mittelalter als einheitliche Glaubenswelt dar, dessen 'finstere' und ignorante Züge sich im Topos von der dort angeblich herrschenden durchgehenden Verfolgung des unabhängigen Denkens manifestieren. Der Atheismus, der sich seit der frühen Neuzeit zunehmend als Avantgarde des freien, rationalen, fortschrittlichen und aufgeklärten Denkens versteht, findet dementsprechend im Mittelalter Vorläufer der eigenen Position wie den Grafen Jean von Soissons oder Kaiser Friedrich II., deren atheistische Überzeugungen unterdrückt worden seien. Weltecke kann nun zeigen, dass die Sache so einfach nicht ist, vor allem auch, weil sich die Kategorie 'Atheismus' als ungeeignet erweist, die tatsächlich vorhandenen Denkfiguren, die im mittelalterlichen Diskurs als kritikwürdig betrachtet wurden, zu erfassen: "Nicht an Gott zu glauben war vor 1500 ein Leiden, eine Anfechtung ... Es war auch eine unvernünftige Narretei oder eine närrische Vernunft ... Nur war es nicht die Grundlage einer Theorie." (466) Nichtglauben und Glaubenszweifel waren zwar vorhanden, wurden aber nicht kriminalisiert. Das Nichtsein des Glaubens war "... kein Verbrechen und wurde auch nicht juristisch verfolgt." (461) In der Konsequenz von Welteckes Ausführungen sind lieb gewordene Geschichtstheorien zu revidieren: "Der Satz, dass kein Gott sei, muss nicht unbedingt als Folge konsequenter Rationalität und Wissenschaftlichkeit gelten" (455) Weltecke rechnet solche Theorien "...zum Kern des mythischen Denkens der Neuzeit". Es gelte diese ebenso wie die Konstruktionen vom gläubigen Mittelalter und seinem monolithischen Weltbild zu revidieren. 'Der Narr spricht' ist eine Habilitationsschrift. Ihre Lektüre führt in feine Verästelungen der Quellenlage und der wissenschaftlichen Diskussion über historische Auffassungen und Erkenntnisse. Von daher kann von diesem Buch zunächst keine Breitenwirkung erwartet werden. Dennoch sollte es auf lange Sicht deutliche Auswirkungen auf die oft nur polemische Debatte unter dem Motto 'Neuer Atheismus' haben. Welteckes Forschungsergebnis zwingt nämlich beide Seiten, sich sowohl über den eigenen Glaubens- oder Unglaubensbegriff als auch über geschichtsphilosophische Annahmen Rechenschaft zu geben. Matthias Wörther, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Bis heute gilt das Mittelalter als Zeitalter des Glaubens, in dem Menschen, die an der Existenz Gottes zweifelten, systematisch verfolgt wurden. Dorothea Weltecke weist nach, dass diese Annahme ein Mythos ist, der in der Neuzeit entstand. Sie untersucht die Verwendung der Begriffe "Unglauben " und "Zweifel" in den zeitgenössischen Schriften und belegt: Der Gedanke, dass Gott nicht ist, existierte durchaus. Er wurde in der Beichte geäußert und in der spirituellen Literatur beschrieben. Allerdings waren es nicht, wie oft angenommen, vorrangig die Intellektuellen, die an der Existenz Gottes zweifelten. Denn da der Atheismus theologischen und philosophischen Grundannahmen widersprach, nahmen die Gelehrten ihn lange Zeit nicht ernst. Diese beiden Befunde - dass der Unglaube schon im Mittelalter existierte, aber keineswegs eine Sache der Gelehrten war - eröffnen einen gänzlich neuen Blick auf das Mittelalter wie auf die Geschichte des Atheismus. Inhaltsverzeichnis
Inhalt Einleitung 9 Kapitel I: Zur Geschichte der Aufklärung und des Atheismus: Wissenschaftliche Strategien und Topoi der Neuzeit 23 1. »Atheismus«: Neue Kontroversen und neue Geschichten 23 1.1. Polemik und Enzyklopädie in der Frühen Neuzeit 25 1.2. Historische Forschungen des 19. Jahrhunderts 55 2. Experimente mit den Begriffen Atheismus und Unglauben in der historischen Forschung des 20. Jahrhunderts 64 2.1. »Geschichte des Atheismus und der Aufklärung«: Die Großprojekte des 20. Jahrhunderts 64 2.2. Themen und Tendenzen der Philosophiegeschichte der Nachkriegszeit 77 2.3. Geschichtswissenschaftliche Positionen: Einheit des Mittelalters und Zeitalter des Glaubens? 85 2.4. Atheismus, Unglauben – Skepsis, Zweifel: Aktuelle Termini der Forschung 92 3. Zwischenergebnis 97 Kapitel II: Zur Ahnengalerie der Atheismus- und Aufklärungsgeschichte 101 1. Gottlose Herrschaft 106 1.1. Der Graf Jean von Soissons und die Inkarnation 106 1.2. Kaiser Friedrich II. und die Offenbarung 123 1.3. Der englische Bauernaufstand von 1381 und die Suche nach Ursachen 152 1.4. Kaiserin Barbara von Cilli (+1451) und die Epikureer 163 2. Gelehrte Ungläubige 180 2.1. Thomas Scotus, der Averroismus und der Satz von den drei Betrügern 180 2.2. Polemik gegen Atheisten in Gottesbeweisen? 212 3. Auch das Volk kann denken: Aude glaubt nicht an die Transsubstantiation 230 4. Zwischenergebnis 254 Kapitel III: Auf der Suche nach Konzeptionen des Zweifelns und der Verneinung Gottes 257 1. Semantische Beobachtungen zu »Unglauben« 257 1.1. Biblische Termini 260 1.2. Zum Gebrauch von infidelitas und infidelis im Mittelalter 267 1.3. Zu »Unglauben« im Deutschen 286 1.4. Ergebnis: »Ungläubig« ist nicht ungläubig – gegen die historische Operationalisierung von »Unglauben« 293 2. Semantische Beobachtungen zu »Zweifel« im Mittellateinischen und Mittelhochdeutschen 296 3. Zur Diskriminationsthese 309 3.1. Rechtliche Normen 311 3.2. Dubius in fide infidelis est: Die Verketzerung des Zweifels? 323 3.3. Abwesenheit von Glauben in Inquisitorenhandbüchern 330 3.4. Gegenprobe: Das Collyrium fidei von Alvaro Pelayo 362 3.5. Ergebnis 366 4. An den Grenzen des Glaubens und darüber hinaus 369 4.1. Acedia 369 4.2. »Anfechtung« und »Blasphemie des Herzens«: Zweifelnde Einfälle 378 4.3. »Murmur« und »Impatientia«: Protest und Theodizee 412 4.4. Non est Deus: Sagen, dass es Gott nicht gibt 432 Schluss 449 Verzeichnisse 469 Abbildungen 469 Abkürzungen 469 Handschriften 470 Quellen und Literatur 471 Vor 1800 entstandene Texte 471 Nach 1800 entstandene Texte 493 Dank 567 Personenregister 569 Ortsregister 577 |
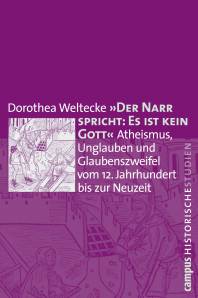
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen