|
|
|
Umschlagtext
»Ein abgeklärtes, furioses Sachbuch über politische und religiöse Ideen, wie sie zueinander passen oder wie und warum sie dies gerade nicht tun.« Antonia S. Byatt, The Guardian
John Gray, einer der wichtigsten lebenden Philosophen, legt mit »Politik der Apokalypse« ein großes Werk über die Politik des 20. und 21. Jahrhunderts vor: Eine erschütternde Bestandsaufnahme religiöser Grundideen in den Ideologien unsere Zeitalters und ein kluges Plädoyer für eine moderne und pragmatische Politik. Ein Buch wie eine Offenbarung! »Das überwältigendste Buch des Jahres, höchst beunruhigend, glasklar argumentierend, verblüffend feinmaschig geschrieben, wunderbar brillant.« John Banville »Ein abgeklärtes, furioses Sachbuch über politische und religiöse Ideen, wie sie zueinander passen oder wie und warum sie dies gerade nicht tun.« Antonia S. Byatt, The Guardian John Gray, einer der wichtigsten lebenden Philosophen, legt mit »Politik der Apokalypse« ein großes Werk über die Politik des 20. und 21. Jahrhunderts vor: Eine erschütternde Bestandsaufnahme religiöser Grundideen in den Ideologien unsere Zeitalters und ein kluges Plädoyer für eine moderne und pragmatische Politik. Ein Buch wie eine Offenbarung! »Das überwältigendste Buch des Jahres, höchst beunruhigend, glasklar argumentierend, verblüffend feinmaschig geschrieben, wunderbar brillant.« John Banville Die Politik des 20. Jahrhunderts ist ein Kapitel der Religionsgeschichte. Mit dieser Einsicht leitet John Gray seinen Abriss moderner politischer Ideen von der Antike bis in die Gegenwart ein. Furios und in verblüffender Evidenz stellt Gray dar, wie sehr sich islamische oder christliche Fundamentalisten und neoliberale Turbokapitalisten, die Jakobiner im Frankreich des späten 18. Jahrhunderts, die Nationalsozialisten und die US-amerikanische Bush-Regierung ähneln. Die von Utopien geschundene Welt lässt sich im 21. Jahrhundert nur noch durch eine globale Realpolitik vor dem Untergang bewahren. Rezension
Der Autor versteht die Politik der Moderne als in Kapitel der Religionsgeschichte. Begründung: Kommunismus und Nationalsozialismus waren säkularisierte religiöse Utopien. Die Welt am Beginn des 21. Jhdt. arbeitet sich noch an den Trümmern utopischer Projekte ab, die zwar säkular auftraten und sich religiösen Vorstellungen widersetzten, in Wahrheit aber von religiösen Mythen getragen waren. Und selbst die neokonservativen Theorien ordnet der Autor hier ein; der Glaube, die ganze Welt münde eines Tages ein in eine universelle Demokratie und einen freien globalen Markt bietet lediglich die neueste Spielart der bekannten utopisch-apokalyptischen Anschauungen; auch dies eine säkularisierte Spielart religiöser Überzeugungen. Und mit dem Tod der Utopien hat zugleich das naive apokalyptisch-religiöse Denken neuen Auftrieb erhalten, wird unverhüllt und ohne säkulare Tarnung zum bestimmenden Faktor der Weltpolitik, - insofern sind sich George W. Bush und Mahmud Ahmadinedschad unvermutet einig.
Dieter Bach, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
John Gray, einer der wichtigsten lebenden Philosophen, legt mit "Politik der Apokalypse" ein großes Werk über die Politik des 20. und 21. Jahrhunderts vor: Eine erschütternde Bestandsaufnahme religiöser Grundideen in den Ideologien unsere Zeitalters und ein kluges Plädoyer für eine moderne und pragmatische Politik. John Gray, geboren 1948, ist Professor für Europäische Ideengeschichte an der London School of Economics. Durch zahlreiche Sendungen für die BBC wurde er weltweit bekannt, wie auch als Autor herausragender Bücher gefeiert: »Die falsche Verheißung. Der globale Kapitalismus und seine Folgen« (1999); ferner der Weltbestseller »Straw Dogs. Thoughts on Humans and Other Animals« (2003), der bei Klett-Cotta erscheinen wird. Die Politik des 20. Jahrhunderts ist ein Kapitel der Religionsgeschichte. Mit dieser Einsicht leitet John Gray seinen Abriss moderner politischer Ideen von der Antike bis in die Gegenwart ein. Furios und in verblüffender Evidenz stellt Gray dar, wie sehr sich islamische oder christliche Fundamentalisten und neoliberale Turbokapitalisten, die Jakobiner im Frankreich des späten 18. Jahrhunderts, die Nationalsozialisten und die US-amerikanische Bush-Regierung ähneln. Die von Utopien geschundene Welt lässt sich im 21. Jahrhundert nur noch durch eine globale Realpolitik vor dem Untergang bewahren. Rezension"Ein abgeklärtes, furioses Sachbuch über politische und religiöse Ideen, wie sie zueinander passen oder wie und warum sie dies gerade nicht tun." (Antonia S. Byatt, The Guardian) Inhaltsverzeichnis
1 Der Tod der Utopie
Apokalyptische Politik Die Geburt der Utopie Die utopistische Rechte als millenarische Bewegung der Moderne 2 Aufklärung und Terror im 20. Jahrhundert Der Sowjetkommunismus: eine millenarische Revolution der Moderne Nationalsozialismus und Aufklärung Terror und westliche Tradition 3 Der Utopismus greift auf den politischen Mainstream über Margaret Thatcher und der Tod des Konservatismus Erscheinen und Verschwinden des Neoliberalismus Ein amerikanischer Neokonservativer in Downing Street Number 10 4 Die Amerikanisierung der Apokalypse Von der Puritaner-Kolonie zur Erlöser-Nation Die Ursprünge des Neokonservatismus "Die Dämonen" 5 Bewaffnete Missionare Der Irak: ein utopistisches Experiment im 21 . Jahrhundert Missionarischer Liberalismus, liberaler Imperialismus Warum der "Krieg gegen den Terror" nicht zu gewinnen ist 6 Post-Apokalypse Nach dem Säkularismus Die Unübersichtlichkeit der Welt: Die verlorene Tradition des Realismus Das Ende, mal wieder Anmerkungen Dank Register LESEPROBE 1 DER TOD DER UTOPIE Die Politik der Moderne ist ein Kapitel der Religionsgeschichte. Die großen revolutionären Umbrüche, welche die vergangenen zwei Jahrhunderte entscheidend prägten, waren Episoden der Glaubensgeschichte – Wegmarken, die den nicht enden wollenden Zerfall des Christentums und den Aufstieg politischer Religionen anzeigen. Unsere Welt am Beginn des neuen Jahrtausends ist übersät mit den Trümmern utopischer Projekte, die zwar säkular auftraten und sich religiösen Vorstellungen widersetzten, in Wirklichkeit aber von religiösen Mythen getragen waren. Kommunismus wie Nationalsozialismus beanspruchten, auf wissenschaftlichen Erkenntnissen zu beruhen – im Fall des Kommunismus auf der Pseudowissenschaft des historischen Materialismus, im Fall des Nationalsozialismus auf dem Sammelsurium einer »wissenschaftlichen Rassenlehre«. Die Verwendung pseudowissenschaftlicher Begründungen fand aber mit dem Zusammenbruch des Totalitarismus, der im Dezember 1991 im Zerfall der Sowjetunion gipfelte, keineswegs ein Ende. Neokonservative Theorien setzen sie fort. Denn folgt man ihnen, so mündet die Entwicklung der gesamten Welt in ein und dieselbe Regierungsform und in ein und dieselbe Wirtschaftsordnung – eine universelle Demokratie und einen globalen freien Markt. Dieser Glaube, die Menschheit stünde an der Schwelle einer neuen Ära, kommt sozialwissenschaftlich daher, ist aber einfach nur die neueste Spielart apokalyptischer Anschauungen, die bis in die Antike zurückreichen. Jesus und seine Jünger glaubten, sie lebten in einer Endzeit und alles Leid und Elend ihrer Welt werde bald vorübergehen. Krankheit und Tod, Entbehrung und Hunger, Krieg und Unterdrückung werde es nicht mehr geben, nachdem die Mächte des Bösen in einer welterschütternden Schlacht endgültig vernichtet seien. Dieser Glaube beseelte die ersten Christen. Spätere christliche Denker deuteten die Endzeit zwar in ein Gleichnis für einen inneren Wandel um, doch seit jenen Anfängen ist die Vorstellungswelt des Abendlands eine apokalyptisch-visionäre. Im Mittelalter kamen in Europa Massenbewegungen auf, die von der Überzeugung erfüllt waren, das Ende der Geschichte und die Geburt einer neuen Welt stünden unmittelbar bevor. Die neue Welt, so glaubten diese Christen, konnte einzig und allein Gott bewirken. Als das Christentum an Einfluss verlor, verblasste die Vorstellung einer bevorstehenden Endzeit keineswegs. Vielmehr verstärkte sich diese Hoffnung sogar noch und gewann an Militanz. Die Revolutionäre der Neuzeit wie die französischen Jakobiner und die russischen Bolschewiken verabscheuten die traditionelle Religion. Ihre Überzeugung jedoch, sie könnten in einer allumfassenden Umwälzung des menschlichen Lebens die Verbrechen und Torheiten der Vergangenheit hinter sich lassen, war eine säkulare Neuauflage frühchristlicher Ideen. Diese Revolutionäre waren radikale Aufklärer und wollten eine wissenschaftliche Weltsicht an Stelle der Religion inthronisieren. Doch ihr Glaube, ein plötzlicher Umschwung in der Geschichte des Menschen sei möglich, der die Fehler der Gesellschaft für alle Zeiten beheben werde, wurzelt im apokalyptischen Christentum. Die aufklärerischen Ideologien der vergangenen Jahrhunderte bestanden zu einem sehr großen Teil aus einer verfremdeten, ins Gegenteil verkehrten Theologie. Deshalb führt das Bild eines rein säkular geprägten Fortschritts, das linientreue Vertreter der Rechten wie der Linken gern von ›ihrem‹ 20 . Jahrhundert zeichnen, in die Irre. Die Machtergreifung der Bolschewiken oder der Nationalsozialisten gründete ebenso in einem Glaubenssystem wie die theokratische Revolution des Ayatollah Khomeini im Iran. Allein schon die Vorstellung von der Revolution als einem Ereignis, das den Lauf der Geschichte verändert, ist im Kern religiös. Moderne Revolutionen und revolutionäre Bewegungen sind Fortsetzungen der Religion mit anderen Mitteln. Säkularisierte Spielarten religiöser Überzeugungen finden sich nicht nur bei Revolutionären, sondern auch bei liberal denkenden Humanisten. Sie nehmen an, die Menschheit entwickle sich in einem mühsamen Prozess Schritt für Schritt weiter. Der Glaube an ein bevorstehendes Weltende und der Glaube an einen langsamen, stufenweisen Fortschritt scheinen auf den ersten Blick unvereinbare Gegensätze zu sein. Erwarten die einen die Vernichtung der Welt, so erwarten die anderen einen Wandel voller Verheißungen, aber im Grunde weichen sie gar nicht so weit voneinander ab. Fortschrittstheorien haben mit Wissenschaft nichts zu tun, ob sie nun einen allmählichen Wandel oder einen revolutionären Umbruch vorhersagen. Sie sind Mythen und kommen dem menschlichen Sinnbedürfnis entgegen. Die politische Sphäre hat sich seit der Französischen Revolution durch eine Reihe utopistischer Bewegungen von Grund auf verändert. Ganze Gesellschaftssysteme wurden ausgelöscht. Die Welt ist eine völlig andere als zuvor. Die wundersamen Verwandlungen, die utopistische Denker sich ausgemalt hatten, sind freilich ausgeblieben. Wenn man ihre Ideen zu verwirklichen versuchte, kam meist das Gegenteil dessen heraus, was ursprünglich angestrebt war. Dennoch wurden immer wieder utopistische Projekte in Angriff genommen, bis in unser 21 . Jahrhundert hinein, in dem der mächtigste Staat der Welt einen Feldzug startete, um die Demokratie in den Nahen und Mittleren Osten und in die ganze Welt zu exportieren. Utopistische Projekte dieser Art spiegeln religiöse Mythen wider, an denen sich Massenbewegungen des Mittelalters berauschten, und entfesseln eine ähnliche Art von Gewalt. Der säkulare Terror der Moderne ist eine Abart der Gewalt, von der das Christentum in seiner gesamten Geschichte durchdrungen ist. Der frühchristliche Glaube, das von Gott herbeigeführte Ende der Zeiten stehe bevor, nahm über 200 Jahre lang die Gestalt der Überzeugung an, der Mensch könne Utopien durch sein Handeln Wirklichkeit werden lassen. Frühchristliche Apokalyptik, nun aber wissenschaftlich verbrämt, ließ eine neue, im Glauben gründende Form der Gewalt entstehen. Als das Projekt einer universellen Demokratie auf den Straßen des Irak im Blutbad scheiterte, begann sich das ideologische Muster zu verschieben. Das utopistische Denken hat zwar eine schwere Niederlage erlitten, doch Politik und Krieg dienen nach wie vor als Instrumente, mit denen man mythische Vorstellungen durchzusetzen versucht. An die Stelle der säkular geprägten Überzeugungen, mit denen man Schiffbruch erlitten hat, treten heute primitive Formen der Religion. Das politische Handeln des US -amerikanischen Präsidenten George W. Bush und seines iranischen Gegenspielers Mahmud Ahmadinedschad ist religiös-apokalyptisch geprägt. Das Wiedererstarken der Religion hängt, ganz gleich, wo es stattfindet, auch mit politischen Konflikten zusammen, etwa mit den sich verschärfenden Auseinandersetzungen um schrumpfende natürliche Ressourcen. Es kann aber keinen Zweifel geben, dass auch die Religion als solche wieder erstarkt ist und eine eigene Macht darstellt. Mit dem Tod der Utopien hat das apokalyptische religiöse Denken neuen Auftrieb gewonnen und ist, unverhüllt und ohne säkulare Tarnung, zu einem bestimmenden Faktor der Weltpolitik geworden. [...] Das Ende, mal wieder [...] Es ist an der Zeit, den Wert religiöser Vielfalt anzuerkennen und von dem Versuch abzulassen, eine monolithische säkulare Weltgesellschaft zu errichten. Wir befinden uns zwar in einer postsäkularen Ära, doch ist dies kein Freibrief für Religionen, sich über die Beschränkungen hinwegzusetzen, die für ein zivilisiertes Zusammenleben unerlässlich sind. Strukturen zu schaffen und durchzusetzen, in denen Religionen friedlich koexistieren können, gehört zu den zentralen Aufgaben einer Regierung. Derartige Rahmenbedingungen können nicht in jeder Gesellschaft gleich aussehen oder für alle Zeiten festgelegt werden. Sie verkörpern eine Toleranz, deren Ziel nicht Wahrheit, sondern Wahrung des Friedens ist. Wer bei aller Toleranz letztlich doch auf Wahrheit aus ist, der träumt von einem Zustand gesellschaftlicher Harmonie. Wir sollten besser akzeptieren, dass solche Harmonie niemals zu erreichen ist, und die Mannigfaltigkeit menschlicher Erfahrungen willkommen heißen. Dann wird der modus vivendi , zu dem verschiedene Religionen in der Vergangenheit immer wieder fanden, vielleicht zu neuem Leben erwachen.20 Das wesentliche geistige Hindernis, das der Koexistenz der Religionen im Wege steht, ist nicht etwa ein Mangel an gegenseitigem Verständnis, sondern ein Mangel an Selbsterkenntnis. Matthew Arnold spricht in seinem einst berühmten Gedicht »Dover Beach« ( 1867 ) von der »See des Glaubens« und ihrem »traurig Dröhnen, das im langen Schwund zurück sich zieht« 21 – so als stehe das Ende des Christentums und aller Religion bevor. Der viktorianische Dichter unterschätzte, wie sehr wir Mythen brauchen. Die Utopien der letzten zwei Jahrhunderte waren deformierte Varianten der Mythen, deren Gültigkeit sie bestritten. Falls die letzte dieser Utopien in den Wüsten des Irak verendet sein sollte, müssen wir ihr nicht nachtrauern. Ihr Untergang wäre ein Segen für die Welt, denn utopische Hoffnungen haben einen weit höheren Blutzoll gefordert als die Glaubenskriege der Vergangenheit. Allerdings birgt der Tod säkularer Hoffnungen die Gefahr, dass es zu einer Neubelebung jener Glaubenskriege in ähnlicher Form kommt. Wir beobachten eine Renaissance apokalyptischer Vorstellungen, die wahrscheinlich nicht auf vertraute Formen des Fundamentalismus beschränkt bleiben wird. Neben evangelikalen Erweckungsbewegungen wird es bald wohl auch eine Fülle von Modereligionen geben, in denen sich Naturwissenschaft und Science-Fiction, Beutelschneiderei und Psychogeschwätz vermischen und die sich so rasant ausbreiten werden wie Computerviren. Die meisten werden harmlos sein, doch wenn die ökologische Krise sich verschärft, dürften auch Endzeitkulte wie jene, die zum Massenselbstmord in Jonestown oder den Anschlägen in der Tokioter U-Bahn führten, großen Zulauf finden. Die Mehrheit der Wissenschaftler ist sich einig, dass die Lebensbedingungen auf der Erde bald sehr anders sein werden als die, die seit Jahrmillionen und jedenfalls seit es Menschen gibt, auf ihr herrschten. Auf den ersten Blick ist dies ein wahrhaft apokalyptisches Szenario: Die Menschen sterben wohl nicht aus, doch die Welt, aus der sie hervorgegangen sind, geht unter. Wenn man aber genauer hinschaut, hat diese Prognose gar nichts Apokalyptisches an sich. Denn wenn wir heute das planetare Ökosystem zugrunde richten, wiederholen wir nur das, was Menschen schon unzählige Male im regionalen Maßstab getan haben. Außerdem ähnelt die derzeitige Aufheizung der Erde den Fieberschüben, die die Erde im Laufe ihrer Geschichte immer wieder erlebt und überstanden hat. Diesmal haben wir Menschen den Schub ausgelöst, sind aber außerstande, ihn aufzuhalten. Dies mag für uns und andere Lebewesen eine Katastrophe bedeuten, ist für den Planeten aber in gewisser Weise normal. Zu vermuten ist, dass diese Tatsachen die meisten Menschen psychisch überfordern werden. Wenn der Klimawandel fortschreitet, ist deshalb eine Welle von Kulten zu erwarten, die das Geschehen mit Hilfe ihrer Erzählungen von Unheil und Erlösung zu deuten versuchen. Schließlich ist die Apokalypse ja ein anthropozentrischer Mythos. Glücklicherweise kennt die Menschheit auch andere Mythen, die ihr helfen können, die eigene Situation klarer zu sehen. Im Buch Genesis werden die Menschen aus dem Paradies vertrieben, nachdem sie vom Baum der Erkenntnis gegessen haben, und müssen fortan von ihrer Hände Arbeit leben. Hier ist nirgends die Rede davon, dass es je eine Rückkehr in einen Zustand der einstigen Unschuld geben wird. Sobald wir von der Frucht der Erkenntnis gekostet haben, gibt es kein Zurück mehr. Dieselbe Wahrheit findet sich im griechischen Mythos von Prometheus und in den Erzählungen vieler anderer Kulturen. Diese Legenden aus der Vorzeit haben uns über unsere Gegenwart mehr zu sagen als moderne Fortschrittsmythen und Utopien. Der Mythos vom Weltende hat namenloses Leid über die Menschheit gebracht und ist gefährlich wie eh und je. Die Politik wurde zum Experimentierfeld von Weltverbesserungsprojekten. Die säkularen Religionen der letzten beiden Jahrhunderte, die das Ende des Kreislaufs von Anarchie und Tyrannei prophezeiten, haben ihn nur mit noch größerer Gewaltsamkeit aufgeladen. Die Politik eignet sich nicht zum Vehikel der Menschheitsbeglückung. Im besten Fall ist sie die Kunst, in angemessener Weise auf den Fluss der Ereignisse zu reagieren. Dazu ist keine hochfl iegende Fortschrittsvision notwendig, sondern nur der Mut, unausrottbaren Übeln ins Auge zu sehen. Ein Übel dieser Art ist der diffuse Kriegszustand, in den wir hineingestolpert sind. Die Moderne ist nicht weniger abergläubisch als das Mittelalter – und in mancher Hinsicht sogar abergläubischer. Auf das Jenseits ausgerichtete Religionen sind mit vielen Problemen behaftet; vor allem das Christentum war Nährboden für barbarische Gewaltausbrüche. Im günstigen Fall aber lehrt die Religion uns, mit dem Geheimnis zu leben, anstatt uns die Hoffnung einzupflanzen, dass das Geheimnis irgendwann enthüllt wird. Diese der Zivilisation zuträgliche Perspektive ist im Kampf der Fundamentalismen untergegangen. Die heutigen Kriege werden mit ähnlicher Erbitterung geführt wie die der Frühmoderne, während das zerstörerische Potenzial unseres Wissens seitdem enorm gewachsen ist. Das Gewaltpotenzial des Glaubens wird, im Zusammenspiel mit den Auseinandersetzungen um Rohstoffe, unser Jahrhundert aller Voraussicht nach entscheidend prägen. [...] |
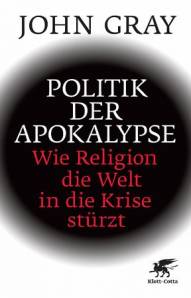
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen