|
|
|
Rezension
Das Thema dieser Darstellung könnte zunächst einmal als lediglich von (kirchen-)historischem Interesse erachtet werden. Das wäre aber zu eng gesehen; denn hinter der Thematik erscheinen exemplarisch drei Problemfelder, die auch heute von elementarer Bedeutung sind: 1) (religiöse) Toleranz, 2) Interkonfessionelle bzw. interreligiöse Dialoge, 3) Der Umgang mit (religiöser) Heterogenität und Machtentscheidungen und Gewalt. - Das erste Regensburger Religionsgespräch von 1541 fand im Zuge des Regensburger Reichstages statt und sollte ein friedliches Mittel zur Einigung von Altgläubigen (Katholiken) und Protestanten sein. Es wurde von Kaiser Karl V. einberufen, der angesichts der drohenden Türkengefahr nicht auf die militärische Unterstützung der protestantischen Fürsten verzichten konnte. Das zweite Regensburger Religionsgespräch von 1546 fand jedoch unter gänzlich veränderten äußeren Bedingungen statt: a) Karl V., dessen Machtstellung im Reich sich durch den Frieden mit Frankreich und einen vorläufigen Waffenstillstand mit den Türken entscheidend verbessert hatte, bereitete insgeheim den Schmalkaldischen Krieg vor, in dem er die Reformation im Reich gewaltsam besiegen wollte. b) 1545 berief der Papst das anti-reformatorische Konziel von Trient ein. c) Am 18. Febr. 1546 starb mit Luther der Kopf der evangelischen Bewegung. - Das Regensburger Religionsgespräch von 1546 kann insofern als ein Ablenkungsmanöver des Kaisers gedeutet werden, das die evangelischen Reichsstände von seinen Kriegsvorbereitungen zur Niederschlagung der Reformation ablenken sollte, zumal das zwischen Katholiken und Protestanten strittige Thema der Rechtfertigungslehre bereits in mehreren Religionsgesprächen ergebnislos diskutiert worden, so dass der Kaiser davon ausgehen konnte, dass es auch diesmal nicht zu einem Konsens kommen würde. - Dieser Band leuchtet das zweite Regensburger Religionsgespräch von 1546 von den Quellen her neu aus und überprüft damit auch kritisch die oben aufgestellten Thesen.
Thomas Bernhard, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Reihe: Quellen und Forschungen zur Reformationsgeschichte Im Auftrag des Vereins für Reformationsgeschichte Das zweite Regensburger Religionsgespräch von 1546 war ein weiterer Versuch, die alte concordia des Reiches wieder herzustellen, und bestätigte doch nur das Gegenteil: den fundamentalen religiösen Dissens. So galt es, daraus Modelle des Zusammenlebens zu entwickeln, die diesen Dissens ertrugen. Die europäische Geschichte der Toleranz hat hier eine Wurzel. In einer Zeit, in der religiöse und weltanschauliche Pluralität immer mehr zur Alltagserfahrung wird, bieten darum diese Vorgänge rund um diesen letzten Verständigungsversuch vor dem Schmalkaldischen Krieg gerade heute Anstöße zur Reflexion. Inhaltsverzeichnis
Einleitung 11
1. Ein politischer Ort für theologische Debatte: die Religionsgespräche der 40er Jahre 15 1.1 Die Erforschung der Religionsgespräche 16 1.2 Religionsgespräche und Politik: einige ergänzende Beobachtungen 24 1.3 Die Rolle der Rechtfertigungslehre auf den Religionsgesprächen 33 2. Die Einschätzung religionspolitischer Spielräume im Vorfeld des Wormser Reichstags von 1545 41 2.1 Der Kaiserhof 41 2.1.1 Die Grunddaten der kaiserlichen Religionspolitik 41 2.1.2 Quellen aus dem Vorfeld des Wormser Reichstags 45 2.1.3 Die Frage nach der Datierung des kaiserlichen Kriegsentschlusses 49 2.2 Die altgläubigen Reichsstände 64 2.2.1 Intransigent-altgläubige Reichsstände 64 2.2.2 Die »Mittelpartei« 72 2.3 Die protestantischen Reichsstände 78 2.3.1 Religionspolitische Grundpositionen 78 2.3.2 Die protestantischen Reformationsgutachten 84 a) Das Augsburger Reformationsgutachten 85 b) Die hessischen Gutachten 87 c) Das Gutachten der Frankfurter Theologen 92 d) Das Gutachten der Tübinger Theologen 96 e) Der Reformationsentwurf Martin Bucers 97 f) Kursachsen und der Wittenberger Reformationsentwurf 108 g) Die Ausarbeitung eines gemeinsamen Reformationsentwurfs 117 h) Rückblick 123 2.3 Zusammenfassung 125 3. Der Wormser Reichstag von 1544/45 127 3.1 Religionspolitische Verhandlungen bis zur Ankunft des Kaisers am 16. Mai 1545 127 3.2 Religionspolitische Verhandlungen von der Ankunft des Kaisers bis zum Beginn der Vermittlung Pfalzgraf Friedrichs II. von der Pfalz 141 3.3 Die Vermittlung Friedrichs II. von der Pfalz und die Entscheidung für das Religionsgespräch 152 3.3.1 Der Beginn der Vermittlung 152 3.3.2 Die Vorlage des Kolloquiumsvorschlags durch den Pfalzgrafen und die Reaktionen 156 3.3.3 Verhandlungen über den Kolloquiumsartikel in der Reichstagsprorogation 176 3.4 Das Kolloquium in der Prorogation des Wormser Reichstags 186 3.5 Ausblick 192 4. Das Vor- und Umfeld des Kolloquiums (Herbst 1545 und Winter 1545/46) 195 4.1 Die weitere politische Entwicklung 195 4.1.1 Der Kaiser, das Konzil und die europäischen Potentaten 195 4.1.2 Die Entwicklung innerhalb des Reichs 200 4.1.3 Ansätze zu einer alternativen Lösung der Religionsfrage zwischen Trienter Konzil und Krieg 215 4.2 Die Berufung der protestantischen Teilnehmer 220 4.2.1 Vorbemerkung zur Forschungsgeschichte 220 4.2.2 Die Auswahl der Teilnehmer vom Wormser Reichstag bis zum Gespräch 223 4.3 Die Berufung der altgläubigen Teilnehmer 247 4.4 Zusammenfassung 267 5. Der Verlauf des Religionsgesprächs 269 5.1 Vorbemerkung zur Quellenlage 269 5.1.1 Archivalische Quellen 269 5.1.2 Druckschriften 274 5.2 Abfertigung und Anreise der Teilnehmer 284 5.2.1 Die altgläubigen Teilnehmer und die Präsidenten 284 5.2.2 Die protestantischen Teilnehmer 292 5.2.3 Die Unterkünfte der Gesprächsteilnehmer 300 5.3 Aktivitäten im Vorfeld der Gesprächseröffnung 305 5.4 Die Eröffnung des Gesprächs 315 5.5 Verhandlungen über die Geschäftsordnung (27.1.-3.2.) 322 5.6 Die Eröffnung der theologischen Verhandlungen am 5. Februar 338 5.6.1 Präliminarien bei der Eröffnung der theologischen Debatte 338 5.6.2 Vorbemerkung zur Quellenlage 339 5.6.3 Die einleitende Protestation der altgläubigen Seite 34l 5.6.4 Die Proposition Malvendas zur Rechtfertigungslehre 342 5.7 Der Vortrag der Protestation der Augsburger Konfessionsverwandten (6. Februar) 355 5.8 Die Gegen-Proposition der Protestanten vom 9.-11. Februar 361 5.8.1 Die Eröffnung der Verhandlungen am 9. Februar 361 5.8.2 Protestantische Rechtfertigungslehre als Auslegung des vierten Artikels des Augsburger Bekenntnisses 363 5.8.3 Vergleich mit der von Malvenda vorgetragenen Proposition 368 5.8.4 Auseinandersetzung mit Malvendas Schriftbelegen 373 5.8.5 Die protestantischen axiomata zur Rechtfertigungslehre 375 5.8.6 Abschluss der protestantischen Gegen-Proposition 376 5.8.7 Korrespondenzen beider Seiten (27. Januar bis 14. Februar) 378 5.9 Die altgläubige Entgegnung (12.-17. Februar) 385 5.9.1 Die Replik auf die Protestation und Geschäftsordnungswünsche der Augsburger Konfessionsverwandten (12. Februar) 385 5.9.2 Die Replik zur Rechtfertigungslehre (13.-17. Februar) 389 5.10 Die protestantische Triplik (17.-23. Februar) 401 5.10.1 Stellungnahme zur Kritik an der Protestation und zur Geschäftsordnung (17./18. Februar) 401 5.10.2 Das familiäre colloquium (19.-22. Februar) 405 5.10.3 Bucers Vortrag vom 23. Februar 420 5.10.4 Korrespondenzen beider Seiten während der altgläubigen Replik und der protestantischen Triplik (12.-23. Februar) 421 5.10.5 Der Besuch des angeblichen Konzilsgesandten Melchior Flavius 428 5.11 Der Streit um die Geschäftsordnung nach Eintreffen der kaiserlichen Resolution 430 5.11.1 Die Eröffnung der kaiserlichen Resolution zur Geschäftsordnung (26. Februar) 430 5.11.2 Der weitere Verlauf der Geschäftsordnungsdiskussion 437 5.12 Die Abreise der Protestanten 448 5.12.1 Abreisen vor der Kolloquiumsauflösung 448 5.12.2 Protestantische Korrespondenzen zwischen Verhandlungsende und Abreise 448 5.12.3 Der Aufbruch aus Regensburg 459 5.12.4 Korrespondenzen nach Abbruch des Kolloquiums 472 6. Rückbezüge auf das zweite Regensburger Religionsgespräch bis zum Ausbruch des Schmalkaldischen Krieges 481 6.1 Die Verhandlungen zwischen Karl V. und Landgraf Philipp in Speyer (28.-29. März) 481 6.2 Die innerprotestantischen Verhandlungen über eine Rechtfertigung des Gesprächsabbruchs im Vorfeld des Regensburger Reichstags 491 6.3 Das Kolloquium in den Verhandlungen des Regensburger Reichstags 503 7. Rückblick 517 Quellenanhang 521 Abkürzungsverzeichnis 581 Verzeichnis der herangezogenen Archivalien 582 Quellen- und Literaturverzeichnis 585 Orts- und Personenregister 609 Weitere Titel aus der Reihe Quellen und Forschungen zur Reformationsgeschichte |
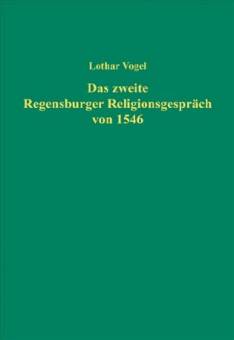
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen