|
|
|
Umschlagtext
Nominiert für den Deutschen Sachbuchpreis 2024
Ein Datum im Dienst der Politik Zum 20. Juli 1944 scheint alles gesagt. Wir wissen, wie Claus Schenk Graf von Stauffenberg die Bombe platzierte, warum der Anschlag misslang und dass es trotzdem aller Ehren wert ist. Dass aber in Wirklichkeit rund 200 Personen, ein breites Bündnis von Menschen aller sozialer Schichten und unterschiedlichster politischer Couleur am sogenannten »Stauffenberg-Attentat« beteiligt waren, ist nur wenigen bewusst. Noch heute gilt der 20. Juli 1944 als »Aufstand des Gewissens« einer kleinen Gruppe konservativer Militärs, noch heute verstellt diese legendenhafte Überhöhung unseren Blick auf die Ereignisse und die gesellschaftliche Vielfalt der Verschwörung. Die Journalistin Ruth Hoffmann unternimmt eine umfassende und längst überfällige Dekonstruktion des Mythos »Stauffenberg-Attentat« und zeichnet nach, wie der 20. Juli seit Gründung der Bundesrepublik politisch instrumentalisiert wird: mal um sich gegen die DDR abzusetzen und kommunistische Widerständler zu diffamieren; mal um Politikern, die mit dem NS-Regime kollaboriert hatten, eine Nähe zum Widerstand anzudichten; oder, wie neuerdings die AfD, um die eigene Demokratiefeindlichkeit mit einem angeblichen Widerstandsgeist in der Tradition Stauffenbergs zu kaschieren. Das deutsche Alibi ist der profund recherchierte Beitrag zu einem schicksalhaften Datum, in dem sich bis heute das schwierige Verhältnis zu unserer eigenen Geschichte spiegelt. Ruth Hoffmann, geboren 1973 in Hamburg, hat Ethnologie, Neuere Geschichte und Politik studiert und ist Absolventin der Henri Nannen-Journalistenschule. Von 2004 bis 2006 war sie Redakteurin beim Stern, seitdem arbeitet sie als freie Journalistin für verschiedene Medien, u.a. Geo, Stern, P.M. History, und Spiegel Geschichte. Sie ist Mitbegründerin des Journalistenverbunds Plan 17 und von :Freischreiber, dem Berufsverband freier Journalistinnen und Journalisten. 2012 erschien ihr Buch Stasi-Kinder. Aufwachsen im Überwachungsstaat über die Kinder hauptamtlicher Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR. Sie lebt mit ihrer Familie in Hamburg. www.ruth-hoffmann.de Rezension
Das ehrende Erinnern an den 1907 in Stuttgart geborenen Claus Schenk Graf von Stauffenberg und den militärischen Widerstand gegen die nationalsozialistische Gewalt- und Unrechtsherrschaft mit dem Attentat auf Hitler vom 20. Juli 1944 bildet einen Kernbestand im Selbstverständnis der zweiten deutschen Demokratie und ihrer seit den 1950er Jahren geschaffenen Streitkräfte, die u.a. mit der Graf Stauffenberg-Kaserne in Sigmaringen den Widerständler aus dem Südwesten ehrt. Aber: Es bedarf der längst überfälligen Dekonstruktion des Mythos »Stauffenberg-Attentat« durch dises Buch; denn der 20. Juli wird seit Gründung der Bundesrepublik permanent politisch instrumentalisiert: mal um sich gegen die DDR abzusetzen und kommunistische Widerständler zu diffamieren; mal um Politikern, die mit dem NS-Regime kollaboriert hatten, eine Nähe zum Widerstand anzudichten; oder, wie neuerdings die AfD, um die eigene Demokratiefeindlichkeit mit einem angeblichen Widerstandsgeist in der Tradition Stauffenbergs zu kaschieren. Im Stauffenberg-Attentat spiegelt sich als Alibi bis heute das schwierige Verhältnis zu unserer eigenen Geschichte - so die Grundthese der Autorin. Nach dem Krieg sollte es viele Jahre dauern, bis die Verschwörer nicht mehr als »Landesverräter« galten. Schon daran lässt sich ablesen, wie gering ihr Rückhalt in der Bevölkerung gewesen war. Neuesten Forschungen zufolge waren rund zweihundert Personen an der Planung des Umsturzversuchs beteiligt. Der 20. Juli 1944 war immer ein schwieriges Datum und ein Stachel im Fleisch deutscher Selbstgewissheit – weil er das Märchen vom verführten Volk entlarvte, das von nichts gewusst habe, und weil er zeigte, dass es möglich gewesen wäre, sich anders zu verhalten. Das wollten sich nur die allerwenigsten eingestehen, als Alibi aber durften die Widerständler gern herhalten. Die zunehmende Heroisierung der »Männer des 20. Juli 1944« – Bundespräsident Theodor Heuss nannte sie 1954 den »christlichen Adel deutscher Nation« – ging darum mit der Abwertung des linken Widerstands und der Diffamierung von Emigranten wie Willy Brandt einher. Und trotz fundamentaler Veränderungen im Außen war die »Stunde Null« kein radikaler Neuanfang im Innern. Die ersten Gesetze, die der eben konstituierte Deutsche Bundestag verabschiedete, waren bezeichnenderweise Amnestien für ehemalige Nationalsozialisten. Nicht die Täter waren in der Defensive, sondern die Opfer. Im Umgang mit dem 20. Juli spiegeln sich so über die Jahrzehnte die politischen Interessenlagen und gesellschaftlichen Bedingungen, aber auch das sich wandelnde Verhältnis zu unserer Vergangenheit. Es ist kein Buch über den Widerstand, sondern eines über die öffentliche Thematisierung der NS-Vergangenheit seit nunmehr fast acht Jahrzehnten. Hinter dem Titel "Das deutsche Alibi" steht die These, dass das Gedenken an den Widerstand, über Jahrzehnte hinweg dem Zweck diente, das Bild eines besseren Deutschlands zu zeigen, das es zwischen 1933 und 1945 auch gegeben habe.
Oliver Neumann, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
»Ruth Hoffmann überführt so ziemlich das gesamte politische Personal der (west)deutschen Republik der verzerrenden und stets von Interessen geleiteten Haltung zu diesem Datum.« stern (02. Mai 2024) »Ausgezeichnet recherchiert [...], lehrreich [...] exzellent geschrieben« Tagesspiegel (07. Mai 2024) »Beste Sachbuchlektüre!« Deutschlandfunk Kultur (18. Juni 2024) »Hervorragend« Münchner Merkur (25. April 2024) Inhaltsverzeichnis
Einleitung 9
1. Friede mit den Tätern (1945–1952) Das große Verdrängen 15 2. Kalter Krieg um das Gedenken (1953–1959) Die Grenze in den Köpfen 55 3. Vergessene Anfänge (1933–1938) Die Nation im Taumel, die Gegner im KZ 89 4. Das gescheiterte Wunder (1939–1944) Der lange Weg zum 20. Juli 1944 125 5. Erinnerungskampf (1960–1969) Das Ende der Seelenruhe 177 6. Aufbruch (1969–1979) Der Mut, Verantwortung zu übernehmen 209 7. Rolle rückwärts (1980–1989) Die entsorgte Vergangenheit 249 8. Wiedervereint, wieder getrennt (1989–1993) Die verpasste Chance 29 9. Kult der Gerechten (1994–1999) Der selbstgefällige Schlussstrich 325 10. Routiniertes Gedenken (2000 bis heute) Der geplünderte Mythos 361 Dank 397 Empfehlungen zum Weiterlesen 399 |
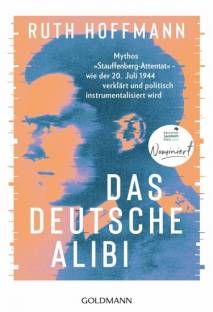
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen