|
|
|
Umschlagtext
In Auseinandersetzung mit Jon Sobrinos „Christologie aus der Perspektive der Opfer“ entwickelt die Autorin einen neuen, biblisch fundierten Ansatz für eine „Ethik für Christen“, in dessen Zentrum die praktische Solidarität der Gläubigen mit den Notleidenden steht – ein Ansatz, der angesichts der derzeitigen Probleme in der Welt von höchster Aktualität ist. Anders als universal-christliche Ethiken, die die Perspektive des Glaubens mit der einer „universalen Vernunft“ zu verbinden suchen, bietet eine Ethik aus der Perspektive der Armen und Notleidenden (mit einem dezidiert christlichen Vernunftbegriff) die Chance, auch säkular begründet und in den öffentlichen Diskurs eingebracht zu werden. Durch ein entsprechendes Zeugnis der Christen wird dann auch konkret sichtbar, was sie zur Lösung der großen sozialen, ökonomischen und politischen Probleme unserer Zeit leisten können.
Gudula Frieling, Dr. theol., geb. 1968, Gymnasiallehrerin, war von 2008 bis 2011 Wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Lehre am Institut für Katholische Theologie der TU Dortmund. Rezension
Kann universale Ethik (heute) überhaupt (noch) religiös begründet werden? Die meisten christlichen Ethiken versuchen das noch immer - nicht selten vergeblich ... Hier erweist sich diese Darstellung schon im Buchtitel erfreulich alternativ: Christliche Ethik ODER Ethik für Christen? (Titel) - Die Universalität christlicher Ethik auf dem Prüfstand (Untertitel). Der Verlust der Universalität kann dabei durch eine klar christlich positionierte Ethik (für Christen) kompensiert werden, nämlich aus der Perspektive der Armen und Notleidenden in deutlciher Solidarität mit ihnen im Sinne eines befreiungstheologischen Ansatzes nach Jon Sobrinos „Christologie aus der Perspektive der Opfer“. Dabei wird ein pointiert christliches Profil deutlich und gezeigt, was Christen zur Lösung der großen sozialen, ökonomischen und politischen Probleme unserer Zeit im Sinne einer klaren Option für die Armen und Benachteiligten leisten können.
Thomas Bernhard, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Schlagworte: Ethik Theologie Sach- und Fachbuch Befreiungstheologie Inhaltsverzeichnis
Danksagung 18
Bekenntnis 19 1 Einleitung 21 1.1 Wir nehmen uns, was wir können. Warum? 21 1.2 Erkenntnisleitendes Interesse 24 1.3 Problemaufriss, methodisches Vorgehen und Gliederung 26 1.4 Zur Auswahl der analysierten ethischen Entwürfe 29 1.5 Das universal Gute 34 1.5.1 Das Gute in der analytischen Philosophie 36 1.5.2 Das universal Gute als Streitpunkt der Ethik 37 1.5.2.1 Die Unterscheidung von Gut und Böse als Thema der Individual- und Sozialethik 37 1.5.2.2 Wie erfolgt die Tradierung des gesellschaftlichen Ethos? 39 1.5.2.3 Ethik als normative Wissenschaft 41 1.5.2.4 Das universal Gute als ethische Norm christlicher Ethik 43 1.6 Scheitern von Kopenhagen — Konsequenzen für eine christliche Ethik? 47 1.6.1 Sicht des Südens 48 1.6.2 Die Sicht des Nordens 54 1.6.3 Ein klimapolitischer Neuanfangs — Zum Klimaabkommen von Paris 59 1.7 Christliche Ethik der Nachhaltigkeit. Die Position der katholischen Kirche in Deutschland 65 1.7.1 Analyse des Expertentextes „Klimawandel — Brennpunkt globaler, intergenerationeller und ökologischer Gerechtigkeit" 66 1.7.2 Kritische Würdigung der Expertenschrift „Brennpunkt Klimawandel" 70 1.8 Zeithistorische Krisen als Chance für ein vertieftes Glaubensverständnis 73 1.8.1 Glaube und Erfahrung 73 1.8.2 Zum Konzept einer weitergehenden, an den Sinai gebundenen Offenbarung 75 1.9 Ökonomische Logik in kirchlichen und säkularen Positionen der Ersten Welt 75 2 Christliche Ethik — Universale Ethik in pluraler Zeit 81 2.1 Anselm Günthör: Allgemeine Moraltheologie (1992) — Römisch-katholische Ethik im thomistischen Horizont 81 2.1.1 Das Sittlich-Gute und die Wirklichkeit des dreifaltigen Gottes 81 2.1.2 Gott als das Ziel des menschlichen Lebens 84 2.1.2.1 Hierarchie der Werte — Der Mensch vor der Entscheidung für Gut oder Böse 86 2.1.2.2 Gotteserkenntnis als Mitte des Offenbarungsgeschehens 88 2.1.2.3 Gott: das metaphysische Fundament aller sittlichen Werte 90 2.1.3 Das Gesetz Christi als das umfassend eine Gute 92 2.1.3.1 Inhaltliche Einführung und Gliederung 92 2.1.3.2 Das Ewige Gesetz 94 2.1.3.3 Das Gesetz der Gnade: angekündigt durch die Propheten, verwirklicht in der Kirche 98 2.1.3.4 Das natürliche Sittengesetz als universale Norm 104 2.1.3.4.1 Naturrechtliche Bestimmungen 104 2.1.3.4.2 Zur Arbeitsweise der praktischen Vernunft: Die Deduktion von unwandelbaren Einzelnormen aus grundlegenden Prinzipien 104 2.1.3.4.3 Trübung der praktischen Vernunft durch die Sünde 106 2.1.4 Natürliche Gerechtigkeit — übernatürliche Gerechtigkeit: Verschiedene Ausdrücke für das eine Gute? 108 2.1.4.1 „Neues Sein" führt nur formal zu neuer sittlicher Einstellung 112 2.1.4.2 Natürliches und übernatürliches Gutsein: Einheit der Wirklichkeitsbereiche — Einheit des Guten 113 2.1.5 Unwandelbarkeit auch der Einzelnormen unter Berufung auf den ewigen Christus 114 2.1.6 Der Mensch zwischen innerer Beständigkeit und seiner Fähigkeit zum Guten und Bösen 116 2.1.7 Wandel in der Anwendung der in sich unwandelbaren sittlichen Normen 116 2.1.7.1 Beispiel Zinsverbot 116 2.1.7.2 Beispiel Krieg als Mittel der Friedenssicherung 123 2.1.7.3 Unzureichende Erkenntnis der an sich feststehenden Normen 129 2.1.7.4 Ursachen mangelnder Erkenntnis der an sich unwandelbaren sittlichen Werte und Normen 130 2.1.7.5 Unkenntnis sittlicher Werte und naturgesetzlicher Einzelnormen 132 2.1.7.6 Gehorsamspflicht der Gläubigen gegenüber der Kirche 133 2.1.7.7 Bekräftigung durch Offenbarung: Das positive göttliche Gesetz des Alten und Neuen Bundes 135 2.1.7.8 Überbietung der Liebe durch die Liebe. Zum Verständnis des Dekalogs 135 2.1.7.9 Bekräftigung des natürlichen Sittengesetzes durch die Offenbarung 136 2.1.7.9.1 Natürliches Sittengesetz als Norm 138 2.1.7.9.2 Die Bergpredigt: Personale Befreiung auf Gott hin 140 2.1.7.9.3 Die evangelischen Räte: das Gebotene oder das Angeratene? 143 2.1.8 Kritische Würdigung — Deontologische Normenbegründung auf dem Prüfstand 146 2.1.8.1 Naturrecht als vermittelnde Instanz 146 2.1.8.2 Die Vernunft und das Naturrecht als Maßstab 148 2.1.8.3 Naturrecht als maßgebliches Vorverständnis der Offenbarung 151 2.1.8.4 Vorkonziliares Wahrheitsverständnis 153 2.1.8.5 Naturrecht und Heilsegoismus 154 2.1.8.6 Zur Unvereinbarkeit von Naturrecht und jüdisch-christlichem Gottesverständnis 158 2.1.8.7 Stoisches Gottes- und Menschenbild 159 2.1.8.8 Vernunft und Anpassung als Leitmotive — Ein Resümee 160 2.2 Franz Böckle: Fundamentalmoral — Autonome Moral im thomistischen Horizont 162 2.2.1 Was ist das sittlich Gute? 162 2.2.2 Sind sittliche Normen im Alten Testament universelle Normen? 167 2.2.2.1 Verpflichtung auf an sich feststehende Normen als Ausdruck des alttestamentlichen Bundesverhältnisses 167 2.2.2.2 Theonome Durchformung des ursprünglichen Sippengesetzes 170 2.2.2.3 Erlassjahr - Beispiel einer gelungenen theonomen Durchformung des ursprünglichen Sittengesetzes 177 2.2.2.4 Propheten - Hauptträger des Offenbarungsfortschritts 181 2.2.2.4.1 Forensische Gerechtigkeit als Vorform der universellen, auf Liebe gründenden Gerechtigkeit 182 2.2.2.4.2 Exkurs in Form einer Gegenrede. Landbesitz - Kostbare unveräußerliche Leihgabe Gottes als Ausdruck göttlicher Gerechtigkeit 184 2.2.2.4.3 Anthropologische Weitung der prophetischen Botschaft unter den Schriftpropheten 185 2.2.2.4.4 Verinnerlichung des Bundesglaubens 188 2.2.2.5 Weisheit: Vertrauen in die Weltpräsenz Gottes 193 2.2.3 Die sittliche Botschaft Jesu Christi als Novum? 194 2.2.3.1 Die von Jesus verkündete Gottesherrschaft als Verwirklichung des allgemein Guten in dieser Welt? 199 2.2.3.2 Die Gesetzeskritik Jesu: Wegbegleitung zur Erkenntnis des gemeinsamen Begriffs des Guten? 201 2.2.3.3 Die „größere Gerechtigkeit" - kein ethischer Entwurf, sondern eine religiöse Wirklichkeit 206 2.2.3.4 Ist das Neue der Botschaft Jesu die Rückkehr zur „allzeit gültigen Ordnung" 210 2.2.4 Natürliches Sittengesetz als Weg zur Selbstbescheidung der Naturwissenschaft 211 2.2.5 Worin liegt der Beitrag der Kirche bei der Bestimmung des allgemein Guten? 214 2.2.5.1 Vernunft als Bindeglied zwischen scholastischer Ordnung und naturwissenschaftlicher Moderne 214 2.2.5.2 Heilsgeschichtliche Natur des Menschen 220 2.2.5.3 Heilsgeschichte als Prozess der vernünftigen Selbsterkenntnis des Menschen 226 2.2.6 Kritische Würdigung 227 2.2.6.1 Der Mensch im Zentrum 227 2.2.6.2 Heilsgeschichte und persönliche Erlösung 228 2.2.6.3 Die bedingungslose Heilszusage Jesu - ohne Folgen für ethisches Handeln? 231 2.2.6.4 Wie verhält sich die universal verstandene christliche Vernunftmoral zur jüdischen Ethik 233 2.2.6.5 Freiheit: Flexibilität und persönlich verantwortete theonome Autonomie 235 2.3 Stefan Ernst: Theologische Fundamentalethik — Universal-rationale Ethik in pluraler Zeit 237 2.3.1 Universeller Glauben und universale Ethik — eine notwendige Verbindung? 237 2.3.2 Allgemein gültige Normen als Gliederungskriterium der Fundamentalethik 242 2.3.3 Theoretische Grundlegung. Universalität ethischer Wertungen mit Hilfe des weiterführenden Ansatzes der Normbegründung 243 2.3.3.1 Notwendigkeit der Güterabwägung 243 2.3.3.2 Wie kann man ethisch gutes Handeln erkennen? 245 2.3.3.2.1 Unterscheidung und Zuordnung von ethischer und physischer Sphäre 245 2.3.3.2.2 Das Prinzip der Verhältnismäßigkeit der Mittel 246 2.3.3.2.3 Das Kriterium des entsprechenden Grundes 248 2.3.3.2.4 Entfaltung des Grundprinzips der ethischen Normenbegründung 252 2.3.4 Die Bedeutung des Glaubens für die Ethik 254 2.3.4.1 Willkür und Egoismus: Unterdrückte Freiheit 254 2.3.4.2 Kritik der autonomen Moral durch das Lehramt und der weiterführende Ansatz der Normbegründung 258 2.3.4.3 Vernunft als Gnade: Befreite Freiheit 259 2.3.5 Ernsts Umgang mit biblischer Ethik 265 2.3.5.1 Naturordnung als Ausdruck des göttlichen Willens 266 2.3.5.2 Schöpfungstheologische Einwände: Einseitige Abhängigkeit der Welt vom Schöpfergott 269 2.3.5.3 Erkenntnisfortschritt durch Offenbarung nur auf theologischem, nicht auf ethischem Gebiet 272 2.3.6 Konsequenz: Keine spezifisch inhaltliche Ausrichtung christlicher Ethik 274 2.3.6.1 Gebote — nicht selbst Offenbarung, aber unverzichtbarer Bezugspunkt der Offenbarung Jahwes: Beispiel Bundesbuch 275 2.3.6.1.1 Kasuistische Rechtssätze: Herkunft aus dem Sippengesetz 275 2.3.6.1.2 Apodiktische Grundrechte verstanden als Appelle an die Humanität 277 2.3.6.1.3 Integration rechtlicher und ethischer Gebote in den Kontext des israelischen Glaubens 282 2.3.6.2 Mangelnde Gotteserkenntnis: Ursache und untergründiges Thema prophetischer Sozialkritik 284 2.3.6.3 Die Bergpredigt: große Antithese gegen irdische Gottvergessenheit 286 2.3.6.3.1 Gewaltverzicht — eine unerfüllbare Forderung 286 2.3.6.3.2 Selbstloses Handeln allein um des Guten willen als Frucht des Glaubens 289 2.3.7 Glaube und verantwortete Spiritualität 291 2.3.8 Kritische Reflexion der universalen Ethik nach Stefan Ernst 295 2.3.8.1 Aporien ethischen Handelns im Rahmen einer universalen Ethik 295 2.3.8.1.1 Eigentum als universaler Wert und Selbsterhalt 295 2.3.8.1.2 Gewaltlosigkeit als universaler Wert und seine Sicherung durch Gewalt 296 2.3.8.1.3 Atomenergie: dauerhaft eine ethisch verantwortbare Form der Energiegewinnung 300 2.3.8.2 Der Glaube im Rahmen einer universalen Ethik 301 2.3.8.2.1 Offenbarungsverständnis und verschiedene Konsequenzen 301 2.3.8.2.2 Autonomie und Vernunft 303 2.3.8.2.3 Die Reich-Gottes-Botschaft Jesu als rein eine religiöse Kategorie 305 2.3.8.2.4 Spiritualität als (ver)tröstender Ausgleich angesichts der wachsenden sozialen Spaltung 306 2.3.8.2.5 Vergebung ohne Erlösung 308 2.4 Zusammenfassende Bewertung der ethischen Modelle 311 2.4.1 Klassisch-katholische Moraltheologie (Anselm Günthör) 311 2.4.2 Theonome Autonomie (Franz Böckle) 313 2.4.3 Befreiung der Freiheit (Stefan Ernst) 315 2.4.4 Gemeinsame Grenzen der drei diskutierten Modelle 317 2.4.4.1 Lediglich Rhetorik vom „ganz Neuen" 317 2.4.4.2 Schöpfungstheologie und Christologie von oben als Bezugspunkt christlich-universaler Ethik 318 2.4.4.3 Vorrang des Naturrechts — Gottesreich nur als religiöse Kategorie 318 2.5 Ethik der Nachfolge: Jon Sobrinos Christologie der Befreiung 320 2.5.1 Die christliche Vernunft 320 2.5.2 Der neue Glaube an Jesus, den Befreier, als historisch wirksames Moment 324 2.5.2.1 Das Gute im Sinne Jesu, des Befreiers der Armen 326 2.5.2.2 Zum Gang der Untersuchung 333 2.5.2.3 Rückkehr zu Jesus: eine bereits im Neuen Testament bezeugte Methode 334 2.5.2.4 Zum Verständnis des Historischen als erkenntnisförderndes Moment 337 2.5.2.5 Gute Nachricht für wen? — Adressatenbezug als konstitutives Element 341 2.5.3 Nachfolge Jesu als ethische Kategorie 343 2.5.3.1 Der historische Jesus als Weg zum Verständnis Jesu Christi 344 2.5.3.2 Mitwirken am Aufbau des Gottesreiches als ethischer Auftrag 346 2.5.3.3 Der historische Jesus als Bewahrer Jesu Christi angesichts der Gefährdung des Erkenntnisprozesses durch menschliche Sündhaftigkeit 348 2.5.3.4 Der historische Jesus in den europäischen Christologien: Ziel der Untersuchung oder Kriterium der Nachfolge? 349 2.5.4 Die Reich-Gottes-Botschaft Jesu als Bestandteil des Letztgültigen Jesu 355 2.5.4.1 Ersttestamentlicher Wurzelgrund: Reich Gottes als historische Realität 355 2.5.4.2 Götzendienst: theologale Verdrehung und ethische Verfehlung 358 2.5.4.3 Prophetische Praxis: Anklage des Antireiches und Entideologisierung 362 2.5.4.4 Ringen um die Perspektive Jahwes, der das Leben der Schwachen schützt 363 2.5.5 Das Gottesverständnis als Zentrum der Auseinandersetzung 367 2.5.5.1 Ein Ausweg: Entgötzung Christi 367 2.5.5.2 Schützt das Vertrauen auf den Gott der Armen hinreichend vor der Amivalenz des menschlichen Herzens? 368 2.5.5.3 Reichtum — der gefährlichste unter den Götzen 372 2.5.5.4 Gott ermöglicht das Gute: Das Abgeben des Reichtums, damit Arme nicht mehr arm sind, als Rückgewinnung des ursprünglichen Sinns der Tora 374 2.5.5.5 Überwindung des nationalen Denkens: Der Tempel — kein exklusiv jüdischer Ort, sondern ein Haus des Gebets für alle Völker (Mk 11,17) 375 2.5.5.6 Innere Dialektik von Orthodoxie und Orthopraxis 377 2.5.6 Die Letztgültigkeit des Gottesreiches und die Feindschaft des Antireichs 380 2.5.7 Jesus, der Verfolgte. Ernstfall der Nachfolge 382 2.5.7.1 Die Macht in der Ohnmacht — Jesu Festhalten an der Vision des gewaltfreien Gottesreiches 384 2.5.7.2 „Im Namen des lebendigen Gottes ..." — Die Verurteilung Jesu durch die Priesterschaft 388 2.5.7.3 Im Namen des Imperiums — die Verurteilung Jesu durch den römischen Statthalter Pilatus 390 2.5.8 Kritische Würdigung der befreiungstheologischen „Ethik der Nachfolge" 395 2.5.8.1 Die Wirklichkeit der Gekreuzigten 395 2.5.8.2 Vorrang der Armen vor den Guten und Erfolgreichen 401 2.5.8.3 Das Reich Gottes und die Gegnerschaft des Antireiches — Versuchung zum Dualismus oder Annahme der Realität? 403 2.5.8.4 Selbsterhalt und Gewalt 405 2.6 Theologische Logik in der „Ethik der Nachfolge" und deren Kritik an der christlichen Universalethik 412 2.7 Problemaufriss: Zwei unvereinbare Konzeptionen von christlicher Ethik 415 3 Kirche und Ethik in der modernen Gesellschaft in der systemtheoretisch orientierten Theologie 419 3.1 Welche Funktionen hat die Ethik in der modernen Gesellschaft? 421 3.1.1 Desintegrative Funktion der Moral 421 3.1.2 Integrative Funktion der Ethik? Wertevermittlung als Aufgabe von Religion 422 3.2 Moral im Plural — Funktionen von Moral und Ethik in der funktional differenzierten Gesellschaft nach Luhmann 424 3.2.1 Moral als systemübergreifende Kommunikation 424 3.2.2 Ethik als wissenschaftliche Reflexion der Moral 424 3.2.2.1 Beobachtung systemübergreifender Kommunikation 424 3.2.2.2 Systemübergreifende Kommunikation als Problemlösung an sich 425 3.2.3 Perspektiven einer christlich-positionalen Ethik 429 3.2.3.1 Rechtfertigung und Plausibilisierung statt Rechthaberei 429 3.2.3.2 Reflektierte Positionalität theologischer Ethik 430 3.2.3.3 Plausibilisierung theologischer Ethik 430 3.2.3.4 Die Kirchen als religiöse Kommunikatoren 433 4 Möglichkeitsbedingungen einer christlich-positionalen Ethik in der Moderne 435 4.1 Theoretische Mindestanerüche an eine Ethik in der modernen pluralen Gesellschaft 435 4.2 Genügt die „Ethik der Nachfolge" den Mindestansprüchen einer systemtheoretisch fundierten Ethiktheorie? 437 4.2.1 Moral nicht als etwas Gutes, sondern als Unterscheidung 437 4.2.2 Den Anwendungsbereich der Moral limitieren: Die Option für die Armen 439 4.3 Zur Problematik der Anschlussfähigkeit einer positional-christlichen Ethik 444 5 Christlich-positionale Ethik und ihre Anschlussfähigkeit an andere ethische Konzepte der Moderne 449 5.1 Präsenzeiner heilsamen Alternative — Tora 449 5.1.1 Die Fesseln kulturhomogener Gruppen überwinden — die Taufe 454 5.1.2 Geschwisterliche Ermahnung — Binden und Lösen (Mt 18,15-18) 458 5.1.2.1 Konflikte austragen — Vergebung gewähren. Versöhnen nach dem Gesetz Christi 458 5.1.2.2 Ethische Entscheidungsfindung nach der Regel Christi 461 5.1.3 Miteinander Brot brechen Solidarität üben 464 5.1.4 Vielfalt der Gaben — die Fülle Christi 468 5.1.4.1 Würde und Vollmacht 468 5.1.4.2 Ein Volk von Priestern — der egalitäre Aspekt 472 5.1.5 Versammlung mit Redefreiheit — Die Regel des Paulus 475 5.1.5.1 Konsensfindung im Vertrauen auf den Heiligen Geist (1 Kor 14) 475 5.1.5.2 Konsensfindung im offenen Gespräch als säkularer Weg der Konfliktfindung 477 5.1.6 Die Verheißung der Sakramente: Wenn Menschen so handeln, handelt Gott in ihnen 478 5.1.6.1 Liturgie und soziale Praktiken — zwei Seiten der einen Medaille 481 5.1.6.2 Freiwillige Unterordnung: Die erste Aktualisierung und Kontextualisierung der messianischen Ethik 485 5.1.6.3 Verantwortung und wechselseitige Abhängigkeit anstatt Hierarchie und Gehorsam 488 5.1.7 Schlussfolgerung und weiterführende Gedanken 491 5.2 Jüdisch-christliche Selbst- und Herrschaftskritik im Namen Gottes: Prophetie 493 5.2.1 Christlicher Antisemitismus als christliche Ursünde 494 5.2.2 Ist mit Jesus das archaische Opfer überwunden? 498 5.2.2.1 Seinem Namen ein Gedächtnis stiften — Aspekte jüdischer Opferkultur 500 5.2.2.2 Macht es heute noch Sinn von Jesu Tod als Opfertod zu sprechen? 504 5.2.2.3 Das Kreuz als Symbol universaler göttlicher Herrschaft 512 5.2.2.4 Tut dies zu meinem Gedächtnis — Dem Leben Jesu ein lebendiges Gedächtnis sein 516 5.2.3 Das lebendige Opfer Jesu aus der Perspektive der Opfer verstehen 523 5.3 Biblische Vernunftkritik: Weisheit 528 5.3.1 Glaube und Vernunft 529 5.3.1.1 Empathie und Urteilsbereitschaft — Christliche Vernunft im Angesicht der Not 529 5.3.1.2 Ein Ausweg aus der Sackgasse: Das Denken — Zwiegespräch mit mir selbst — als Quelle moralischen Handelns entdecken 533 5.3.2 Ijjob — Aufstand Israels gegen ein Ungeheuer, das ihm als Gott „verkauft" wird 539 5.3.2.1 Der Schmerz Ijjobs 539 5.3.2.2 „Du hast dich verwandelt in etwas Brutales ..." — Der Ersatz Gottes 543 5.3.2.3 Gott kehrt (die Verhältnisse) um 545 5.3.2.4 Ijjobisierung — das entstellte Gesicht des Volkes 550 6 Schlussbetrachtung 555 6.1 Was leisten die analysierten Ethiken in Bezug auf den Klimawandel? 555 6.1.1 Zur Allgemeinen Moraltheologie nach Anselm Günthör 555 6.1.2 Zur Fundamentalmoral nach Franz Böckle 556 6.1.3 Zur Theologischen Ethik nach Stefan Ernst 558 6.1.4 Ökonomische Logik und perspektivischer Neuansatz 559 6.2 Kehrt Gott heute um? 561 6.3 Im Gespräch mit dem inneren Freund — Autonomie jenseits der Posen von Stärke und Größe leben 563 6.4 Heiligung — ein religionskritischer, realhistorisch befreiender Prozess 566 6.5 Das Neue kann nur wachsen, wenn wir alte Vorstellungen und das ihnen entspringende Handeln aufgeben 571 6.6 Widerstand ist unausweichlich 580 Literaturverzeichnis 583 |
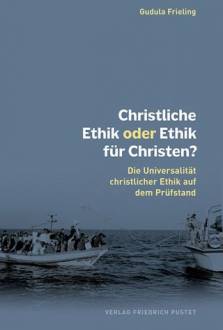
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen