|
|
|
Umschlagtext
Wie denken die Chinesen? Denken sie wie wir im Westen (das meinen die Universalisten) oder ganz anders (so behaupten es die »Differenzialisten«)? Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, untersucht der Autor die Schriften maßgeblicher westlicher Sinologen (u.a. Roetz, Schwartz, Needham, Wagner, Julien) auf ihre philosophischen Grundlagen. Das Ergebnis ist überraschend: Viele Darstellungen haben recht wenig mit den chinesischen Quellen, aber sehr viel mit der philosophischen Perspektive zu tun, aus der sie betrachtet werden.
So banal eine solche Feststellung erscheinen mag, so gravierend sind ihre Implikationen, gemessen an der ursprünglichen Fragestellung: Denn die Sichtweise, die die westliche Sinologie bei ihrer Lektüre der chinesischen Klassiker jeweils einnimmt, ist Schauplatz einer sehr westlichen philosophischen Kontroverse zwischen Anhängern positivistischer Welt- und Erkenntnisauffassungen und Verfechtern eines antiaufklärerischen, antirationalistischen Weltverständnisses. Rezension
Dachten die chinesischen Gelehrten anders oder ähnlich wie die westlichen Philosophen? Benutzen chinesische Denker begriffliche Abstraktionen und orientieren sie sich an der Forderung nach Widerspruchsfreiheit? Hielten sie an einer Subjekt-Objekt-Spaltung fest? Welche Merkmale chinesischen Denkens identifizierten führende westliche Sinologen des 20. und 21. Jahrhunderts? Wer von ihnen zählt zu den Universalisten, wer zu den Differenzialisten? Gibt es eine gemeinsame Voraussetzung, welche die Ähnlichkeitsverfechter und die Differenzialisten teilen? Welche chinesischen Originalquellen werden von den Sinologen zur Identifikation eines chinesischen Denkens herangezogen? Rekurrieren die Sinologen bei ihrem China-Bild auf bestimmte westliche Philosophen?
Fundierte Antworten auf diese Fragen der Rezeptionsgeschichte chinesischen Denkens in der Sinologie gibt das Buch „China liegt nah. Über chinesisches Denken und seine zeitgenössische westliche Rezeption“, erschienen bei Felix Meiner. Sie stammt von Hermes Spiegel, der seit 2003 Inhaber einer Professur an der Staatlichen Hochschule für Übersetzer und Dolmetscher in Brüssel ist und von 2010 bis 2015 auch an der Volksuniversität in Peking lehrte. In seiner Studie zeigt Spiegel unter Heranziehung der chinesischen Originalquellen zum Beispiel von Konfuzius, Lao-Tse und Zhuangzi differenziert auf, von welchen Denkmustern die westliche Sinologie bei ihrer Perspektive auf das chinesische Denken geleitet wird. Dabei kann er aufzeigen, dass Universalisten und Differenzialisten, bei allen Unterschieden in der Einschätzung der Rationalität chinesischen Denkens, die gemeinsame Prämisse teilen, dass sich anhand des Untersuchungsgegenstands objektive Erkenntnisse gewinnen lassen. Diese Position teilt Spiegel mit Verweis auf das konstruktivistische Textverständnis von Paul Valéry nicht. Er sieht in Hegels Begriff der „bestimmten Negation“ und in Nietzsches Perspektivismus produktive Zugänge zum chinesischen Denken. Außerdem widerlegt Spiegel in seiner Untersuchung überzeugend das verbreitete Vorurteil, die altchinesischen Denker hätten sich keiner logisch kohärenten Argumentationen bedient. Fazit: Mit seinem Buch „China liegt nah“ leistet Hermes Spiegel einen wichtigen Beitrag zur Wissenschaftsphilosophie und -geschichte der zeitgenössischen westlichen Sinologie. Dr. Marcel Remme, für lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Wie denken die Chinesen? Denken sie wie wir im Westen (das meinen die Universalisten) oder ganz anders (so behaupten es die »Differenzialisten«)? Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, untersucht der Autor eine Reihe repräsentativer sinologischer Arbeiten (sowie Werke von Philosophen, die über chinesisches Denken geschrieben haben) auf ihre philosophischen Grundlagen. Das Ergebnis ist überraschend: Viele Darstellungen haben recht wenig mit den chinesischen Quellen, aber sehr viel mit der philosophischen Perspektive zu tun, aus der sie betrachtet werden. So banal eine solche Feststellung erscheinen mag, so gravierend sind ihre Implikationen, gemessen an der ursprünglichen Fragestellung. Denn die Sichtweise, die die westliche Sinologie bei ihrer Lektüre der chinesischen Klassiker jeweils einnimmt, ist Schauplatz einer sehr westlichen philosophischen Kontroverse zwischen Anhängern positivistischer Welt- und Erkenntnisauffassungen und Verfechtern eines antiaufklärerischen, antirationalistischen Weltverständnisses. Doch weder die Universalisten noch die »Differenzialisten« sind imstande, diskursiv haltbare Argumente für die Richtigkeit ihrer jeweiligen Interpretation zu bieten. Dies ist, so die These, auch nicht möglich, denn eine Wahrheit, die vom »konstruktiven« Beitrag des sie aussprechenden Subjekts unabhängig wäre, gibt es ebenso wenig wie den »wahren« Konfuzius, Laozi oder Zhuangzi. Mit besonderer Aufmerksamkeit wird die These der grundsätzlichen Andersartigkeit des chinesischen Denkens gegenüber dem westlichen behandelt. Es wird nicht nur gezeigt, dass diese Andersartigkeit eine Erfindung ihrer Verfechter ist, sondern auch, wie rational vorgehendes Denken in die selbstkritischen, autodestruktiven Überlegungen von Zhuangzis Skeptizismus übergehen kann. In diesem radikal kritischen Denkstil sieht der Autor eine Ähnlichkeit mit Hegels und Nietzsches Kritik des Verstandesdenkens. Inhaltsverzeichnis
Vorwort
11 Einleitung 15 Ähnlichkeit und Differenz 17 1. Westliche Voreingenommenheit sowohl der Ähnlichkeits- als auch der Differenzverfechter 23 2. Die Schwächen der übernommenen philosophischen Muster: Das positivistische Muster 27 3. Die Schwächen der übernommenen philosophischen Muster: Das postmoderne Muster 39 4. Falsche Vorstellungen von westlicher Rationalität 52 5. Unzulässige Monopolisierung von Wissenschaft und Logik 55 6. Voreingenommenheit jeder möglichen Interpretation des chinesischen Denkens 67 7. Der Kollaps der differenzialistischen Interpretation des chinesischen Denkens 78 Exkurs: Philosophische Überlegungen zu ernüchternden Befunden 85 Teil I Die Ähnlichkeitsverfechter (Universalisten) 109 Die moralphilosophische Ähnlichkeitsvariante 111 1. Heiner Roetz 111 Ideologische Natur von Roetz' AnalysenKursiv-Text in den zitierten Passagen stammt, wenn nicht mit dem Hinweis Hervorh. von mir in eckigen Klammern versehen, aus Roetz' Feder. 114 Universalistische Heuristik von Roetz' UntersuchungenSiehe auch unsere Kritik bezüglich der Roetzschen Hermeneutik im letzten Teil dieses Kapitels. 117 Über die Folgen von Roetz' ideologischem Ansatz 118 Gegen den Utilitarismus des Mozi 118 Gegen den Taoismus 120 Gegen den Legalismus 124 Ergebnisse und Ausblick 126 Die Schwächen von Roetz' Interpretation: Nur was mit Moral zu tun hat, ist rational 128 Zu Roetz' Hermeneutik 132 2. Albert Schweitzer 136 Albert Schweitzer über das chinesische Denken. Eine sinologische Anmerkung von Heiner RoetzSchweitzer, Geschichte …, S.331348. 142 3. Benjamin I. Schwartz 149 Die Achsenzeit 150 Schwartz' Überlegungen zu Mozi 153 Schwartz' Würdigung des Taoismus 156 Schwartz' Hermeneutik 162 Die moraltheoretisch begründete Ähnlichkeit von chinesischem und westlichem Denken: eine Bilanz 165 Sozialwissenschaftlich geprägte Interpretationen und ihre universalistischen Voraussetzungen 167 1. Ralf Moritz 168 Konfuzius 170 Mozi 171 Moritz zum Yangismus 173 Taoismus: Philosophie oder Mystik? 175 Zhuangzi 177 540D5BB6 Mingjia 178 Hui Shi 60E065BD 179 Xunzi 181 Hanfeizi 182 Epilog 183 2. Max Weber 187 Max Webers universalistische Einstellung 187 Max Webers Übernahme von de Groots Universismus 191 Die Vernachlässigungstheorie 199 Verwertbare Aspekte von Webers Analysen 202 Webers Abwertung des chinesischen Denkens 203 Webers verpaßte Begegnung mit Zhuangzi 204 3. Henri Maspero 207 Zum Taoismus 215 Die wissenschaftstheoretische Ähnlichkeitsvariante 217 1. Hu Shi 217 Konfuzius 224 Mozi 227 Hui Shi (60E065BD) und Gongsunlong (516C5B599F99) 237 Laozi 241 Hu Shis pragmatistische Verblendung 243 2. Joseph Needham 245 Taoismus 249 Zu den Grundsätzen der chinesischen Wissenschaft 253 Über Needhams China-Verständnis und dessen Platz in unserer Darstellung 258 3. Nathan Sivin 262 Ergebnisse 275 Die strukturalistische Kohärenzvariante (Rudolf Wagner) 277 1. 277 Homogenität und Kohärenz 278 Aktualität von Wang Bis Leseart 280 Herstellung zweckmäßiger Zusammenhänge 282 Sprache als Verschleierung von Wahrheit 286 Wang Bis Fehleinschätzung des Verhältnisses zwischen Konfuzius und Laozi 288 Wagners Ausblendung des Taoismus 289 Wang Bis Fehler 292 Wagners Wertschätzung des Wang-Bi-Kommentars 294 Ideologische Dimension von Wang Bis Laozi-Lektüre 296 2. 299 Sprache, Ontologie, Politik 299 Wang Bis Hermeneutik 303 Ontologie und Politik 305 Wang Bis Begründung politischer Praxis 307 Ideologische Kohärenz 309 Wang Bi's Philosophy an Ideology? 312 Teil II Die Differenzialisten 317 Die positivistische Differenzvariante 319 1. Angus Charles Graham 320 Laozi 331 Zum experimentellen Wissen der Chinesen 333 Zur mohistischen Logik, Ethik und Wissenschaft 337 Grahams basic rules of translationAngus Charles Graham, Kung-Sun Lung's Essay on Meanings and Things, in: Journal of Oriental Studies, Reprinted from Vol. II, No.2 July 1955, 282301. 340 Über Grahams Philosophie und ihr Fundament 345 Widersprüchlichkeit von Grahams China-Verständnis 349 2. Chad Deloy Hansen 351 Zu Mozis Philosophie 359 3. Jacques Gernet 366 Skeptischer Relativismus 375 Langage et pensée 378 Schlußbemerkung 385 Die postmoderne Differenzvariante 393 1. François Jullien 394 Julliens Theorie der Andersheit 396 2. David L. Hall/Roger T. Ames 408 Notwendigkeit eines Anti-Diskurses (counterdiscourse) zur Aneignung des chinesischen Denkens 416 Entrümpelung 417 Die Aporie des counterdiscourse 419 Ideologische Natur von Halls und Ames' Interpretation 420 Die Blüten der vagueness-Theorie 424 Die Chinesen dachten doch in kausalen Zusammenhängen 426 Fazit 429 Einsicht in die Differenz als Erleuchtungsereignis 433 1. Hermann-Joseph Röllicke 433 Geschichte und Erforschung des ziran-Gedankens 439 Ergebnisse 442 2. Jean François Billeter 445 Schluß 453 Bescheidenheit der Erträge einer verstandesmäßigen Erfassung des chinesischen Denkens 453 Gemeinsame Eigenschaften und Defizite der analysierten Interpretationen 457 Wenn die Interpretationen des chinesischen Denkens nur Projektionen vorgefaßter westlicher philosophischer Vorstellungen sind, wozu die Mühe des Umwegs? 458 Die sinologische Objektivitätsillusion 460 Notwendigkeit einer neuen Lektüre der chinesischen Texte 463 Interpretationen der chinesischen Texte sind subjektiv, aber nicht beliebig 464 Anhang 467 Originalversion der vom Verfasser übersetzten Zitate 469 Verzeichnis der in Auszügen zitierten Schriften 485 Personenregister 495 Sachregister 501 |
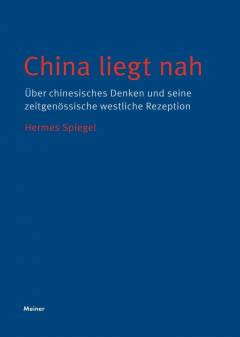
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen