|
|
|
Umschlagtext
Jesus starb nicht am Kreuz. Er heiratete Maria Magdalena, ging mit ihr nach Frankreich, bekam Kinder und wurde zum Stammvater der Merowinger. Glaubt man Michael Baigent und anderen "Forschern", unterschlägt die Kirche diese und noch mehr "historische Wahrheiten" im Interesse der eigenen Macht und Lehre.
Es ist sehr viel leichter, Unsinn in die Welt zu setzen, als den Unsinn und alles, was daraus abgeleitet wird, zu widerlegen. Genau dieser Aufgabe aber hat sich Matthias Wörther unterzogen. Er weist nach, dass hier Mythologien, Legenden und abstruse Hypothesen als Tatsachen hingestellt werden, die einer kritischen Prüfung nicht standhalten. Sobald Beweise vorgelegt werden sollen, stehen die Verschwörungstheoretiker mit leeren Händen da. Dennoch üben deren Theorien eine besondere Faszination aus. Auch dem geht Wörther nach und zeigt, warum die Lebensfragen, die dahinter stehen, bei Baigent und Co. keine angemessene Antwort finden. Die Schlüssel zu den Geheimnissen des Lebens finden sich anderswo. Matthias Wörther geboren 1955, Studium der Germanistik und Theologie; Leiter der Fachstelle "medien und kommunikation" der evangelischen und katholischen Kirche, München Rezension
Matthias Wörther, geb. 1955, Studium der Germanistik und Theologie, Leiter der Fachstelle "medien und kommunikation" der evangelischen und katholischen Kirche in München, ist regelmäßigen Nutzern von lehrerbibliothek.de u.a. durch seine gelegentliche Mitarbeit unter religionsunterricht.de bekannt. Medien und Religion, - dieser Schwerpunkt umfasst auch die großen, auflagenstarken, seit Jahrzehnten in immer neuen Spielarten auf dem Buchmarkt erscheinenden Jesus-Romane oder angeblichen Enthüllungen über Jesus und das Urchristentum, gespickt mit allerlei apokryphen Informationen, wonach Jesus z.B. nicht am Kreuz gestorben sei (klassisch-gnostisches Interesse!), nach Indien wanderte, Maria Magdalena heiratete und mit ihr ein Kind zeugte ... Gepaart mit anti-kirchlicher Polemik, - die Kirche halte bewußt Informationen zurück, vgl. Qumran-Edition ... -, lassen sich daraus immer noch Bestseller machen ... Matthias Wörther hat sich mit diesen Theorien intensiv (und exemplarisch an Michael Baigent) auseinandergesetzt. Er zeigt unpolemisch, sachlich und klar, dass hier Mythologien, Legenden und Hypothesen als historische Wahrheiten im wahrsten Sinne des Wortes verkauft werden: ein "Gottesgeschäft" mit zweifelhaften Argumenten! - Für einen Jesus-Kurs im Religionsunterricht vielleicht einmal eine lohnende Beschäftigung!
Gerd Buschmann, lehrerbibliothek.de Inhaltsverzeichnis
Einleitung 7 1. Von Schatzsuchern und großen Geheimnissen 15 Warum wir uns gerne mit Archäologie, verschlüsselten Texten und den Frauen Jesu beschäftigen a) Den ›Gral‹ finden 16 b) Codes entschlüsseln 18 c) Schätze entdecken 20 d) Den Durchblick haben 23 e) Ressentiments bestätigen 26 2. Beweise fehlen: Das ist der Beweis! 29 Warum man bei der Lektüre von Enthüllungsbüchern seinen Verstand nicht abgeben sollte a) Was die Darstellungsform verrät 31 Ein Schleier von Fragen 32 Die Vorherrschaft des Konjunktivs 33 Erleuchtung von innen 36 b) Fakten und Fiktionen 38 Die Kirche fälscht die Geschichte 39 Ein Konzil beschließt: Jesus ist Gott 45 Jesus war mit Maria Magdalena verheiratet 47 Die Kirche unterdrückt die wahre Lehre Jesu 50 c) Pseudowissenschaft: Beweise, die keine sind . 52 Schein und Sein 52 Autoritäten und Pseudo-Autoritäten 53 Schnitzeljagd ins Leere 58 Was fehlt, aber nicht fehlen dürfte 62 Baigent gegen Baigent 72 3. Im Sumpf des Dogmas 79 Warum Konzilsentscheidungen Sinn machen a) Wo es sich zu suchen lohnt 82 b) Verschlüsseln und Entschlüsseln 87 c) Die wahren Schätze 91 Ein ungewöhnlicher Mensch 94 Jesus und die Frauen 96 Das Reich Gottes 98 Der Glaube Jesu 101 d) Glauben ist vernünftig 102 e) Theologie schafft Durchblick 109 Jesus und Christus 111 Das Konzil von Nizäa 117 Testfall Gnosis 127 4. Das ist schwach! 133 Warum sich Kirche über den Erfolg von Brown, Baigent und Co. nicht nur wundern sollte a) Anschluss finden 135 b) Auf Wissen setzen 138 c) Selbst denken (lassen) 141 d) In Bewegung kommen 144 Nachwort 149 Wo man nachlesen kann, was wirklich Sache ist 151 Ein kommentiertes Literaturverzeichnis Leseprobe
Leseprobe: Einleitung Der Buchmarkt wird durch eine Flut von ›Sekundär‹-Literatur überschwemmt, die sich aus dem weltweiten Erfolg von Dan Browns Roman ›Das Sakrileg‹ (›Da Vinci Code‹, Auflage etwa 50 Millionen!) herleitet. Alles, was ›Das Sakrileg‹ heißt, damit zu tun hat oder sich an den Erfolg des Buches anhängen möchte, ist an der zum Markenzeichen und Erkennungssignal gewordenen schwarz-roten Umschlaggestaltung und den vor Blut tropfenden Buchstaben zweifelsfrei zu erkennen. ›Das Sakrileg‹ ist ein gekonnt geschriebener und ziemlich spannender Thriller, aber so fiktiv wie Umberto Ecos Trends setzender Roman ›Der Name der Rose‹ oder sämtliche Bände in der Bibliothek der Süddeutschen Zeitung. Vermarktet und vor allem rezipiert wird er jedoch, als ob die angeblichen Fakten hinter der Fiktion Hand und Fuß hätten. Die scheinbare Authentizität, die seinen Aussagen zugesprochen wird, verleiht dem Roman die Gloriole eines aufklärerischen und investigativen Enthüllungsjournalismus, obwohl er weder aufklärt noch irgendetwas enthüllt. Ganz im Gegenteil. Durch den inzwischen hinfälligen Plagiatsvorwurf, den Michael Baigent und Richard Leigh gegen Dan Brown erhoben haben, ist auch eine der Quellen seines Romans, das so genannte Sachbuch ›Der Heilige Gral und seine Erben‹ von Michael Baigent, Richard Leigh und Henry Lincoln dank einer preisgünstigen Taschenbuch-Neuausgabe auch in Deutschland wieder auf die Bestsellerlisten geraten. Die Produktionsfirma der Mitte Mai angelaufenen Verfilmung des ›Da Vinci Code‹ mit Tom Hanks in der Hauptrolle hat den Hype noch vor der Uraufführung weiter angeheizt, indem sie auf die sonst üblichen Vorsichtungen für die Presse verzichtete. Wie der Plagiats-Prozess in London ist auch der Film einer Vielzahl von weiteren Publikationen auf allen Medienkanälen dienlich, die die Entschlüsselung des ›Da Vinci Codes‹ versprechen oder Hintergrundmaterial zu Roman und Film liefern wollen. In gleicher Weise sind Bücher gefragt, die die bei Baigent und Brown vertretenen Thesen wie: Jesus habe die Kreuzigung überlebt, er sei mit Maria Magdalena verheiratet gewesen oder er habe die Dynastie der Merowinger begründet, belegen, widerlegen oder in noch absurdere Spekulationen weitertreiben, ohne einen Deut auf die Unterscheidung von Fakten und Fiktionen zu geben. Auf dem Markt finden sich zahllose Sachbücher à la ›Das Sakrileg und die Heiligen Frauen‹, ›Das Erbe der Maria Magdalena. Das geheime Wirken der Witwe Jesu‹ oder ›Hüterin des Heiligen Gral. Maria Magdalena – die Frau Jesu‹. Gleichzeitig quellen die Belletristik-Regale von Roman-Epen über, die das Wirken der Tempel-Ritter (›Die Rückkehr der Tempelritter‹), die Machenschaften obskurer Geheimgesellschaften (›Die Vatikan-Verschwörung‹, ›Die Loge‹) und die Untaten diverser Orden (›Die Feuermönche‹) über Hunderte von Seiten mehr oder weniger unterhaltsam ausführen. Auch Baigent selbst, der in der Vergangenheit nicht nur mit seinen Gralsspekulationen, sondern auch mit dem Buch ›Verschlusssache Jesus. Die Qumranrollen und die Wahrheit über das frühe Christentum‹ sehr erfolgreich gewesen war (das übrigens auch wieder auf der Taschenbuch-Bestsellerliste des ›Gong‹ erschienen ist), versucht dem Boom um Jesus, den heiligen Gral und zu klärende Geheimnisse aller Art noch einmal etwas Geld und Publizität abzugewinnen. Sein im April 2006 erschienenes Werk ›Die Gottes-Macher. Die Wahrheit über Jesus von Nazareth und das geheime Erbe der Kirche‹ stellt er im Vorwort großspurig als das Ergebnis weit reichender Nachforschungen dar. ›Der Heilige Gral und seine Erben‹ war erstmals im Jahr 1982 erschienen. Zwanzig Jahre Recherche: Das verspricht einiges! Tatsächlich zeigt schon eine oberflächliche Lektüre von ›Die Gottes-Macher‹, dass die ›Recherchen‹ nur eine vollmundige Ankündigung sind. Nichts führt in diesem Buch weiter oder überhaupt irgendwohin. Noch einmal bringt Baigent windige Verschwörungstheorien vor, spekuliert über angeblich brisante Dokumente, die aber mit Sicherheit gerade nicht zugänglich oder verschwunden sind, und tritt seine vertrauten Thesen ein weiteres Mal breit, unter Verzicht auf den Detailreichtum seiner früheren Werke, aber angereichert um ein paar neue Spekulationen über das Leben Jesu, die sich in den Kapiteln ›Jesus in Ägypten‹ und ›Ägyptische Mysterien‹ finden. Wer Buchrezensionen in Zeitschriften konsultiert, sich im Internet kundig zu machen sucht oder bereits vorhandene Literatur nach der Substanz der angeblich höchst bedeutsamen Enthüllungen befragt, läuft auf der Suche nach harten Fakten ins Leere. Sobald man sich auf einigermaßen seriösem Grund bewegt, herrscht unter Fachleuten, Rezensenten und kritischen Lesern Einigkeit, dass es sich bei den Behauptungen von Baigent, Leigh, Lincoln und deren Vorläufern und Epigonen um reinen Unfug handelt. Die viel beredete Bruderschaft von Zion (Prieuré de Sion) wurde 1956 von dem französischen Betrüger und Fälscher Pierre Plantard erfunden, der seine Manipulationen 1993 vor Gericht unter Eid eingestand. Die für Baigents Argumentation zentralen geheimen Dokumente (›Dossiers Secrets‹) sind als gezielt in der Französischen Nationalbibliothek platzierte Fälschungen entlarvt. Und vieles, was in seinen Büchern den Anschein historischer Wahrheit bekommt, erweist sich bei genauerem Hinsehen als fantasievolle Mischung von willkürlich vermengten historischen Tatsachen, an den Haaren herbeigezogenen Zusammenhängen und wilden Spekulationen. Seit ›Der Heilige Gral‹ erstmals erschien, wurden die Behauptungen Baigents immer wieder kritisiert und eine nach der anderen widerlegt, gerade auch diejenigen seiner Thesen, die nicht direkt auf Plantards Betrügereien aufbauen. Um seinen wissenschaftlichen Ruf ist es deshalb nicht gut bestellt. Man könnte sich also mit gutem Gewissen jede weitere Auseinandersetzung sparen. Aber obskure Theorien um Jesus, Kirche, Evangelien, Mönche und Geheimgesellschaften sind in Mode gekommen und ein beliebtes Gesprächsthema geworden. Kein Medium, das sich nicht mit Dan Brown und Baigent beschäftigt hätte. Offenbar sprechen sie mit ihren Themen Bereiche an, in denen es weniger um Sachfragen als um die Freude an Spekulationen, Ressentiments und Emotionen geht. Wie sonst ließe sich eine so breite öffentliche Debatte erklären, die sich um erwiesenen Unsinn dreht? Viele der Gral-Faszinierten sind sicher auch durch autoritätskritische, wissenschaftsskeptische oder auf Sensationsgier beruhende Motive angetrieben: Könnte sich die Beschäftigung damit nicht doch lohnen? Werden hier Thesen nicht nur deshalb allzu eilig als Humbug abgetan, weil dadurch etablierte Positionen und damit auch ihre Vertreter in Frage gestellt würden? Wäre es nicht vorstellbar, dass es sich tatsächlich um brisante Fakten und diskussionswürdige Hypothesen handelt, wenn man genauer hinschaut und sich darauf einlässt? Dass die Geschichte Europas und des Christentums tatsächlich neu geschrieben werden muss? Gründet sich womöglich der Glaube der Christen letztlich doch auf äußerst fragwürdige Annahmen und zweifelhafte Voraussetzungen? Ist der Kirche und ihren Funktionären der große Betrug etwa nicht zuzutrauen? Auf alle diese Fragen kann die Antwort nur ein klares Nein sein. Das vorliegende Buch wird zeigen, dass auch der in historischen und theologischen Dingen nicht weiter bewanderte Laie schnell selbst feststellen kann, wie viel (oder besser: wie wenig) es mit der Glaubwürdigkeit und Relevanz dieser Art von ›Science Fiction‹ und Märchenstunde für Erwachsene auf sich hat. Es gibt eine Reihe von Kriterien, die jeder schon im Vorfeld der Diskussion an Verschwörungstheorien anlegen kann, um mittels einer Qualitätsprüfung zu entscheiden, ob sich eine intensivere Beschäftigung damit überhaupt lohnt. Sie werden im Mittelpunkt des Buches stehen. Gleichzeitig soll aber auch nicht aus dem Blick geraten, dass der Erfolg dieser abstrusen Theorien sowohl auf mangelnde theologische Bildung bei Gläubigen wie auf kirchliche Defizite in der Verkündigung hinweisen könnte. Wovon auch immer unsere Gesellschaft eine Ahnung hat, von Theologie jedenfalls nicht. Die Kritik an Theorien à la Baigent und die theologische Entgegnung werden in fünf Kapiteln entwickelt. Als Hauptquelle für die Darlegungen und beispielhafte Anwendung des kritischen Unterscheidungs-Instrumentariums dienen dabei Werke von Baigent und seiner Mitautoren Leigh und Lincoln, das heißt vor allem die schon genannten Bücher ›Der Heilige Gral‹ (im Folgenden DHG; 1982) und ›Verschlusssache Jesus‹ (Baigent/Leigh 1991) sowie ›Das Vermächtnis des Messias‹ (VM; Baigent/Leigh 1987), ›Verschlusssache Magie‹ (VMG; Baigent/Leigh 1997) und ›Die Gottes-Macher‹ (GM; Baigent 2006). Was man hier lernen kann, lässt sich leicht auf andere Autoren und Themen des zwischen Wissenschaft, Esoterik und Mystifikation aufgespannten Genres übertragen. Das erste Kapitel, ›Von Schatzsuchern und großen Geheimnissen‹, sucht nach den Hintergründen des Erfolgs von Baigent und Konsorten. Worin besteht die Faszination ihrer Bücher? Warum werden sie nicht von vornherein als abstruse Fantasien abgetan? Was motiviert die Autoren und was die Leser, sich mit den Frauen Jesu, Gralslegenden, Geheimdokumenten, archäologischen Funden und dynastischen Zusammenhängen von König David bis in die Gegenwart zu beschäftigen? Welche Interessen werden eigentlich bedient? Kapitel zwei unter dem Titel ›Beweise fehlen: Das ist der Beweis!‹ beschäftigt sich mit den Darstellungsformen Baigents, seinen historischen und theologischen Anknüpfungspunkten und mit den pseudowissenschaftlichen Vorgehensweisen, mit deren Hilfe er seine Thesen zu beweisen sucht. Was also lässt sich am Schreibstil und an seiner Ausdrucksweise über seine Denklogik ablesen? Wie tragfähig sind seine geschichtlichen Beispiele? Auf welche Quellen bezieht er sich und wie geht er mit ihnen um? Und was ist von der ›Wissenschaftlichkeit‹ seiner Ausführungen zu halten? Das dritte Kapitel, ›Im Sumpf des Dogmas‹, setzt sich theologisch mit den Fragen auseinander, die für Gläubige oder am Glauben Interessierte von besonderem Interesse sind. Baigents Bücher irritieren auch deshalb, weil sie Unsicherheiten und Zweifeln hinsichtlich des Lebens Jesu, der Geschichte der Kirche und ihrer Lehre Nahrung geben, die sowohl bei Christen wie außerhalb des kirchlichen Raums zu finden sind. Werfen seine Bücher tatsächlich Fragen auf, die von Relevanz für den Glauben sind? Worauf bezieht er sich und was lässt er aus? Was sagt die Theologie zu seinen Vorstellungen vom Glauben, von Dogmen und von der Göttlichkeit Jesu? Woran glaubt man, wenn man an Jesus glaubt? Und worauf kann ich mich selbst beziehen und warum? Im vierten Kapitel schließlich wird unter dem Titel ›Das ist schwach!‹ der Frage nachgegangen, ob der Medien-Erfolg kruder Thesen über das Christentum und seine Geschichte, die weit verbreiteten Ressentiments gegen die Kirche und die mangelnde Überzeugungskraft des Glaubens in unserer Gesellschaft nicht auch mit der Verkündigung selbst zu tun haben. Woran liegt es, dass man als Gläubiger ›out‹ ist? Weshalb wird Theologie nicht ernst genommen? Und was könnte man dagegen tun? Es ist im Zusammenhang dieser Fragen ganz reizvoll, sich in Erinnerung zu rufen, dass, wie überliefert wird, die komplizierten theologischen Auseinandersetzungen auf den frühen Konzilien vor mehr als 1500 Jahren das Tagesgespräch nicht nur von Bischöfen und Theologen, sondern auch der Leute auf der Straße waren. Offenbar brachten sie die diskutierten Probleme mit dem eigenen Leben in Verbindung und konnten mit den theologischen Begriffen etwas anfangen. Wenn heute immer noch Diskussionen um Jesus entstehen können, dann scheinen seine Person und seine Botschaft weiterhin Bedeutung zu besitzen. Warum also nicht die sich bietende Gelegenheit beim Schopf ergreifen, um Klarheit über Jesus, Dogmen und die Kirche herzustellen und die Lebensrelevanz von Glaubensüberzeugungen zu diskutieren? Könnte eine Auseinandersetzung mit dem Glauben an Jesus Christus und seine Botschaft nicht wirklich interessant werden, wenn der Unfug um seine Heirat mit Maria Magdalena, die Dynastie der Merowinger, deren Stammvater er sein soll, und den heiligen Gral erst einmal aus dem Weg geräumt ist? Wir werden sehen. |
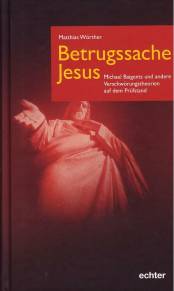
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen