|
|
|
Umschlagtext
Zielvorgaben, Rahmenbedingungen und praktische Hinweise zur Begutachtung von Kindern und Jugendlichen
Das Werk stellt die Zielvorgaben und Rahmenbedingungen für die häufigsten der in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gefragten Gutachten dar. Zudem gibt es all jenen wichtige Hilfestellungen und Anregungen, die sich der schwierigen Aufgabe stellen, Kinder, Jugendliche und deren Familien kinder- und jugendpsychiatrisch zu begutachten. Die Empfehlungen wurden von der Kommission "Qualitätssicherung für das Gutachtenwesen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie" formuliert und spiegeln die Übereinkunft der betreffenden Fachgesellschaften wider. Die 2. überarbeitete und erweiterte Auflage bezieht die aktuellen Gesetzesänderungen aus dem Sorgerecht und Strafrecht mit ein, und gibt Ihnen so Rechtssicherheit für ihre Gutachten. Gleichzeitig ist der zugrunde liegende Qualitätsstandard so beschrieben, dass Auftraggeber und andere Nutzer das kinderpsychiatrisch-forensische Vorgehen nachvollziehen und ggf. prüfen können. Standards zu den zehn wichtigsten Gutachten Interdisziplinärer Konsens der Empfehlungen Kriterien der Gutachtenerstellung - transparent gemacht Ethische Aspekte der Begutachtung Rezension
Bei vielen Begutachtungen im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie spielen ethische Grundlagenaspekte eine bedeutsame Rolle, - das thematisieren die ersten fünf Beiträge in diesem Band (vgl. Kap. 1). Dann folgen die eigentlichen Empfehlungen der Kommission "Qualitätssicherung für das Gutachtenwesen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie" für die verschiedenen Bereiche von Gutachten in Kinder- und Jugendpsychiatrie (vgl.Kap. 2): Strafrechtsgutachten, Sorgerechts- und Umgangsrechtsgutachten, Betreuungsgutachten etc. Neue Gesetzesbestimmungen wie z.B. die neuen Bestimmungen zur elterlichen Sorge sind dabei berücksichtigt.
Oliver Neumann, lehrerbibliothek.de Inhaltsverzeichnis
1 Ethische Aspekte der Begutachtung im kinder- und jugendpsychiatrischen
Bereich sowie Maßregelvollzug von Jugendlichen 1.1 Ethik und die Bedeutung für die Begutachtung 1 Gottfried M. Barth 1.1.1 Ethik und ihre Bedeutung für die Begutachtung – 1 1.1.2 Voraussetzungen für ethisches Handeln – 2 1.1.3 Formen der Ethik – 6 1.1.4 Beispiele ethischer Argumentation aus der Philosophiegeschichte – 7 1.1.5 Möglichkeit von Ethik in der heutigen Welt und in der Medizin – 10 1.1.6 Wo treten ethische Fragen in der Begutachtung auf? – 11 1.1.7 Welche Möglichkeiten erwachsen der Begutachtung aus der Ethik? – 12 1.1.8 Leitlinien, Empfehlungen und Ethik – 13 1.2 Aufklärung von Probanden als ethische Grundvoraussetzung der Begutachtung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie 17 Jörg M. Fegert 1.2.1 Einleitung – 17 1.2.2 Einige Daten – 18 1.2.3 Wer wird worüber aufgeklärt? – 19 1.2.4 Beisein einer Begleitperson – 20 1.2.5 Vorteile der Aufklärung für die Begutachtung – 21 1.2.6 Erwähnung der Aufklärung im schriftlichen Gutachten – 24 1.3 Ethische Aspekte bei der kinderpsychiatrischen Begutachtung von Kindeszuteilung und Umgangsregelung 28 Wilhelm Felder 1.3.1 Einleitung – 28 1.3.2 Ethische Aspekte – 29 1.4 Ethische Problemlagen für den Gutachter bei hochstrittigem Sorge- und Umgangsrecht und bei internationaler Kindesentführung 34 Gunther Klosinski 1.4.1 Einleitung – 34 1.4.2 Prinzipien der Medizinethik nach Beauchamp und Childress – 35 1.4.3 Zu den „gesetzlichen Rahmenbestimmungen“ in Bezug auf Gewaltanwendung gegen ein Kind zur Durchsetzung von Umgangsrecht gemäß § 33 II 2 FGG unter Durchsetzung von Herausgabeansprüchen gemäß § 1632 I BGB – 38 1.4.4 Gutachterliche Beispiele ethischer Konfliktlagen für den Sachverständigen – 40 1.4.5 Schlussfolgerungen – 46 1.5 Maßregelvollzug für Jugendliche 48 Frank Häßler, Renate Schepker und Arbeitskreis Jugendmaßregelvollzug 1.5.1 Einleitung – 48 1.5.2 Gesetzliche Grundlagen – 49 1.5.3 Strukturqualität – 50 1.5.4 Mitarbeiterteam – 52 1.5.5 Therapie – 53 1.5.6 Prognose – 60 1.5.7 Ausblick – 61 1.5.8 Schlussfolgerungen – 62 2 Empfehlungen der Kommission „Qualitätssicherung für das Gutachtenwesen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie“ 2.1 Präambel 65 Jörg M. Fegert 2.1.1 Qualitätssicherung kinder- und jugendpsychiatrischer Gutachten – 65 2.1.2 Formale Qualitätskriterien eines Gutachtens – 68 2.2 Empfehlung zur Erstellung eines Strafrechtsgutachtens 70 Renate Schepker, Peter Hummel 2.2.1 Vorabklärung – 70 2.2.2 Rahmenbedingungen – 70 2.2.3 Gang der Exploration – 71 2.2.4 Befunderhebung – 71 2.2.5 Gestaltung des schriftlichen Gutachtens – 71 2.2.6 Hauptverhandlung – 73 2.3 Empfehlung zur Erstellung eines Sorgerechtsgutachtens 75 Margarete von Rhein, Renate Schepker, Reinmar du Bois 2.3.1 Analyse des Gutachtenauftrages – 76 2.3.2 Vorgehensweise – 77 2.3.3 Untersuchungsschritte – 78 2.3.4 Abfassung des schriftlichen Gutachtens – 80 2.4 Empfehlung zur Erstellung eines Gutachtens zur Entziehung der elterlichen Sorge bei Gefährdung des Kindeswohls (§ 1666, § 1666 a, § 1632 BGB) 84 Margarete von Rhein, Renate Schepker, Reinmar du Bois 2.4.1 Analyse des Gutachtenauftrages – 85 2.4.2 Vorgehensweise – 85 2.4.3 Untersuchungsschritte – 86 2.4.4 Abfassung des schriftlichen Gutachtens – 88 2.5 Empfehlung zur Erstellung eines Umgangsrechtsgutachtens 90 Gunther Klosinski 2.5.1 Analyse des Gutachtenauftrages – 91 2.5.2 Vorgehensweise – 91 2.5.3 Abfassung des schriftlichen Gutachtens – 93 2.6 Empfehlung zur Erstellung eines Gutachtens zur zivilrechtlichen Unterbringung Minderjähriger mit Freiheitsentziehung (§ 1631 b BGB) 95 Peter Hummel 2.6.1 Einleitung – 95 2.6.2 Definitionen – 95 2.6.3 Unterlassung der Genehmigung – 96 2.6.4 Das gerichtliche Verfahren – 96 2.6.5 Verfahrenspfleger – 98 2.6.6 Fachärztliche Stellungnahme – 99 2.6.7 Unterbringung mit Freiheitsentziehung (§ 1631 b BGB) in Verbindung mit der Gefährdung des Kindeswohls (§ 1666 BGB) – 100 2.7 Empfehlung zur Erstellung eines Gutachtens gemäß Opferentschädigungsgesetz (OEG) 101 Dieter Felbel 2.7.1 Rahmenbedingungen – 101 2.7.2 Analyse des Gutachtenauftrages – 102 2.7.3 Vorgehensweise – 102 2.7.4 Abfassung des schriftlichen Gutachtens – 103 2.8 Empfehlung zur Erstellung eines Namensänderungsgutachtens 105 Gunther Klosinski 2.8.1 Analyse des Gutachtenauftrages – 107 2.8.2 Vorgehensweise – 108 2.8.3 Abfassung des schriftlichen Gutachtens – 110 2.9 Empfehlung für die Erstellung von Betreuungsgutachten (§§ 65–67 FGG) 112 Renate Schepker, Reinhard Martens 2.9.1 Gesetzlicher Rahmen – 112 2.9.2 Vorgehen im Rahmen der Begutachtung – 114 2.9.3 Schlussfolgerungen für die erforderliche Betreuung und deren Wirkungskreis – 115 2.10 Empfehlungen zur Erstellung eines Gutachtens zur Eingliederungshilfe gemäß § 35 a KJHG 117 Jörg M. Fegert 2.10.1 Einleitung – 117 2.10.2 Vorgehen bei der Erarbeitung einer ärztlichen Stellungnahme zur Hilfeplanung – 118 2.10.3 Hilfen für junge Volljährige – 120 2.10.4 Kein Rückbezug auf die Krankheitskategorien in der Eingliederungshilfeverordnung – 120 2.10.5 Datenschutz – 121 2.10.6 Abweichendes Vorgehen bei Stellungnahmen zum SGB XII – 121 2.10.7 Vorschlag für die Strukturierung einer ärztlichen Stellungnahme zur Planung einer Eingliederungshilfe – 121 2.11 Empfehlung zur Erstellung eines Glaubhaftigkeitsgutachtens 123 Jörg M. Fegert 2.11.1 Einleitung – 123 2.11.2 Aussagevoraussetzungen – 124 2.11.3 Hypothesenbildung „Nullhypothese“ (Konfabulationshypothese) – 124 2.11.4 Anforderungen an die Glaubhaftigkeitsgutachten – 125 2.11.5 Zusammenfassung und Schlussfolgerung – 128 Anhang Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG) 131 Leseprobe: S. 90-94 2.5 Empfehlung zur Erstellung eines Umgangsrechtsgutachtens Gunther Klosinski Der Umgang mit einem Kind wird als hohes Gut angesehen, das mit in der UN-Kinderrechtskonvention verankert ist. Im deutschen Recht sind es nicht nur die Elternteile, sondern auch die Großeltern und Geschwister, die u. a. nach der Kindschaftsrechtsreform vom 1.7.1998 Anspruch auf Umgang mit dem Kind geltend machen können (§ 1685 BGB). Seit dem 30.04.2004 lautet die Fassung des § 1685 BGB (Umgang des Kindes mit anderen Bezugspersonen) wie folgt: (1) „Großeltern und Geschwister haben ein Recht auf Umgang mit dem Kind, wenn dieser dem Wohl des Kindes dient.“ (2) „Gleiches gilt für enge Bezugspersonen des Kindes, wenn diese für das Kind tatsächliche Verantwortung tragen oder getragen haben (sozial-familiäre Beziehung). Eine Übernahme tatsächlicher Verantwortung ist in der Regel anzunehmen, wenn die Person mit dem Kind längere Zeit in häuslicher Gemeinschaft zusammengelebt hat.“ (3) „§ 1684 Absatz 2–4 gilt entsprechend.“ Ein biologischer Vater ist aber vom Umgangsrecht ausgeschlossen, wenn eine andere rechtliche Vaterschaft besteht, und dies auch dann, wenn zwischen dem biologischen Vater und dem Kind eine sozial-familiäre Beziehung besteht oder bestanden hat (BGHBeschluss vom 09.04.2003). Wichtig für den Sachverständigen ist zu wissen, dass mit der Neufassung bzw. mit den Änderungen des VIII. Buches Sozialgesetzbuch (Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz – KICK) in Artikel 1 § 6 der Geltungsbereich der Leistungen der Kinder und Jugendhilfe auch auf Umgangsberechtigte ausgedehnt wurde: So heißt es im § 6 (1): „Leistungen nach diesem Buch werden jungen Menschen, Müttern, Vätern und Personenberechtigten von Kindern und Jugendlichen gewährt, die ihren tatsächlichen Aufenthalt im Inland haben. Für die Erfüllung anderer Aufgaben gilt Satz 1 entsprechend. Umgangsberechtigte haben unabhängig von ihrem tatsächlichen Aufenthalt Anspruch auf Beratung und Unterstützung bei der Ausübung des Umgangsrechts, wenn das Kind oder der Jugendliche seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat.“ Auch in der Neufassung des § 18 (des KICK) wurde die Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge auch auf das Umgangsrecht ausgeweitet. Gerade in Umgangsrechtsauseinandersetzungen muss insbesondere bei Kleinkindern jede Verfahrensverzögerung vermieden werden, da sie eine Entfremdung zwischen dem den Umgang begehrenden Elternteil und dem betreffenden Kind bedeutet, was faktisch zu einer Vorentscheidung führen kann, noch bevor ein richterlicher Spruch ergeht. So wurde eine Untätigkeitsbeschwerde vom Gericht für begründet erachtet, 90 2 „Qualitätssicherung für das Gutachten in der Kinder- und Jugendpsychiatrie“ nachdem das Sachverständigengutachten länger als elf Monate in Anspruch nahm (FamRz 2005, 729). Auch bei Migrationsfamilien, die in Deutschland eine Trennung und Scheidung vollziehen, gilt der § 1685 BGB und die übrigen Gesetze zum Umgangsrecht und nicht das Familienrecht des Herkunftslandes. 2.5.1 Analyse des Gutachtenauftrages Zu klären sind Fragen wie z.B.: D Handelt es sich um eine Umgangsrechtsfrage ausschließlicher Art oder im Rahmen eines gleichzeitig vorliegenden Sorgerechtsverfahrens oder einer Sorgerechtsabänderung? D Hat das Kind zum/zur Umgangsberechtigten oder Umgang Einfordernden bislang eine Beziehung gehabt oder nicht? D Ist mit der Umgangsrechtsfrage im Zivilrechtsverfahren gleichzeitig der Verdacht auf einen sexuellen Missbrauch im Gutachtenauftrag angesprochen? D Handelt es sich um ein Erst- oder Zweitverfahren bzw. um eine Umgangsrechtsabänderung, Einschränkung oder um einen Umgangsrechtsausschluss, der geklärt werden soll? D Wird mit dem zivilrechtlichen Auftrag eine quasi strafrechtliche Fragestellung nach Glaubhaftigkeit verbunden? (Im positiven Falle: Cave – Rücksprache mit dem Gutachtenauftraggeber zur Klärung; vgl. Leitlinie Glaubhaftigkeitsgutachten) D Was hat das Gericht zur Vermittlung im Umgangsstreit bislang unternommen (§ 52 a FGG)? D Sollen spezielle Fragen eines betreuten Umgangs beantwortet werden? D Besteht eine Umgangspflegschaft? Im Rahmen der üblichen Aufklärung (vgl. Präambel) sollte darauf hingewiesen werden, dass eine Interaktionsbeobachtung zwischen dem/der Umgangsbegehrenden und dem Kind in der Regel zu einer ordnungsgemäßen Begutachtung gehört. Ausnahmen könnten allenfalls in einer massiven Gefährdung des Kindeswohls begründet sein. 2.5.2 Vorgehensweise Es empfiehlt sich, die Vorgehensweise des/der Sachverständigen für alle Verfahrensbeteiligten möglichst offen zu gestalten. Dies kann helfen, vorhandenes Misstrauen abzubauen; desgleichen die Mitteilung des Untersuchungsablaufes an alle Verfahrensbeteiligten einschließlich des Familiengerichtes. 2.5 Empfehlung zur Erstellung eines Umgangsrechtsgutachtens Kapitel 2 91 Folgende Untersuchungsschritte haben sich bewährt: D Vor der Exploration und kinderpsychiatrischen Untersuchung des Kindes sollte ein ausführliches getrenntes Gespräch mit den streitenden Parteien (mit jedem einzeln) erfolgen. Wichtige Themen sind die Beziehungsgeschichte, Beziehungsdynamik sowie Lösungsperspektiven und Befürchtungen. D Altersadäquate Information des Kindes, in der Regel im Beisein des/der Sorgeberechtigten und Aufklärung über die Rechte des Kindes sowie über den weiteren Ablauf der Begutachtung (Anspruch des Kindes auf Beratung und Unterstützung bei der Ausübung des Umgangsrechtes nach § 1664 Abs. 1 BGB). D Exploration des Kindes1 . Hierbei ist wichtig: – schulische und soziale Situation (z.B. Freunde, Hobbys etc.) – familiäre Situation – Wünsche, Ängste, psychosomatische Reaktionen in Bezug auf den Umgang D Auswahl und Anwendung psychodiagnostischer/explorativer Verfahren – in Abhängigkeit vom Entwicklungsstand des Kindes und der Fragestellung – insbesondere familiendiagnostische Verfahren, ergänzt durch projektive und weitere angemessene Verfahren zur störungsspezifischen Klärung (vgl. Behandlungsleitlinien AWMF) D Interaktionsbeobachtung und Begegnung zwischen Kind und dem/der Umgangsbegehrenden: Wichtig ist hierbei, dass – der Schutz des Kindes gewährleistet ist, – die Belastung minimiert wird, – auf eine altersangemessene Gestaltung der Begegnung geachtet wird2. D Abschließendes Gespräch (fakultativ): – Mitteilung und Erläuterung der wichtigsten Befunde (Ein Abschlussgespräch zumindest mit dem/der Sorgeberechtigten ist notwendig, wenn behandlungsrelevante Befunde festgestellt werden.) – Diagnostisch kann ein solches Abschlussgespräch dazu dienen, Anhaltspunkte für die Durchführbarkeit der Empfehlung an das Gericht zu gewinnen. Eine schwierige Situation kann sich ergeben, wenn ein Kind sich weigert, mit dem Umgangsberechtigten im Rahmen des Gutachtenprozesses zusammentreffen zu wollen: Der Sachverständige kann dies nicht erzwingen, sollte in einem solchen Fall immer Rücksprache mit dem Gericht halten. Mitunter ist es möglich, dass das Kind eine Drittperson (nicht den sorgeberechtigten Elternteil) akzeptiert, z.B. einen Paten oder eine Patin, die dabei ist, oder auch einen Verfahrenspfleger oder eine vertraute Person von einem früheren begleiteten Umgang. Möglich wäre auch, dass der Sachverständige mit dem Kind in den Räumen des Gerichts und mit dem Gutachtenauftraggeber zusammenkommt und die sorgeberechtigte Person dann gebeten wird, den Raum zu verlassen. Bei Kindern, die den Umgangsberechtigten kaum oder gar nicht kennen, insbesondere wenn es sich um jüngere 92 2 „Qualitätssicherung für das Gutachten in der Kinder- und Jugendpsychiatrie“ Kinder handelt, kann anfangs als Aufwärmphase ein gemeinsames Spiel zwischen Sorgeberechtigtem, Besuchsberechtigtem, Kind und Sachverständigem eingeschoben werden, um dann den Versuch zu machen, dass die sorgeberechtigte Person für eine kurze Zeit den Raum verlässt (eventuell zunächst mit offen stehender Tür, die dann später geschlossen wird). Im Schrifttum wird in jüngster Zeit häufig vom „Parental-Alienation-Syndrome (PAS)“ gesprochen [Gardner 1987] und vom „Besuchsrechts-Syndrom“ [Felder und Hausheer 1993]. Hierbei handelt es sich nicht um klinische Entitäten. Dennoch kann es notwendig sein, auf der Grundlage der erhobenen Befunde die dahinter liegenden Konstrukte3 zu diskutieren. 2.5.3 Abfassung des schriftlichen Gutachtens Folgende vorgeschlagene Gliederung lässt die entscheidungsorientierte gutachterliche Vorgehensweise deutlich werden: D Fragestellung des Gerichtes D Aktenauszug (gedrängte Kurzform, Anknüpfungstatsachen, vgl. auch Präambel) D Exploration der Parteien D Exploration des Kindes/der Kinder D Kinderpsychiatrische Untersuchung des Kindes/der Kinder (psychischer und psychopathologischer Befund, gegebenenfalls orientierend pädiatrischer und neurologischer Befund) D Ergebnisse der psychodiagnostischen und explorativen Testverfahren D Ergebnisse der Interaktionsbeobachtung/en D Zusammenfassende Erörterung und Empfehlung, z.B. unter Berücksichtigung – der Entstehung der Konfliktdynamik – der Situation des Kindes und seiner Beziehungen zu den Parteien etc. D Empfehlungen an das Gericht: – Der Sachverständige muss, will er dem Gericht empfehlen, das Umgangsrecht einzuschränken oder gar auszuschließen, eine „Schädigung“ bzw. Beeinträchtigung des Kindeswohls feststellen. Ein für längere Zeit oder auf Dauer eingeschränkter Umgang oder der Ausschluss eines Umganges kann nur vonseiten des Gerichtes ergehen, wenn andernfalls das Wohl des Kindes gefährdet wäre. Dies bedeutet auch, dass der Sachverständige über die Dauer eines eventuell vorgeschlagenen eingeschränkten Umgangs oder des Umgangsausschlusses Vorstellungen entwickeln muss, das heißt, es wird bei jüngeren Kindern eine Nachbegutachtung zu diskutieren sein oder eine Überprüfung der Situation durch das Jugendamt. Dem ausdrücklichen Willen eines Jugendlichen, der den Umgang mit einem Elternteil ablehnt, wird man in aller Regel Rechnung tragen müssen, sofern es sich um einen altersentsprechend entwickelten Jugendlichen handelt. 2.5 Empfehlung zur Erstellung eines Umgangsrechtsgutachtens Kapitel 2 93 – Interventionsgutachten mit therapeutischem Anspruch, einen Umgang in Gang zu bringen, können nur nach Rücksprache und auf ausdrücklichen Wunsch des Gerichtes erfolgen. D Beantwortung der Fragen des Gerichtes Literatur Arntzen, F (1994) Elterliche Sorge und Umgang mit Kindern. Beck, München Felder W, Hausheer H, Drittüberwachtes Besuchsrecht: Die Sicht der Kinderpsychiatrie zum BGE 119, Nr. 41. Zeitschr. Des Bernischen Juristen-Vereins (1993) 129, 698–706 Gardner RA, Rezent trends in divorce and custody litigation. Academy Forum (Publication of the American Academy of Psychoanalysis) (1985), 29:2, 3-7 Hemminger U, Beck N (1997) Die psychologische Untersuchung im Verfahren zum Umgangs- und Sorgerecht. In: Warnke A, Trott GE, Remschmidt H (Hrsg.), Forensische Kinder- und Jugendpsychiatrie. Ein Handbuch für Klinik und Praxis, 44–55. Huber, Bern Klosinski G (1997) Begutachtung in Verfahren zum Umgangs- und Sorgerecht: Brennpunkte für den Gutachter und die Familie. In: Warnke A et al (Hrsg.), Forensische Kinder- und Jugendpsychiatrie, 34–43. Huber, Bern Klosinski G (1999) Gutachten im umgangsrechtlichen Verfahren. In: Lempp R, Schütze G, Köhnken G (Hrsg.), Forensische Psychiatrie und Psychologie des Kindes- und Jugendalters, 53–64. Steinkopff, Darmstadt Lempp R (1983) Gerichtliche Kinder- und Jugendpsychiatrie. Huber, Bern Anmerkungen 1 Schulkinder wird man in der Regel alleine explorieren und (testpsychologisch) untersuchen können, nachdem diese zuvor im Beisein des/der Sorgeberechtigten über die Aufgaben des Sachverständigen unterrichtet wurden. Kleinkinder und Kindergartenkinder benötigen eine längere Anwärmphase zur Kontaktaufnahme mit dem Sachverständigen im Beisein des Sorgeberechtigten (gemeinsames Spiel), ehe ein Trennungsversuch des Kindes von dem/der Sorgeberechtigen erfolgen kann. Bei Kleinkindern und Vorschulkindern ist das Bindungsverhalten bzw. die Bindungsqualität zu den Elternteilen zu untersuchen. 2 Hier ist zu beachten, dass Vorwürfe vonseiten des/der Umgangsbegehrenden dem Kind gegenüber nicht zugelassen werden, dass keine inquisitorischen Fragen gestellt werden, dass z.B. nicht erlaubt wird, dem Kind Briefe zu übergeben, die das Kind später heimlich unter Ausschluss des/der Sorgeberechtigten lesen soll. Stellt sich heraus, dass der/die Umgangsbegehrende wider aller Beteuerungen eine Drucksituation aufbaut, muss der/die Sachverständige einschreiten oder die Begegnung notfalls auch unterbrechen. 3 Wie z.B. Loyalitätskonflikte etc. |
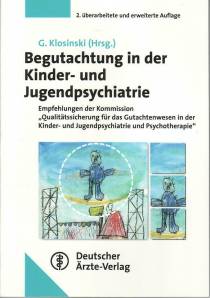
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen