|
|
|
Umschlagtext
Die klassische Methodik historisch-kritischer Exegese legt Wolfgang Fenske in einem didaktisch überzeugenden, aufeinander aufbauenden Schritt-für-Schritt-Verfahren dar.
• Kurzübersicht über die einzelnen Methodenschritte • Ausführliche Darstellung der Methodenschritte • Konkrete Arbeitsaufträge • Anleitungen zum Verfassen von Proseminar- und Seminararbeit Rezension
Ein wirklich gelungenes Exegese-Methoden-Lehrbuch! Hilfreich ist insbesondere die verständliche und didaktisch aufbereitete Darstellungsweise mit konkreten Arbeitsaufträgen und gut gewählten Beispieltexten sowie zusammenfassenden Methodenblättern. Insgesamt findet sich auch einiges Einführungswissen ins Neue Testament. Wer dieses Arbeitsbuch durchgearbeitet hat, sollte mit der historisch-kritischen Exegese methodisch keine Schwierigkeiten mehr haben und den Gewinn der klassischen Methodik einschätzen können. -
Einschränkend kann vielleicht nur angemerkt werden, dass das Arbeitsbuch sich „nur“ mit der klassischen historisch-kritischen Methodik beschäftigt, aber es wäre wohl zu viel für ein einzelnes Lehrbuch, auch die tiefenpsychologische, bibliodramatische, feministische etc. Methodik darzustellen. Thomas Bernhard für lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Dieses Buch ist als Lern-, Lehr- und Arbeitsbuch konzipiert. Die klassische Methodik historisch-kritischer Exegese wird in einem - didaktisch überzeugend - aufeinander aufbauenden Schritt-für-Schritt-Verfahren dargelegt. Der erste Teil des Buches bietet eine Kurzübersicht über die einzelnen Methodenschritte in der neutestamentlichen Exegese. Damit wird dem Anfänger ein erster Zugang ermöglicht, dem Fortgeschrittenen ein knapper Überblick zur Wiederholung geboten. Eine ausführliche Erläuterung jedes Methodenschrittes schließt sich an. Klare Kenntnisse vom exegetischen Handwerk vermitteln ein übersichtlicher Aufbau des Textes, konkrete Arbeitsaufträge und eine Fülle weiterführender Hinweise. Auch den Studierenden wird ein Zugang zur Exegese geboten, für die Neutestamentliches Griechisch nicht zum Lehrplan gehört. Wolfgang Fenkse, geboren 1956, Dr. theol., ist Privatdozent für Neues Testament an der Ev.-theol. Fakultät der Universität München. Inhaltsverzeichnis
I. Einleitung
1. Warum befassen wir uns mit dem Neuen Testament? 13 2. Historisch-kritische Exegese: Voraussetzungen 14 3. Die Bibel: Menschenwort - Gotteswort 17 4. Der Aufbau dieses Buches 20 II. Die Methodenschritte der historisch-kritischen Exegese -Kurzübersicht Vorbereitung 5. Übersetzung und Abschreiben des Textes 23 6. Gliederung des Textes 23 7. Einleitungsfragen 24 Der Text 8. Textkritik - Die Frage nach der Überlieferung des Textes 25 9. Literarkritik - Die Frage nach dem historischen Wachstum des Textes 27 10. Linguistik - Die Frage nach dem grammatischen Aufbau, den inhaltlichen Aussagen und den beabsichtigten Wirkungen des Textes 29 10.1 Syntaktische Analyse 30 10.2 Semantische Analyse 30 10.3 Pragmatische Analyse 31 10.4 Fazit 31 Der Ursprung des Textes 11. Formgeschichte - Die Frage nach der Gemeinde hinter den einzelnen Texten einer Gattung 33 11.1 Die formgeschichtliche Fragestellung 33 11.2 Der »Sitz im Leben« 34 11.3 Gattungsgeschichte 35 12. Überlieferungsgeschichte - Die Frage nach der mündlichen Überlieferung eines Textes 36 13. Die Frage nach dem »Historischen Jesus« 37 Der Hintergrund des Textes 14. Traditionsgeschichte - Die Frage nach der außergemeindlichen und innergemeindlichen Tradition des Textes 41 15. Religionsgeschichte - Die Frage nach dem religiösen Umfeld des Textes und der Personen, die den Text formulieren und tradieren 43 16. Zeitgeschichte - Die Frage nach dem politischen, ökonomischen und kulturellen Umfeld eines Textes 45 17. Soziologie und Sozialgeschichte - Die Frage nach den sozialen Hintergründen des Textes 47 17.1 Soziologie und Sozialgeschichte 47 17.2 Soziolinguistik 49 17.3 Literatursoziologie 50 18. Psychologie - Die Frage nach psychischen Hintergründen bei den Autoren, Rezipienten und Protagonisten eines Textes 51 18.1 Psychologie 51 18.2 Soziopsychologie 54 Die Auslegung des Textes 19. Redaktionskritik/Kompositionskritik - Die Frage nach dem Autor/dem Redaktor eines Textes 55 20. Der Rezipient/die Rezipientin - Die Frage nach den Leserinnen und Lesern, Hörerinnen und Hörern eines Textes 57 21. Wirkungsgeschichte - Die Frage nach der geschichtlichen Wirkung eines Textes 61 22. Hermeneutik - Die Frage nach dem Verstehen und der Weitergabe des Textes 64 22.1 Hermeneutische Fragestellungen 64 22.2 Exkurs: Ansatz der Feministischen Theologie 68 III. Hauptteil Der Text 23. Textkritik und Vergleich von Übersetzungen 71 23.1 Wissenwertes für den Hintergrund 72 23.1.1 Schreibmaterial 72 23.1.2 Datierung von Schriften 73 23.1.3 Schrift 74 23.1.4 Textfamilien und Kategorien 75 23.2 Textkritik am Beispiel Mk 2,1-12 77 23.3 Bibelvergleich 80 24. Literarkritik 82 24.1 Abgrenzung vom Kontext, Brüche usw., Synoptischer Vergleich 82 24.2 Exkurs: Logienquelle Q und Sondergut 87 25. Linguistik 89 25.1 Syntaktische Analyse 89 25.2 Semantische Analyse 91 25.3 Ergebnisse 93 25.4 Pragmatische Analyse 95 Der Ursprung des Textes 26. Formgeschichte 97 26.1 Warum gibt es Gattungen? 98 Exkurs: Mimikry 98 26.2 Aufbau des Wunders Mk 2,1-12 99 26.2.1 Elemente der Gattung Wunder 99 26.2.2 Mischgattungen und andere Gattungsänderungen 100 26.2.3 Untergattungen 101 26.3 Der »Sitz im Leben« einer Gattung 101 26.3.1 Werbung für den Wundertempel 101 26.3.2 Werbung für den Wundertäter? 102 26.3.3 Wunder einmal anders erzählt 104 26.3.4 Der »Sitz im Leben« prägt Texte um 104 27. Überlieferungsgeschichte 105 27.1 Das Verhältnis zwischen mündlichen und schriftlichen Texten 106 27.2 Die Frage nach der mündlichen Tradition hinter Markus 2,1-12 106 27.3 Die Wiege der erzählten Geschichte 108 28. Die Frage nach dem »Historischen Jesus« 109 28.1 Einleitung 109 28.2 Die Kriterien im Einzelnen an Mk 2,1-12 dargestellt 109 28.3 Fazit 113 Der Hintergrund des Textes 29. Traditionsgeschichte 113 29.1 Einleitung 113 29.2 Die Bedeutung der Traditionsgeschichte für Mk 2,1-12 .... 114 29.2.1 Wortuntersuchung 114 29.2.2 Untersuchung von Begriffskombinationen 120 30. Religionsgeschichte 122 30.1 Einleitung 122 30.2 Die religionsgeschichtliche Frage im Zusammenhang von Mk 2,1-12 122 30.3 Religionen und religiöse Strömungen 123 30.3.1 Religionen griechisch-römischer Kultur 123 30.3.1.1 Allgemeine Religiosität 123 30.3.1.2 Mysterienreligionen 124 30.3.1.3 Astrologie und Magie 126 30.3.1.4 Philosophische Frömmigkeit 127 30.3.2 Jüdische Religion 130 30.3.2.1 Allgemeine Frömmigkeit 130 30.3.2.2 Apokalyptik 131 30.3.2.3 Pharisäer, Sadduzäer, Rabbinen 132 30.3.2.4 Qumran 135 30.3.2.5 Josephus 137 30.3.2.6 Philo 138 30.3.3 Gnosis 138 30.4 Religionsgeschichtliche Betrachtung von Mk 2,1-12 139 31. Soziologie/Sozialgeschichte 141 31.1 Soziolinguistik 144 31.1.1 Die Sprache des Neuen Testaments: Das Koine-Griechisch 144 31.1.2 Gruppenspezifische Sprache 145 Die Auslegung des Textes 32. Redaktionskritik/Kompositionskritik 146 32.1 Überblick 146 32.2 Welche Sachverhalte des vorliegenden Textes sind erst aus dem Kontext heraus verstehbar? 147 32.3 Welche Eingriffe durch den Redaktor/die Redaktoren sind im Text erkennbar? 149 32.4 Die Frage nach der Stellung des Textes in dieser Großgattung 151 32.5 Die Frage nach dem Aufbau, der Struktur des Markusevangeliums: Kompositionskritik 151 32.6 Die Frage nach der Großgattung 158 33. Die Frage nach dem Rezipienten/der Rezipientin 159 34. Wirkungsgeschichte 160 34.1 Überblick über die Wirkungsgeschichte von Markus 2,1-12 in den ersten Jahrhunderten 160 34.2 Persönliche Interpretationen 163 35. Hermeneutik 164 35.1 Einige hermeneutische Methoden 164 35.2 Hermeneutik und die bisher dargestellten Arbeitsschritte 165 35.2.1 Hermeneutik und Formgeschichte 165 35.2.2 Hermeneutik und Traditionsgeschichte 166 35.2.3 Hermeneutik und Sozialgeschichte 167 35.2.4 Hermeneutik und Redaktionskritik 168 35.3 Hermeneutik und Übersetzung des Textes in die Gegenwart 169 35.3.1 Einleitung 169 35.3.2 Ein hermeneutisches Viereck 170 35.3.3 Unterschiedliche und gemeinsame Erfahrungen 171 35.3.4 »Acht Fragestellungen« 172 Methodenblätter Methodenblatt I: Vorbereitung der Auslegung 173 Methodenblatt II: Textkritik 174 Methodenblatt III: Literarkritik 177 Methodenblatt IV: Linguistik 179 Methodenblatt V: Formgeschichte 181 Methodenblatt VI: Überlieferungsgeschichte 183 Methodenblatt VII: Die Frage nach dem »Historischen Jesus« 185 Methodenblatt VIII: Traditionsgeschichte 187 Methodenblatt IX: Religionsgeschichte 188 Methodenblatt X: Zeitgeschichte 189 Methodenblatt XI: Soziologie/Sozialgeschichte 190 Methodenblatt XII: Redaktionskritik/Kompositionskritik 192 Methodenblatt XIII: Rezipient/Rezipientin und Wirkungsgeschichte194 Methodenblatt XIV: Hermeneutik 195 Anhang I. Wie verfasse ich eine Proseminar- oder eine Seminararbeit?.... 197 1. Einleitung 197 1.1 Allgemeine Hinweise 198 1.2 Spezielle Tips 201 2. Die Proseminararbeit 203 2.1 Methodenschritte und Sekundärliteratur 203 2.2 Das Schreiben der Proseminararbeit 203 3. Die Seminararbeit 203 3.1 Vorarbeiten und Lesen 203 3.2 Das Schreiben der Seminararbeit 205 II. Literatur in Auswahl und Hilfsmittel 210 1. Literatur in Auswahl 210 2. Hilfsmittel 215 2.1 Hilfsmittel, die Texte entschlüsseln helfen 215 2.2 Hilfsmittel, die in die Zeit neutestamentlicher Autoren einführen 220 2.3 Einführungen und Einleitungen 222 2.4 Theologien 222 2.5 Landkarten 222 2.6 Hilfsmittel, die Literatur nennen 223 2.7 Griechische Ausgaben des Neuen Testaments und Bibelübersetzungen 224 III. Beispieltexte zu Abschnitt II 225 |
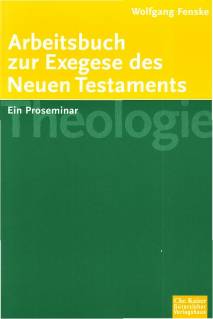
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen