|
|
|
Umschlagtext
Autoren-Informationen
Anton Hergenhan, Jahrg. 1960, ist Dipl.-Psychologe (Studium in Bamberg, Schwerpunkt Klinische Psychologie, Verhaltenstherapie). Seine therapeutische Zusatzausbildung absolvierte er in München (Systemische Individual-, Paar- und Familientherapie). Seit 1992 arbeitet er als Psychologe und Leiter einer teilstationären Einrichtung für verhaltensauffällige Kinder. Seine tägliche systemisch therapeutische Arbeit umfasst die Beratung der Eltern, den kooperativen Austausch mit den Lehrkräften und die familientherapeutische Integration aller an der Erziehung Beteiligten. Verhaltenstherapeutische und Systemische Methoden verbinden sich in seinem Konzept zu einem wirksamen Interventionsprogramm. Beschreibung Kinder beleidigen sich, Kinder schlagen sich: eine Wirklichkeit, die für viele Eltern und pädagogische wie psychologische Fachkräfte zum harten Alltag gehört. Der Autor arbeitet in diesem Alltag. „Verhaltensauffällige“ Kinder werden von ihm und seinem Team in heilpädagogischen Gruppen therapeutisch betreut. „Wie machen Sie das? Bei euch flippt mein Kind nicht aus. Bei mir schon!“ Diese häufig gehörte Elternfrage beantwortet Hergenhan nicht im Stil theoretischer Besserwisserei. Sein erfolgreiches Konzept ist an der harten Erfahrung mit kindlichen Aggressionen gewachsen. Er zeigt ganz konkret auf, wie die elterliche, pädagogische bzw. therapeutische Begegnung mit Kindern so gestaltet werden kann, dass verbale wie tätliche Aggressionen aufhören und stattdessen friedliches Auskommen gelingen kann. Wie spreche ich mit Kindern, die sich beleidigen, brutal aufeinander losgehen und sich schlagen? Diese Frage ist mittlerweile im breiten Feld der Kinderbetreuung zu einem pädagogisch therapeutischen Grundsatzthema geworden. Hergenhan schildert detailliert, wie ein Gespräch mit Kindern systemisch geführt werden kann. „Systemische Methoden sind erfolgreich. Jeder Pädagoge und jeder Psychologe kann das erleben“, behauptet er. In seinem Buch kommen die Kinder und die systemisch arbeitenden BetreuerInnen selbst zu Wort. Der Leser erfährt am Gespräch mit den Kindern, was genau in der Bearbeitung kindlicher Aggressionen systemisch zum Frieden führen kann. Aus dieser Praxis entwickelt der Autor sechs Basalkriterien, die präzise erkennen lassen, worin aus seiner Sicht systemisch therapeutisches Arbeiten überhaupt besteht. Ein Buch, das Mut macht, anregt und Hoffnung verbreitet. Rezension
"Verhaltensauffällige" und "aggressive" Kinder, "schwierige" Familien, ratlose Eltern - Lehrer/innen kennen diese Problematik hinreichend. Eltern fühlen sich zunehmend mit ihren Kindern überfordert; da sagt eine Mutter über ihren 11-Järigen Sohn zu einer Lehrerin: "Ich komme mit meinem Sohn nicht mehr zurecht, vielleicht schaffen Sie es ja ..." "Was soll ich machen, wenn …?" wird zu einer Standardfrage und Ratlosigkeit. Der Autor dieses Bandes stellt fest: „Was soll ich machen, wenn…?“ Diese Frage ist ermutigend, weil in ihr keine Resignation liegt, sondern die Überzeugung, dass es noch nicht zu spät ist, dass etwas gemacht werden kann. Darum ist diese Frage wichtig. Kinder lassen sich gerne (therapeutisch) begleiten und verändern ihr Verhalten positiv, wenn sie ernst genommen werden. Systemisches Gedankengut und systemische Methoden helfen dabei sehr wirksam.
Oliver Neumann, lehrerbibliothek.de Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1 Meine Absichten 7
Kapitel 2 Kurz zu mir 9 Der Praxisschock 11 Gegen die Mutlosigkeit 14 Kapitel 3 Systemische Heilpädagogik – wie wir sie verstehen 17 Basalkriterien 17 Das Heile an der Pädagogik 24 Kapitel 4 Das Symptom 33 Seine Bewältigung 33 Das Gute am Symptom 36 Kapitel 5 Systemisch heilpädagogisches Symptommodell 41 Kapitel 6 Die Sache mit dem Arbeitsauftrag 45 Kapitel 7 Symptom und systemische Heilpädagogik: Eine therapeutische Begegnung 49 Kapitel 8 Präsenz in Hochpotenz 105 Kapitel 9 Die Wut der Erwachsenen 109 Kapitel 10 Emotionale Undeutlichkeit: Siddhartas pädagogische Bedrängnis 113 Kapitel 11 Dieser Schmerz wird dir einst nützen 117 Literatur 123 Hinweis 127 Leseprobe: Kapitel 4 Das Symptom Seine Bewältigung Seit ich heilpädagogisch arbeite, begegne ich verbalen Aggressionen in kontinuierlicher Wiederkehr und in einer Häufigkeit, die mich anfangs fast kapitulieren ließ (s. o.). Es mag äußerst aufschlussreich sein, während der Schulpausen auf Schulhöfen der spontanen Sprache der Kinder zuzuhören: Nicht selten entladen sich Kaskaden von Grobheiten an den Lippen der Schüler. Aus, wie mir scheint, geringfügigsten Anlässen bewerfen sie sich mit übelsten Beleidigungen. Der erste Eindruck diktiert überdies, dass diese Beleidigungen gar nicht als Beleidigungen empfunden werden. Kinder finden es offenbar völlig okay, dass sie sich „Hurensohn“, „Wichser“ oder „Motherfucker“ nennen. Sein „Maul“ hat der andere zu halten, „wenn der nervt“. Die Kinder denken nicht daran, so möchte ich zunächst meinen, dass sie sich mit solcher Sprache entwürdigen und weh tun könnten! Scheinbar unbeschwert poltert schwerstes Geschütz. Der Unbeschwertheit, der Unbekümmertheit dieses Polterns, so gebe ich zu, vertraue ich allerdings nicht mehr. Aus der systemisch therapeutischen Arbeit mit unserer jungen Klientel gewinne ich vielmehr die Überzeugung: Kinder entwürdigen sich mit solcher Sprache! Nicht nur mir geht es schlecht, wenn ich Kinder erlebe, die so schäbig miteinander umgehen. Ich glaube, dass ihnen selbst solche Sprache nicht gut tut, mögen sie auch scheinbar souverän das Gegenteil versichern! Mein Misstrauen speist sich aus der Tatsache, dass Kinder immer wieder zeigen, wie schnurgerade verletzende Sprache zu Frustrationen führt und weitere Aggressionen provoziert. Ich meine darum: Heilpädagogisches Arbeiten kann therapeutisch fruchtbar an der Sprache ansetzen, weil die Sprache über die Qualität der Beziehungen entscheidet, die Kinder knüpfen und gestalten. Sprache ist elementares Sozialverhalten, Sprache definiert Beziehungswirklichkeit, Sprache stiftet Systeme, Sprache baut auf, kann aber auch zerstören. Was ich da eben schreibe, liest sich vielleicht rigoros. Darum will ich meinen Standpunkt kritisch reflektieren, dem möglichen Widerspruch Raum geben und gegen mich selbst opponieren. Der Leser meiner Zeilen muss die hier vertretene Auffassung ja keineswegs teilen und kann fragen: Warum sollen Kinder nicht reden dürfen, wie sie wollen? Was ich Kapitel 4 Das Symptom 33 als sprachliche Verwahrlosung betrachte, ist in den Augen der Kinder vielleicht „normal“. Jeder ist seiner Wirklichkeit Schmied, wie die Konstruktivisten, an denen sich die Systemiker gerne philosophisch auftanken, nicht müde werden zu unterstreichen. Wenn Sandro den Bernhard „blöde Drecksau“ nennt, weil dieser ihn von der Schaukel gestoßen hat, dann ist Sandro gerade dabei, das heiße Eisen seiner Selbstbehauptung, seiner Wirklichkeit zu formen. Woher nehme ich das Recht, mit meinem subjektiven Realitätssinn die Schmiedekunst Sandros zu diskreditieren? Woher nehme ich das Recht, Sandros Reaktion auf den tätlichen Angriff Bernhards als Ausdruck sprachlicher Verkommenheit zu verunglimpfen? Wenn die Kinder Lust haben, sich „das Maul“ zu verbieten und nicht den Mund, haben sie eben Lust dazu. Meine Sprachmoral sollte bei mir bleiben, sie ist restaurativ, konservativ und systemisch vielleicht sehr fragwürdig. Der Therapeut hat sich zurückzuhalten. Was fällt ihm ein, vorschnell einen Interventionsanlass zu identifizieren? Was Pädagoginnen bzw. Therapeuten heilpädagogisch tun, ist grundsätzlich die Folge einer Bitte um Hilfe. Wer formuliert diese Bitte eigentlich hinsichtlich jener Not, die sich im Sprachstil der Kinder mitteilt? Not? Nochmals eins drauf und wiederholt: Genug Kinder versichern lachend auf empörte Erwachsenenfragen, sie verbieten sich lieber das „Maul“ als den Mund. Symptom? Genug Kinder sind ausdrücklich nicht der Auffassung, es sei an ihrem Sprechen ein Symptom festzumachen. Tobi (11 J.), der seiner Mutter gleich am Morgen beim Wecken hinknallt, sie sei eine „doofe Pennerin“ und sie solle sich „verpissen“, weil er noch schlafen wolle, denkt nicht an Veränderungsnotwendigkeiten. Ich habe im Erstgespräch mit Tobi selbst erfahren, dass für ihn die Zerstörung der Morgenstimmung völlig in Ordnung sei. Er hat mir kein Therapiemotiv signalisiert und meinte nicht, dass ein Therapeut in seinem Leben irgendeine Zuständigkeit hätte und interventorisch handeln könnte. Er zeigte sich mit sich selbst „d´accord“. Wir berühren mit der Erwähnung von Tobis Haltung ein Thema, das im Spannungsfeld zwischen Individualismus und den Ansprüchen des sozialen Kontextes, also der Umwelt, liegt. Der radikale Individualist meint, für ihn sei das real und okay, was er für real und okay halte, nichts anderes. An diesem Standpunkt schätze ich, dass er Ich- bzw. Eigeninteressen für legitim hält. Ein Individualist steht zu dem, was er will, und erlebt sich gewiss weitgehend unabhängig von anderen. Er wird mir vielleicht entgegenhalten, Tobis Einstellung sei zu achten und wenn für ihn diese Wehr gegen die mütterliche Störung der 34 Kapitel 4 Das Symptom Morgenruhe passt, dann passt sie eben. Kann sein, dass ich auch den oft anlassvariabel zitierten Satz Friedrich des Großen höre, jeder solle nach seiner Fasson glücklich werden. Der Alte Fritz forderte mit diesem Satz in Preußen religiöse Toleranz. Von mir könnte man mit diesem Zitat heilpädagogische, therapeutische, psychologische Toleranz fordern. Ich ende an dieser Stelle meine Anwaltschaft gegen mich und will verkürzend festhalten: Radikaler Individualismus wird an der Tatsache brechen, dass wir nicht allein sind. Tobi ist nicht allein, und sobald seine Mutter am Morgen das Zimmer betritt, wird für ihn unmittelbar erlebbar, was Ludewig mit dem „systemischen Prinzip“ auf den Punkt bringt: „ … dass Menschen mindestens zu zweit vorkommen. Menschen werden zu Menschen nur unter Menschen“ (2005, S.166). Und die Menschen kommen nun mal auch in kritischen Kontakt, wie die Mutter von Tobi im Gespräch mit mir berichtete. Deswegen bat sie um Hilfe: Für sie war nicht okay, dass Tobi sie am Morgen beleidigte. Sie hatte außerdem den Wunsch geäußert, ihr Sohn möge sich „gut entwickeln“. Das war für sie okay: Sie wollte, dass er beziehungsfähig würde und meinte nicht, er könne „tun und lassen, was er will“. Zwei „Okays“ kollidierten. Welches Okay hatte Vorrang? Vielleicht mag meine Position rabiat klingen: Vorrang hatte eindeutig und ohne den leisesten Zweifel das Okay der Mutter! Die Eltern haben die Verantwortung für die gedeihliche Entwicklung ihres Kindes. Und die werden ihren Anspruch auf würdevollen Umgang nicht aufgeben, wenn sie wollen, dass ihre Töchter und Söhne lernen, wie Menschen miteinander gut auskommen können. Ich wiederhole mich: Ein Kind hat Anspruch auf Führung und auf Information über seine Welt, es ist kein Erwachsener! Mit Rücksicht darauf formulieren in therapeutischen bzw. heilpädagogischen Zusammenhängen das Ersuchen um Hilfe zumeist die Eltern, die Lehrkräfte oder die Jugendämter, Erwachsene also. Damit kann es aber sein Bewenden nicht haben! Denn das Kind darf von dieser Hilfe nicht überfahren werden. Heilpädagogische Praxis, die sich im Respekt vor dem Kind übt, muss das Kind als Mitarbeiter begreifen und das, was Erwachsene gut begründet wollen, mit ihm zusammen akzeptabel aufbereiten. Die Pädagogin, die systemisch therapeutisch handelt, kann sich dabei gern von einer hilfreichen Vorannahme leiten lassen: Für dich selbst, Tobi, ist dieser Tagesbeginn nicht okay. Deswegen unterstelle ich, es ginge dir besser, wenn du deine Mutter am Kapitel 4 Das Symptom 35 Morgen freundlich anreden würdest. Wohlgemerkt: Das ist eine Vorannahme, die dem Kind so nicht vorgetragen werden darf, weil sie Tobis Position, wie er sie zunächst überzeugt formuliert, respektlos übergehen würde. Die therapeutisch arbeitende Pädagogin wird überprüfen, ob im Dialog mit dem Jungen ihre Vorannahme Chance zur Gültigkeit erhält. Diese Gültigkeit zertifiziert der Klient, das Kind, kein anderer. Ist das geschehen, können methodisch gangbare Wege beschritten werden: Tobi konnte im Rollenspiel selbst ausprobieren und spüren, dass er sich wohler fühlt, wenn er seine Müdigkeit anders formuliert und seine Mutter dabei nicht niedermacht. Er hat seine Mutter lieb, wie er überzeugend zusicherte. Was mir Tobi mitteilte, ist elementar: Seine problematische Sprache am Morgen stand in eklatantem Widerspruch zu dem, was sich in seinem psychischen Innenraum abspielte, so gab er zu erkennen. Deswegen noch einmal ein Blick auf die Schulhofszenen. Vorhin kam der Eindruck aufs Papier, die Opfer verbaler Gewalt empfänden sich vielleicht gar nicht als Opfer. Genau diesen Eindruck haben die scheinbar Empfindungslosen in meiner Arbeitspraxis längst und für mich unmissverständlich berichtigt. Aus der Begegnung mit „coolen“ Kindern, denen die Titulatur „Motherfucker“ nicht an die Seele zu gehen schien, habe ich viel gelernt: Schimpfwörter prallen an der „Coolness“ der Beschimpften keineswegs ab. Ich vergesse die Tränen eines „coolen“ Kindes nicht, das mir im Einzelgespräch versicherte, es habe seine Mutter „nie gefickt“ und werde sie „nie ficken“. Kinder, die so mit mir reden, verbieten mir jene Toleranz, mit der ich an dieser Stelle wertneutral bleiben könnte: Die verbale Niveaulosigkeit, mit der Kinder sich schwer belasten, indiziert akuten therapeutischen bzw. heilpädagogischen Handlungsbedarf! Das Symptom giert nach Veränderung. Das Gute am Symptom Jetzt wird’s aber spannend. Erwähnte ich oben als viertes heilpädagogisches Basalkriterium nicht die „positive Beachtung des Symptoms“? Hat mich nicht systemischer Eifer beseelt, als ich das Symptom von seinem pathologischen Kainsmal befreien wollte und Respekt vor ihm einforderte? Jetzt auf einmal behaupte ich, ich ließe mir angesichts des Symptoms sogar Toleranz verbieten. Ich merke, wie mir dieser Punkt „Wertung des Symptoms“ auch persönlich auf den Nägeln brennt. Ich musste in der Begegnung mit systemischen 36 Kapitel 4 Das Symptom Gedanken im Hinblick auf diese Thematik am meisten mit mir und meinen bisherigen Positionen ringen. Das Symptom schlicht negativ zu kategorisieren, vereinfacht den Befund, ist mit wenig reflektorischem Aufwand verbunden. Aber, und das habe ich mittlerweile oft erlebt, dieser Symptomnegativismus erschwert den Zugang zum Symptomträger, zum Klienten, zum Ratsuchenden. Also gilt es, das Gute am Symptom zu destillieren und zum Thema zu machen. Selten gelingt das fix und flink. Denn das Symptom kann und darf nicht im Sinne theatralischer Denk-positiv-Diktatur schön geredet werden. Das wäre respektlos, wie Hargens betont. Im Symptom liegt Leiden, liegt Störendes. Diese Spannung, ein Symptom nicht in jedem Fall und nicht gänzlich als etwas Konstruktives werten zu können, kennen die Systemiker. Von Schl ippe und Schweitzer erwähnen es unumwunden im Zusammenhang mit Kindern, die untertags einkoten (Enkopresis). White, so schildern sie, habe mit der Externalisierungstechnik ein Kind dazu eingeladen, das Einkoten als „Sneaky Poo“, als Dreckmacher, zu personifizieren. In der Externalisierungstechnik bekommt das Problem einen Namen, wird ein jemand, vom Kind abgelöst und zum diskutierbaren Gegenüber. Therapeutische Gespräche thematisieren dann nicht mehr primär das einkotende Kind, sondern den Dreckmacher und die Überlegung, wie er „besiegt“ werden könne. Genau darin liegt der große therapeutische Gewinn: Nicht mehr das Kind belastet sich und seine Umwelt, sondern der Dreckmacher. Ich habe diese Externalisierungstechnik selbst schon Kindern derselben Symptomatik (Einkoten) in der Kleingruppe angeboten und die Erfahrung gemacht, dass Schuldgefühle schnell weichen und die Bewältigbarkeit des Dreckmachers zur spannenden oder gar lustigen Geschichte werden kann. Aus braunen Legosteinen ließ sich dieser Dreckmacher greifbar darstellen und wurde damit zum konfrontierten Gegenüber. Wir diskutierten mit ihm, dem „Stinker“, und überlegten gemeinsam, wie er sich im Alltag so „benehmen“ könnte, dass er nicht mehr stört. Diese „Unterhaltung mit dem Problem“ wirkte durchaus erheiternd. Ein Junge ging noch am selben Tag und die darauf folgenden Wochen mit der Bemerkung auf die Toilette, er werde „dem Stinker schon zeigen, wo er hingehört.“ Mit dieser Externalisierungstechnik, die der Junge dann selbst anwandte, hielt er sein Selbstbild stabil und fühlte sich aktiv handlungsfähig. Systemiker halten sich im Hinblick auf den Umgang mit dem Symptom erfrischend flexibel, wiewohl von Schl ippe und Schweitzer angesichts des Dreckmachers vermerken: „Aber Kapitel 4 Das Symptom 37 das Problem selbst wird als etwas nur Negatives, Schlechtes, Böses, zu überwindendes beschrieben – es soll beseitigt werden. Dies widerspricht dem Selbstverständnis systemischer Therapie und Beratung, alle Phänomene in einem System als zumindest auch sinnvoll für dessen Selbstorganisation anzusehen. … Mit der Externalisierung, wie White sie verwendet, entscheidet man sich für eine Perspektive, die das Problem möglichst beseitigen möchte“ (2003, S. 172). Nicht nur White frevelt an diesem systemischen Dogma. Auch Pleyer schildert aus seiner systemisch therapeutischen Praxis beispielsweise, wie die Neigung des Kindes, Unordnung im Kinderzimmer zu hinterlassen, externalisiert werden kann, „sodass sich Eltern und Kind gegen die fiktive Instanz verbünden können, die die Unordnung verursacht.“ Die Möglichkeit, „einen gemeinsamen Feind zu erschaffen“, kann mit der „Täterbeschreibung“ einhergehen. Das „Chaosmonster“, so der systemische Taufname der Unordnung, wird mit einem „Steckbrief“ dingfest gemacht (2005, S. 144 f). Diese Externalisierungsideen finde ich super, weil sie Kinder nicht mehr als Symptomträger und Indexpatienten brandmarken, sondern als Personen gelten lassen, die ihre Probleme außerhalb ihrer Identität identifizieren. Dadurch können sie angesichts ihrer Schwierigkeiten zu Beobachtern und Managern werden. Nicht mehr das Problem macht mit ihnen etwas, sondern sie machen mit ihrem Problem etwas: Sie schauen und packen es an. Was aber nun mit dem Symptom, das ja als Phänomen „in einem System als zumindest auch sinnvoll für dessen Selbstorganisation anzusehen“ sei (s. o.)? Ich mache im systemisch heilpädagogischen Kontakt mit Kindern die Erfahrung, dass das Symptom seinen Sinn bzw. seinen Wert behalten kann, auch wenn sich Therapeut und Klient auf seine steckbriefliche Fahndung einigen. Das Eine muss nicht im Widerspruch zum Anderen stehen. Mit Kindern zusammen lässt sich hervorragend Symptomanalyse betreiben. Im Symptom selbst liegt nicht nur Problematisches und nicht nur Konstruktives. Kinder wissen das und können das hervorragend im Dialog ermitteln. Gehen wir sofort in die Konkretion. 38 Kapitel 4 Das Symptom |
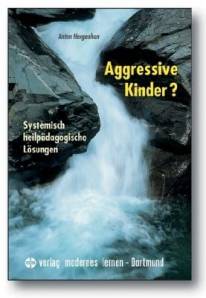
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen