|
|
|
Umschlagtext
Kaum eine Literaturgattung hat so widersprüchliche Wertungen und Analysen erfahren wie das Märchen und ist so geeignet, die Schwächen jedweder Gattungspoetik zu veranschaulichen. Dieses Buch geht der Frage nach dem Vorkommen des Märchens von der Antike bis ins 20. Jahrhundert nach und stellt gattungstheoretische Überlegungen zu Texten von Homer bis Kafka an. Sie zeigt, daß sich Märchen und Mythos als zwei Erzählmöglichkeiten durch mehrere Begriffsoppositionen in wechselseitige : Bestimmung zueinander setzen lassen: Zwang vs. Freiheit, Untergang vs. Überleben, Terror vs. Spiel. Aus diesem Ansatz, dem u.a. Walter Benjamin den Weg geebnet hat, ergibt sich, daß ein wesentlicher Bestandteil des Sinns des Märchens gerade in seiner Differenz zum Mythos zu identifizieren ist: Das Märchen protestiert gewissermaßen gegen eine mythische Weltsicht und bietet ein optimistischeres Verständnis der Welt an. So gesehen kann seine Botschaft die immer mögliche, aber vom Mythos verdrängte Option einer Befreiung aus diesem sein.
Rezension
Diese Heidelberger Dissertation in orientalistischer und altertumswissenschaftlicher Perspektive geht auf ein Studium der Verfasserin an der Stanford University Mitte der 1990er Jahre zurück und thematisiert die zwischen Märchen und Mythos bestehende begriffliche Unschärfe, die sich aus der allgemeinen Auffassung speist, die beiden ließen sich schwerlich differenzieren. Diese Lücke sucht die Arbeit zu schließen und fußt auf Walter Benjamins Andeutungen zum Märchen als der "Überlieferung vom Sieg über den Mythos". Die Studie untersucht ausgewählte Passagen antiker und moderner Literatur von Homer bis Kafka. Einbezogen werden Erkenntnisse der Märchenforschung sowie die pädagogischen und geschichtsphilosophischen Horizonte Bruno Bettelheims und Walter Benjamins.
Thomas Bernhard, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Von der Antike bis ins 20. Jahrhundert Aus komparatistischer und altphilologischer Sicht Mythos und Märchen anhand von Begriffsoppositionen Mit Sach- und Wörterregister und Literaturverzeichnis Märchen oder Mythos? Worin liegt der Unterschied? Die Autorin untersucht Texte von der Antike bis ins 20. Jahrhundert, z. B. Kafka und Benjamin, und grenzt Märchen und Mythos als zwei verschiedene Erzählmöglichkeiten voneinander ab. Eine wichtige Studie für Komparatistik, Literaturgeschichte und Altphilologie. Almut-Barbara Renger, Studium der Komparatistik, Germanistik und Klassischen Philologie in Berlin, Thessaloniki/Griechenland und Stanford/Kalifornien. Promotion in Heidelberg. Derzeit Wissenschaftliche Assistentin am Lehrstuhl für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft der Universität in Frankfurt am Main. Forschungsschwerpunkt: Mythen, Legenden, Idole und Ikonen. Arbeiten auf den Gebieten der Gattungstheorie, Poetologie, Narratologie, Wissenschaftsgeschichte und v.a. Antikerezeption. Inhaltsverzeichnis
Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XVII
TEIL I Gattungstheoretische Überlegungen. Märchen und Mythos im Vergleich A. Mythos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1. Mythen, Mythos, mythisch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2. Hans Blumenbergs »Arbeit am Mythos«: Verschiebung vom Terror zum Spiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3. Arbeit am Mythos in der »Odyssee« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 B. Märchen 1. Zur Geschichte des Märchens: Wege und Wurzeln seiner Erforschung . . . . . . . 13 1.1 Anfänge und Herausforderungen der Märchenforschung: Modelle und Schwierigkeiten der Altersbestimmung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 1.2 Von »alter Weiber tant« zum »Canon der Poësie«: Karriere eines Erzählgenres . . . 20 1.3 »Spinnmärlein« und »Ammenmären«: Tradition eines despektierlichen Sprachgebrauchs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 1.3.1 Verweis in die »Spinn«-Stube aufgrund provokativer Eigenheiten . . . . . . . . . . . 23 1.3.2 »Ammenmärchen« im 18. Jahrhundert: Vokabular zur Rechtfertigung eigener Märchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 1.3.3 »Ammen-mu'qoi« bei Platon: Vokabular zur Rechtfertigung eigener mu'qoi . . . . . 26 2. Vom mythos graon/tithon über die fabulae aniles/nutricularum zum »altvettelischen Mährlein«/»Ammenmärchen«: Geschichte eines Verdikts . . . . . 27 2.1 Platon: Prägung des Verdikts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 2.1.1 Der Vergleich mit Ammen und »alten Weibern«: Eine rhetorische Figur der Abwertung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 2.1.2 Das Unwerturteil über »Altweiber«- und Ammen-mu'qoi in der Dichterkritik des »Staats« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 2.1.3 Plat. rep. 377a–c – mythos in der Übersetzung: Zur Wahl des Begriffs »Märchen« vor dem Hintergrund Grimmscher Zensur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 2.1.4 Vergleich der mu'qoi der Ammen mit denen Homers und anderer Dichter: Erfindung, Schwindel, Lüge (pseudos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 2.2 Von Cicero bis Macrobius: Die fabulae aniles/nutricularum in floskelhafter Verwendung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 2.2.1 Tacitus: Pädagogik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 2.2.2 Cicero und die christlichen Autoren: Philosophie und Religion . . . . . . . . . . . . 40 2.2.2.1 Cicero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 2.2.2.2 Minucius Felix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 2.2.2.3 Arnobius, Lactantius, Prudentius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 2.2.3 Macrobius: Gattungstheorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 2.3 Bilanz: Die antiken Altweiber- und Ammengeschichten in ihrem Verhältnis zum Märchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 3. Das Märchen in der Klassischen Philologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 3.1 Friedrich Gottlieb Welcker: »Dem Hellenischen Geiste fremd« – Märchen für Kind und Pöbel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 3.2 Von Ludwig Friedländer bis Graham Anderson: Von den Anfängen im 19. Jahrhundert bis zum 21. Jahrhundert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 3.3 Das Märchen in der Homerforschung des 19. Jahrhunderts . . . . . . . . . . . . . . . . 58 3.3.1 Georg Gerland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 3.3.2 Ferdinand Bender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 3.4 Das Märchen in der Homerforschung des 20. Jahrhunderts . . . . . . . . . . . . . . . . 63 3.4.1 Ludwig Radermacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 3.4.2 Uvo Hölscher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 C. Märchen und Mythos: Unterschiede und Gemeinsamkeiten 1. Demarkationslinien: Der Vergleich von Märchen und Mythos in der Märchenforschung des 20. Jahrhunderts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 1.1 Bruno Bettelheim: »Kinder brauchen Märchen« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 1.1.1 »Märchen versus Mythos«: »Optimismus versus Pessimismus« . . . . . . . . . . . . . . 72 1.1.2 Märchen sind suggestiv, Mythen direktiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 1.2 Friedrich von der Leyen: Das Märchen, »die verspielte Tochter des Mythus« . . . . 74 1.2.1 Das Nebeneinander von Märchen und Mythos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 1.2.2 Das Phantastische und Spielerische des Märchens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 1.3 Friedrich Panzer: Die integrale Ausdeutung der Märchen – »ein völlig verfehltes Unternehmen« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 1.3.1 Mythos und Märchen: Glaube und dichterische Freiheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 1.3.2 Märchentexte: Geschichtsquellen ohne hermeneutischen Wert . . . . . . . . . . . . . 80 2. Märchen vs. Mythos – Spiel vs. Ernst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 2.1 Im Märchen nicht vorhanden: Die sakrale und normative Dimension der Legenden und Mythen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 2.2 Beispiel 1: »Die weiße Schlange« (KHM). Ein reines Märchen . . . . . . . . . . . . . . 85 2.2.1 Religiöse Elemente als parergonales Ornament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 2.3 Beispiel 2: »Das Marienkind« (KHM). Ein zur Moralpredigt verchristlichtes Märchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 2.3.1 Eine frühe Variante bei Basile: Erlösungsmärchen ohne christliche Schwere . . . . 89 2.3.2 Dunkelheit des Sinns vor der christlichen Aufladung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 2.4 Beispiel 3: »Philemon und Baucis« (Ovid) und »Der Arme und der Reiche« (KHM). Mythos und märchenhafte Beispielerzählung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 2.4.1 Der unterschiedliche Bezugsrahmen der Geschichten: »Kinder- und Hausmärchen« – »Metamorphosen« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 2.4.2 Unterschiede der Geschichten selbst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 2.4.3 »Philemon und Baucis«: Poetische Manifestation mythischen Terrors . . . . . . . . 98 3. Bilanz: Märchen und Mythos – Unterschiede und Gemeinsamkeiten . . . . . . . 99 3.1 Märchenhafte Leichtigkeit: Dichtung als paidiav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 3.2 Mythische Gebundenheit: Vorstellung eines alles durchwaltenden Schicksals . . . . 102 3.3 Glück und Schwerelosigkeit: Der Unterhaltungswert des Märchens . . . . . . . . . . 103 D. Struktur der Märchen 1. Gleiche Formeln und Grundbausteine in Märchen und Mythos. . . . . . . . . . . . 106 2. Vladimir Propp: Das Märchen – von kultischer Praxis zu strukturell bedeutsamer Fiktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 2.1 »Morphologie des Märchens«: Zerlegung der syntagmatischen Textebene in »Funktionen« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 2.1.1 Struktur und Schema der Zaubermärchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 2.1.2 Variable und invariable Elemente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 2.1.3 »Tyrannei der Serie« (Bremond): Propp in der Kritik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 2.1.4 Das Märchen: In seinen morphologischen Grundelementen ein Mythos . . . . . . 115 2.2 »Die historischen Wurzeln des Zaubermärchens«: Versuch eines Rückgangs zum Ursprung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 2.2.1 »Sinnverdunkelung« (Menninghaus) als gattungschaffendes Konstituens . . . . . . . 117 2.2.2 Riten und Mythen: »Schlüssel« zum Märchen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 3. Sinn- und Verstehensentzogenheit der Märchen: Dichtung als von mythischem Terror freies Regel-Spiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 4. Eleasar Meletinsky: Semiotisch-strukturale Analyse von Märchen . . . . . . . . . . . 121 4.1 Mythos und Märchen : Kontrastbestimmungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 4.2 Der oppositionelle Aufbau des Märchens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 4.3 Die »Spielregeln« des Märchens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 E. Der »Spiel«-Charakter der Märchen 1. Das »Spiel« als Chiffre für künstlerisches Schaffen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 1.1 »... fast unanständig fruchtbar« (Matuschek): Die Anschlußfähigkeit des Spielbegriffs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 1.2 Über Kant und Arnold Gehlen zum Märchen: Eine anthropologische Verankerung des Regel-Spiels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 1.3 Die Regel-Freiraum-Verschränkung im Spiel: Bezug zum Märchen . . . . . . . . . 133 1.4 »Dichtung als Spiel«: Über Schiller und Novalis zur Nonsense Poetry . . . . . . . . 134 2. Terror, Zwang, Ernst – Poesie, Freiheit, Spiel: Zu »Antinomien der Mythosschätzung« (Marquard) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 TEIL II Von Homer zu Apuleius. Märchen und Mythos im Altertum A. Märchenerzählungen im Altertum? 1. Nach dem Bruch der Einheit von Folklore und Literatur: Zur Dialektik von Mündlichkeit und Schriftlichkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 1.1 Mündlichkeit: Außerliterarische Erzähltraditionen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 1.1.1 Vortrag, Rede und Rezitation als Kommunikationsmedien . . . . . . . . . . . . . . . . 149 1.1.2 Geschichtenerzähler und Kindergeschichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 1.1.3 Blockierung von Schriftlichkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 1.2 Zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit: Rekonstruierbare Märchenerzählungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 1.2.1 Melampus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 1.2.2 Perseus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 1.2.3 Herakles, Peleus, Bellerophon, Argonautensage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 1.2.4 Strukturelemente der Rekonstruktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 1.3 Schriftlichkeit: Einfache Geschichten in Epos und Roman . . . . . . . . . . . . . . . . 170 1.3.1 Verhältnis von epischer Groß- und erzählerischer Kleinform . . . . . . . . . . . . . . . 171 1.3.2 Das Märchen als Kleinform innerhalb von Epos und Roman: Hom. Od. 9–12 und Apul. met. 4, 28–6, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 1.3.3 Erzähltechnische Gemeinsamkeiten und Unterschiede: »Apologoi« (Homer) und »Amor und Psyche« (Apuleius) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 1.3.3.1 Stellung des Erzählers zum Geschehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 1.3.3.2 Erzählgrammatik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 1.3.3.3 Ort des Erzählens, Ebenen, Verknüpfungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 1.3.3.4 Subjekt und Adressat des Erzählens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 1.3.3.5 Motivierungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 2. Der griechische Liebes- und Abenteuerroman: Expandierte Märchenerzählungen in historischem Gewand . . . . . . . . . . . . . . . 180 2.1 Strukturelle Interferenzen zwischen Märchen, Epos und Roman . . . . . . . . . . . . 182 3. Aniles fabulae in Apuleius’ »Metamorphoses«: Ein in den Roman eingelegtes »Märchen« von Amor und Psyche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 3.1 Amor und Psyche in der Forschung: Von den Zwängen symbolischer und allegorischer Deutung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 3.2 Amor und Psyche ohne Zutat von Sinn: Zweigliedrige Märchenstruktur der Erzählung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 3.2.1 Weitere Märchenmerkmale der eingerahmten Geschichte . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 3.2.2 Die Geschichte einer exemplarischen Märchenerzählerin: Epischer »Rat« (Benjamin) gegen den Schrecken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 3.2.2.1 Narrationes lepidae und aniles fabulae: Aussicht auf »rettungsbringende Hoffnung« 195 3.2.2.2 Die bella fabula eines ekelhaften alten Weibes: Ein märchentypischer Kontrast . . . 197 B. Odysseus’ Abenteuer-Erzählung: Märchen versus Mythos 1. Epischer »Rat« in der »Odyssee«: Odysseus bei den Phaiaken: . . . . . . . . . . . . . . 201 2. Die »Apologoi«: Märchenhafte Erlösung von mythischen Bedeutungszwängen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 2.1 Sinn-Suspension durch den irreversiblen Verlust des Ursprungs der »Apologoi« 203 2.1.1 Allegorische Positionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 2.1.2 Analytische/unitarische Positionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 2.1.3 Der spezifische Mischcharakter der »Odyssee« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 2.1.4 Indifferenz der »Apologoi« gegen Deutungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 2.2 Sinn-Provokation durch die strukturalen Besonderheiten der »Apologoi« . . . . . 209 2.2.1 »Motivation von hinten« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 3. Erzählen als organisierte Angelegenheit: Zur Struktur und Funktion der Irrfahrten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 3.1 Symmetrie und Rhythmus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 3.2 Struktur und Funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 3.3 Erzählsituation und Erzählziel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 4. Die strukturelle Basisaktion der »Apologoi«: Verlagerung von Machtpositionen, Bannung von Gewalt und Terror . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 4.1 Die Spielregeln der »Apologoi« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 4.2 Fortgang der Handlung durch »Vorschreiten vom Minus zum Plus« . . . . . . . . . . 226 4.3 Die Verbotsepisoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 5. Die Konstellation von Märchen und Mythos in der strukturellen Gesamtkomposition der »Apologoi« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 5.1 Die Prä-»Nekyia«-Episoden: Odysseus als mythischer Heros . . . . . . . . . . . . . . . 232 5.2 Die Post-»Nekyia«-Episoden: Odysseus als Märchenheld . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 5.2.1 Wandlungen: Odysseus bei Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 5.2.2 Märchenhafte Entmachtung mythischer Gewalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 5.3 Die Versuchungsepisoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 5.3.1 Die Lotophagenepisode im Vergleich: Vergessen als Resultat einer Verzauberung 240 5.3.2 Kalypso und Kirke im Vergleich: Liebesgram und Liebeslust . . . . . . . . . . . . . . . 242 6. Die »Nekyia«: Fall in die Isolation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 C. Die Sirenenepisode im Kontext der »Apologoi« 1. Sirenenlied – Abenteuer-Erzählung – Epos: Von Dichtung und Wirkung . . . . . 249 2. Arbeit am Sirenen-Mythos in Kunst, Literatur und Wissenschaft . . . . . . . . . . . 252 2.1 Das polymorphe Erscheinungsbild der Sirenen: Für Kunst und Literatur unerschöpflich, der Wissenschaft uneroberbar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 2.2 Herkunftsfragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 2.2.1 Geographische Lokalisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 2.2.2 Transzendierende Lokalisierung (Ernst Buschor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 3. Funktion und Position des Abenteuers: Die Sirenenepisode als Formbestandteil der »Apologoi« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 4. Substanz und Bewandtnis des Abenteuers: Die Sirenenepisode als Paradigma der »Apologoi« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 4.1 Wider die Sirenen, wider Skylla: Märchenhexe Kirke gegen mythische Bannkraft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 4.3 Entmachtung des Mythos durch Eingriff in den Kreislauf des Immergleichen . . 265 5. Die »Sagenhaftigkeit« der Sirenenepisode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 5.1 Botschaft an die Phaiaken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 5.2 Odysseus im spannungsgeladenen Erlebnisraum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 6. Die »Ordnung« der »Apologoi«: Ausgleichende »Gerechtigkeit« – »Moral« des Märchens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 7. Bilanz: »Honigtönende« Apologetik in märchenhaftem Gewand – Die »Apologoi« als Verteidigung eines Bekenntnisses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 TEIL III Von der Antike zur Moderne. Märchen und Mythos bei Kafka und Benjamin A. Einführung in Teil III: Probleme, Zusammenhänge, methodische Vorüberlegungen 1. Vom Gesang zum Schweigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 2. Die Sirenen als mythische Mächte der Versuchung bei Franz Kafka . . . . . . . . . 283 3. Walter Benjamins Sicht auf Kafkas Sirenenepisode: Ein »Märchen für Dialektiker« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 B. »Das Schweigen der Sirenen« von Franz Kafka 1. Strukturelle und stilistische Merkmale des Textes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 2. Das inhaltliche Hauptmerkmal des Textes: Inversion der Wahrnehmungs- und Versuchungsverhältnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 2.1 Die filmische Melodramatik der Szenerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 2.2 Weiblichkeit als Folie für Fiktionen der Bedrohlichkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 3. Sirenentypus Frau: Arbeit an einer mythischen Konstruktion des Weiblichen 297 3.1 Außerhalb des gängigen Normen- und Konventionssystems: Die Frau als sirenisches Wesen ohne Bewußtsein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 3.1.1 Sexualwesen Weib: Otto Weiningers Einfluß auf seine Zeit . . . . . . . . . . . . . . . . 301 3.1.2 Kafkas Weiblichkeitsfigurationen: Ausdruck individueller und gesellschaftlich paradigmatischer Konfliktstrukturen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 3.1.3 Kafkas Sirenen als »femmes fatales« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 3.2 Beispiel 1 (Tagebuch 1911/12): Die Schauspielerin Mania Tschissik – Kafkas erste Sirene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 3.2.1 Kafkas Schaulust: Das Auge als Organ visueller Einverleibung . . . . . . . . . . . . . . 307 3.2.2 Weibliche Macht als Reflex männlicher Lust an mythischen Bildern . . . . . . . . . 308 3.2.3 Sirene »T.« – Wunsch- und Schreckbild: Mania Tschissik als mythisches Doppelwesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 3.3 Beispiel 2 (Tagebuch 1917): Odysseus und die Sirenen – in Kafkas Prosastück . . 311 3.3.1 Vermeidung statt Einverleibung: Odysseus’ Umgang mit naturhaft dämonischer Weiblichkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 3.3.2 Protagonist vs. Text: Divergente Perspektiven auf das Weibliche . . . . . . . . . . . . . 313 C. Märchen und Mythos bei Walter Benjamin 1. Der Mythos: Ein immer wiederkehrender Zwangs- und Verblendungszusammenhang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 1.1 Mythoskritik in den 20er Jahren. Fokus: Trauerspielbuch und »Goethes Wahlverwandtschaften« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 1.1.1 Tragödientheorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 1.1.1.1 Die »geschichtsphilosophische Signatur« der antiken Tragödie: Emanzipation des Menschen zu infantiler Sittlichkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 1.1.1.2 Die »dämonische Weltordnung«: Befangenheit des Menschen in übermächtigen Zwängen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 1.1.1.3 Der Tod des tragischen Helden: Verweis auf das Ende des Mythos . . . . . . . . . . . 320 1.1.1.4 Von mythischer »Zweideutigkeit« zu dialektisch wirksamer »Paradoxie« . . . . . . . 321 1.1.2 Rechtstheorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 1.1.2.1 Das Recht als Sphäre der Zwecke von Gewalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 1.1.2.2 »Mythos« und »Recht« als »Ordnungen«, die Freiheit kategorisch ausschließen . . 325 1.1.2.3 Die Rechtsinstitution der Ehe in Goethes »Wahlverwandtschaften«: Ein mythischer Zwangszusammenhang von Schuld und Sühne . . . . . . . . . . . . . 326 1.1.2.4. »Die Wunderlichen Nachbarskinder« als Märchen: Happy-End durch »mutige Entschließung« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 1.1.2.5 Märchenglück theologisch aufgeladen: Versöhnung im Angesichte Gottes – ein Antidoton gegen den Mythos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 1.1.2.6 Die märchenhafte Novelle als »Antithesis« gegen »das Mythische als Thesis« im Roman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 1.2 Mythoskritik in den 30er Jahren. Fokus: Der »Passagen«-Aphorismus vom Trojanischen Pferd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 1.2.1 Theologie und Historischer Materialismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 1.2.1.1 »... das Holzpferd der Griechen im Troja des Traumes«: Dialektische Auflösung der Mythologie in den Geschichtsraum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 1.2.1.2 Odysseus’ List des Trojanischen Pferdes: Eine klassische Schwellengeschichte . . . 335 1.2.1.3 Odysseus: »... an der Schwelle, die Märchen und Mythos trennt« . . . . . . . . . . . . 338 1.2.1.4 Nutzbarmachung des Zerstörerischen zum Guten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 1.2.1.5 Sprengung des Mythos mit seinen eigenen Mitteln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 2. Das Märchen: »Überlieferung vom Siege [über den Mythos]« . . . . . . . . . . . . . 342 2.1 Lob des Märchens in »Franz Kafka« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 2.1.1 »Kleine Tricks« gegen den Mythos: Die »Odyssee« als »Urbild der Mythenbehandlung Kafkas« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 2.1.2 Der untragische Odysseus: Eine Ausnahmefigur im OEuvre Kafkas . . . . . . . . . . . 345 2.1.3 Das Märchen: Untragische »Erlösung« von den Zwängen des Mythos . . . . . . . . 347 2.1.4 Kafkas Umgang mit Mythologica: Kritik und Revision aus einer Sicht »von unten« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 2.2 Lob des Märchens in »Der Erzähler«: Befreiung vom Mythos durch »Komplizität« mit »Natur« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 2.2.1 Die »Freiheit« der Märchenhelden:Versöhnung mit der Natur . . . . . . . . . . . . . . 350 2.2.2 Befreiung aus Naturverhaftetheit – von Kant zu Marx: Benjamins Geschichtsphilosophie des Märchens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 2.2.2.1 Orientierung an Kant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 2.2.2.2 Selbstverortung als Vertreter des dialektischen Materialismus . . . . . . . . . . . . . . . 354 2.3 Heiterkeit und Glück in Märchen und Kindheit: Benjamins Situierung des Märchens im Raum des Kindes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 2.3.1 Märchentopographien des Glücks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 2.3.2 Märchenstoffe in der Hörwelt des Rundfunks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 2.3.3 Benjamins Hinwendung zur Kindheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 2.3.4 Benjamin und die Kinder: »Regisseure, die sich vom ›Sinn‹ nicht zensieren lassen« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 2.3.5 Märchen als »Abfall« der Erwachsenen: Bastelmaterial für die Welt der Kinder . . 361 3. Benjamins Märchentheorie im zeitgenössischen Kontext: Reklamierung des Märchens für eine bessere Aufklärung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 3.1 Mögliche Inspirationsquellen: Märchenbücher, Romantik (Tieck/Novalis), Erich Bethe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 3.2 Siegfried Kracauer: Märchen – »Aufhebung der mythologischen Kräfte« . . . . . . 365 3.3 Ernst Bloch: »Zerstörung, Rettung des Mythos durch Licht« . . . . . . . . . . . . . . . 366 3.3.1 Bloch/Benjamin: Freundschaft und Konkurrenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 3.3.2 Bloch als Schlüssel zu Benjamis Märchentheorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 3.3.2.1 Märchen – »Aufstand des kleinen Menschen gegen die mythischen Mächte« . . . 371 3.3.2.2 Die Welt des Märchens lebt … »in Kindern und dem Apriori der Revolution« . . 372 3.3.2.3 Benjamins aufklärerischer Umgang mit dem Märchen: »Rat« gegen den Mythos 374 4. Bilanz: Odysseus und die Sirenen bei Kafka – ein »Märchen für Dialektiker« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 4.1 Odysseus: Mythischer Held einerseits, Märchenheld andererseits . . . . . . . . . . . . 376 4.2 Weitere Paradoxien und Antinomien: Die Antithetik des Textes . . . . . . . . . . . . . 379 4.3 Aussaat von Fragen: Die Offenheit des Textes als spielerische Komponente . . . . . 380 4.4 Benjamins Wertung der Episode: Sieg über den Mythos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 Schlußbemerkungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 Bibliographie und Siglenverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 Namenregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 Sach- und Wörterregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429 |
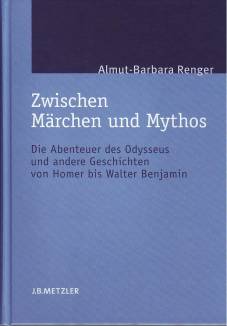
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen