|
|
|
Umschlagtext
Berufung als ein dialogisches Geschehen soll gemäß der biblischen Überlieferung den ganzen Menschen erfassen und auf Gott ausrichten. Wer sich als Theologe damit beschäftigt, kann sich der Auseinandersetzung mit humanwissenschaftlichen Erkenntnissen nicht entziehen. Dazu zählt auch die Frage nach der Bedeutung des Unbewussten. Der Autor greift deshalb auf die Ausführungen von Luigi M. Rulla und Josef Kentenich zurück. Das philosophisch-theologische Bild vom Menschen zeigt sich durch die Konfrontation mit psychologischen Erkenntnissen differenzierter.
Andererseits setzt jeder psychologische Ansatz ein bestimmtes Menschenbild voraus. Dieses muss auf der Grundlage des biblisch-christlichen Menschenbildes kritisch reflektiert werden. Dadurch ergeben sich Voraussetzungen für die Eignung von psychologischen Ansätzen im kirchlichen Kontext. Auf diesem Hintergrund entwickelt der Autor einige wesentliche Kriterien für die Konzeption von Ausbildungswegen für Priester und Ordensleute. Rezension
Der Autor, Dr. Michael Gerber, ist selbst langjährig in der Ausbildung von Priestern und Begleitung von Menschen tätig gewesen. Er hat nun in seiner Dissertation den Vergleich zwischen einem ausgewiesenen Experten auf dem Bereich der christlichen Berufung und einem eher Unbekannten, Josef Kentenich, gezeichnet.
Gerber arbeitet die Unterschiede und Übereinstimmung in guter nachvollziehbarer Weise heraus. Dabei wird dem Leser der Begriff der (christlichen) Berufung näher gebracht. Oft vernachlässigt, zeigt er bei beiden Autoren auf, dass das die affektive und unbewusste Disposition wesentlicher Bestandteil von Berufung ist. Hervorzuheben ist, dass am Ende des Buches zusammenfassend in acht Thesen die umfangreiche Forschungsarbeit nochmals kurz und im Überlick klar und sachlich einwandfrei dargestellt wird. A. Hernadi, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Berufung als ein dialogisches Geschehen soll gemäß der biblischen Überlieferung den ganzen Menschen erfassen und auf Gott ausrichten. Wer sich als Theologe damit beschäftigt, kann sich der Auseinandersetzung mit humanwissenschaftlichen Erkenntnissen nicht entziehen. Dazu zählt auch die Frage nach der Bedeutung des Unbewussten. Der Autor greift deshalb auf die Ausführungen von Luigi M. Rulla und Josef Kentenich zurück. Das philosophisch-theologische Bild vom Menschen zeigt sich durch die Konfrontation mit psychologischen Erkenntnissen differenzierter. Inhaltsverzeichnis
VORWORT 5
1 VORÜBERLEGUNGEN 7 1.1 DIE AUSGANGSFRAGE 7 1.2 LUIGI RULLA UND JOSEF KENTENICH 14 ERSTER TEIL: ANTHROPOLOGIE DER CHRISTLICHEN BERUFUNG BEI LUIGI M. RULLA 21 2 EINFÜHRENDE ERLÄUTERUNGEN 23 2.1 LUIGI MARIA RULLA: BIOGRAPHISCHE DATEN 23 2.2 DIE ANTHROPOLOGIE L. RULLAS: ENTWICKLUNGSLINIEN 24 2.3 „BERUFUNG“ BEI L. RULLA – EINE ERSTE ANNÄHERUNG 30 2.4 DAS „UNBEWUSSTE“ 35 2.5 „MOTIVATION“ 36 3 PHILOSOPHISCH–THEOLOGISCHE KONTUREN DER ANTHROPOLOGIE LUIGI RULLAS 38 3.1 DER MENSCH ALS SELBSTTRANSZENDENTES WESEN 38 3.1.1 Vier Ebenen der Selbsttranszendenz 38 3.1.2 Das Ziel menschlicher Selbsttranszendenz 40 3.1.3 Eine grundlegende Dialektik 42 3.1.4 Biblische Hinweise 47 3.1.5 Parallelen zu Aussagen des Zweiten Vatikanischen Konzils. 48 3.2 BERUFUNG ALS DIALOG ZWISCHEN GOTT UND MENSCH 50 3.2.1 Von Gott zum Dialog berufen 50 3.2.2 In Christus berufen 51 3.2.3 Berufung als gnadenhaftes Geschehen 51 3.2.4 Berufung zur Freiheit 53 4 DIE PERSÖNLICHKEIT DES BERUFENEN: STRUKTUR, INHALT UND ENTWICKLUNG 56 4.1 INHALTLICHE KOMPONENTEN 57 4.1.1 Menschliche Motivation: Das Phänomen „direktiver Elemente“. 57 4.1.2 Werte 58 4.1.3 Bedürfnisse 63 4.1.4 Einstellungen 65 4.1.5 Die Ambivalenz der direktiven Elemente 66 4.1.6 Konsistenzen - Inkonsistenzen 68 4.2 STRUKTURELLE KOMPONENTEN 74 4.2.1 Die beiden Substrukturen: Real-Ich und Ideal-Ich 74 4.2.2 Drei Dimensionen der Grunddialektik 77 4.2.3 Philosophisch-anthropologische Interpretation 83 4.3 RÜCKFRAGEN 86 4.3.1 Persönlichkeitsanalyse: „inhaltlich“, „strukturell“, „finalistisch“ 86 4.3.2 Entwicklungspsychologische Interpretation 89 4.4 DER PROZEß DER BERUFUNG: INTERNALISIERUNG DER OBJEKTIVEN WERTE GEISTLICHER BERUFUNG 92 4.4.1 „Internalisierung“ 93 4.4.2 Eintritt 94 4.4.3 Beständigkeit 96 4.4.4 Apostolische Wirksamkeit 104 4.4.5 Möglichkeiten der Einflussnahme 108 4.5 DER BEITRAG DER EMPIRISCHEN STUDIE (1963 – 1977) 115 4.5.1 Intention 115 4.5.2 Untersuchte Personen 116 4.5.3 Testverfahren 117 4.5.4 Verlauf der Feldstudie 123 4.5.5 Ergebnisse in Bezug auf den Berufungsweg 124 4.5.6 Ergebnisse in Bezug auf die Wirksamkeit der Ausbildung im untersuchten Zeitraum 128 4.5.7 Der Einfluss des nachkonziliaren Wandels 131 4.5.8 Der Ertrag der Feldstudie für gegenwärtige Fragestellungen. 134 ZWISCHENBEMERKUNG: ANFRAGEN AN JOSEF KENTENICH. 138 ZWEITER TEIL: KONTUREN EINER ANTHROPOLOGIE DER BERUFUNG BEI JOSEF KENTENICH 139 5 EINFÜHRENDE ERLÄUTERUNGEN 141 5.1 JOSEF KENTENICH: KURZER BIOGRAPHISCHER ÜBERBLICK 141 5.2 ENTWICKLUNGLINIEN DES ANTHROPOLOGISCHEN ANSATZES VON J. KENTENICH 144 5.3 ANMERKUNGEN ZUR QUELLENLAGE 152 5.4 „BERUFUNG“ BEI J. KENTENICH– EINIGE ECKDATEN 156 5.5 DAS „UNBEWUSSTE“ IN DER TERMINOLOGIE J. KENTENICHS 158 6 PHILOSOPHISCHE UND THEOLOGISCHE KONTUREN DES MENSCHENBILDES BEI JOSEF KENTENICH 162 6.1 DER MENSCH IM KOSMOS: MENSCHSEIN IN BEZIEHUNG 162 6.1.1 Beziehung zu sich selbst – Erfahrung der Einmaligkeit 162 6.1.2 Der Mensch in Beziehung zu seiner Umwelt 163 6.1.3 Die Offenheit des Menschen für die Gottesbeziehung 164 6.1.4 Beziehung als Transzendenzerfahrung 165 6.2 DER MENSCH ALS KOSMOS: DIE VIELSCHICHTIGKEIT MENSCHLICHER SELBSTTRANSZENDENZ 170 6.2.1 Die Leib-Seele-Lehre als Anknüpfungspunkt 170 6.2.2 Sinnenhaftes Wahrnehmen und Streben 173 6.2.3 Rationales Wahrnehmen und Streben 178 6.2.4 Harmonie zwischen sinnenhaftem und rationalem Streben – eine „marianische“ Anthropologie 183 6.3 LIEBE ALS ZENTRALES MOMENT JEDER BERUFUNG 185 6.3.1 Formen der Liebe 185 6.3.2 Urbild: Der liebende Gott 189 6.3.3 Der Mensch: Berufen zu Liebe und Freiheit 190 6.4 GÖTTLICHES WIRKEN: BERUFUNG ALS LEBENSMITTEILUNG DES DREIEINEN GOTTES 193 6.4.1 Ursprung und Ziel im dreieinen Gott 193 6.4.2 Schöpfung in Jesus Christus 195 6.4.3 Wandlung und Vollendung im Heiligen Geist 198 6.5 MENSCHLICHE MITWIRKUNG: DER BERUFENE ALS BÜNDNISPARTNER . 202 6.5.1 Offenbarung Gottes in der Geschichte 202 6.5.2 Der Mensch als Bündnispartner Gottes 206 6.5.3 Bund als universales Geschehen 208 6.6 FOLGERUNGEN FÜR DAS VERSTÄNDNIS VON BERUFUNG 210 7 DIE BEDEUTUNG DES „UNTERBEWUSSTEN SEELENLEBENS“. 215 7.1 UNBEWUSSTE WIDERSTÄNDE 216 7.1.1 Ursachen 217 7.1.2 Die Bedeutung unbewusster Widerstände 218 7.1.3 „Bruchstellen“ im Licht der Barmherzigkeit Gottes 222 7.2 J. KENTENICHS ANSATZ BEIM „PERSÖNLICHEN IDEAL“ 223 7.2.1 Grundzug und Grundstimmung 223 7.2.2 Der dynamische Charakter: Wachstumsgesetze 227 7.2.3 Seelische Dynamik und Werteorientierung 230 7.2.4 Das Persönliche Ideal im Verhältnis von Natur und Gnade . 234 7.2.5 Philosophische und theologische Interpretation 235 7.3 DAS „PERSÖNLICHE IDEAL“ IN DER KRITIK 237 7.3.1 Der Vorwurf der Gefahr einer „subjektiven Konstruktion“. 238 7.3.2 Der Vorwurf des Subjektivismus 241 7.3.3 Die Problematik einer Formulierung des Persönlichen Ideals . 243 7.4 „DER LIEBE GLAUBEN“ - ZUSAMMENFASSENDE ERLÄUTERUNGEN . 246 DRITTER TEIL: VERGLEICHENDE ZUSAMMENSCHAU IM INTERESSE EINER PRAKTISCHEN RELEVANZ BEIDER AUTOREN FÜR FORMATIONSWEGE 251 8 BERUFUNG BEI LUIGI RULLA UND JOSEF KENTENICH: VERGLEICHENDE LINIEN 253 8.1 THEOLOGIE UND PSYCHOLOGIE IM INTERDISZIPLINÄREN DIALOG: MÖGLICHKEITEN UND GRENZEN 253 8.1.1 Der Verweis der Theologie auf die Psychologie 254 8.1.2 Der Verweis der Psychologie auf Theologie und Philosophie . 262 8.2 THEOLOGISCH-ANTHROPOLOGISCHE PERSPEKTIVE: BERUFUNG IM ZUSAMMENSPIEL UNTERSCHIEDLICHER DYNAMISCHER PROZESSE 267 8.2.1 Ein spezifisch christliches Werteverständnis 267 8.2.2 Deutung der affektiv-unbewussten Dynamik 270 8.2.3 Wechselseitige Beziehung von affektiver Dynamik und Wertorientierung 274 8.3 DER PROZESS DER FORMATION – EINIGE GRUNDZÜGE 278 8.3.1 Das Subjekt des Formationsweges 278 8.3.2 Das Ziel der Formation 279 8.3.3 Grundlegende Elemente für das Gelingen eines Berufungsweges . 280 8.3.4 Das Profil des Formationsleiters 283 8.3.5 Umgang mit unbewussten Widerständen 295 8.3.6 Formation als Dienst an der Entfaltung des Persönlichen Ideals. 303 8.3.7 Die Bedeutung der Formationsgemeinschaft 307 8.3.8 Die Bedeutung des Apostolates für die Formation 315 8.4 BERUFUNG UND SEXUALITÄT 318 8.4.1 Sexualität als komplexe Lebenskraft 318 8.4.2 Die Bedeutung von Umwelteinflüssen 324 8.4.3 Ehe und Ehelosigkeit 324 8.4.4 Wege zu einer integrierten Sexualität in der ehelosen Lebensform 327 8.5 UNTERSCHIEDLICHE AKZENTUIERUNGEN BEIDER AUTOREN 332 AUSBLICK: ACHT THESEN 337 ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 353 LITERATURVERZEICHNIS 356 PERSONENREGISTER 385 INHALTSVERZEICHNIS 389 |
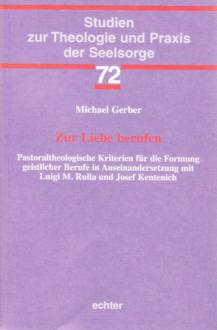
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen