|
|
|
Umschlagtext
Nach Jahrzehnten liegt mit diesem Buch eine neue Landesgeschichte des Alten Westfalen vor. Sie umfasst das Mittelalter und die Frühe Neuzeit – von den Sachsenkriegen Karls des Großen 772 bis zur Säkularisation 1803. Das Cover zeigt die Heilige Sippe, die Verwandten Jesu, vor der Kulisse der Stadt Dortmund. Auf dem Altarbild von 1470 sind auch die Kirchen und die landwirtschaftlich genutzte Flur zu sehen. Diese Bildinhalte stehen für die Stadt- und Agrargeschichte sowie für die Kirchen- und Alltagsgeschichte, die wesentliche Teile des Buches ausmachen. Analyse und Chronologie leiten dabei die einzelnen Kapitel.
Doch keine westfälische Geschichte sollte ohne Geschichten sein. Anschauliche Beispiele, regionale Vielfalt und der Blick auf interessante Gestalten sowie an die 100 Karten und Abbildungen versprechen eine entdeckungsreiche Lektüre über ein Land, das reich an Geschichte ist. Städte In Westfalen gan es ein dichtes Städtenetz, aus dem die vir Bischofsstädte sowie Dortmund und Soerst herausragten. Das alte Dortmunder Rathaus steht für Bürgerfreiheit, Gewerbereichtum und urbane Kultur. Ländliche Gesellschaft Sie lebte in verschiedenen Wirtschafts- und Siedlungsformen und kannte grund- und leibherrliche Abhängigkeiten. Statt ländlichem Idyll existierte zudem extreme soziale Ungleichheit, wie das Armenhaus von Rinkerode deutlich macht. Alltag und fromme Praxis Das Leben waren von Ressourcenknappheit geprägt, kannte aber auch verschwenderische Festlichkeit. Bedeutsam war die Religiösität, die in der Reformation einschneidende Veränderungen erfuhr. Regina Hammacher, eine Bürgerstochter aus Osnabrück, zeigt sich mit einem Andachtsbuch, Zeugnis ihres Gottvertrauens und ihrer Bildung. Politische Gestalt Westfalen war charakterisiert durch die Vielzahl und Vielfalt seiner Territorien. Eines von ihnen war Lippe, dessen Fürstin Pauline um 1800 Politik im Zeichen der Aufklärung betrieb. "Mental Map" Westfalen Kommunikation, Handel, Politik, Sprache und Geschichtsmythen konstituierten räumliche Vorstellungen von Westfalen. Die Taufe Widukinds, widersacher Karls des Großen, wurde als Ursprung Westfalens imaginiert. Das Porträt Widukinds mit einem Kreuz stilisiert den sächsischen Herrführer zu einem katholischen Heiligen. Rezension
Der Zeitraum von den Sachsenkriegen Karls des Großen 772 bis hin zum Reichsdeputationshauptschluss 1803 umfasst zwei historische Epochen: das Mittelalter und die Frühe Neuzeit. In diesem Zeitraum von mehr als tausend Jahren fallen zentrale historische Ereignisse und Prozesse, ohne welche die Gegenwart nicht verständlich ist, zum Beispiel: die christliche Missionierung, der Aufstieg der Städte, die Reformation, die Gegenreformation, der Dreißigjährige Krieg, die innere Staatsbildung, die Protoindustrialisierung und die Aufklärung.
Wie sich die Region Westfalen in dieser Zeit, das so genannte „Alte Westfalen“, entwickelte, darüber gibt Werner Freitag (*1955) in seinem Opus Magnum „Westfalen. Geschichte eines Landes, seiner Städte und Regionen in Mittelalter und Früher Neuzeit“ umfassend und differenziert Auskunft. Erschienen ist die Monographie des Historikers, der von 2005 bis 2021 an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster die Professur für Westfälische und Vergleichende Landesgeschichte innehatte, im Aschendorff Verlag. Im Unterschied zum heutigen Teilbundesland Westfalen umfasste das Alte Westfalen im 18. Jahrhundert auch das heutige Emsland, die Grafschaft Bentheim, das Osnabrücker Land und das Oldenburger Münsterland. Das Alte Westfalen war wie das Heilige Römische Reich deutscher Nation ein territorialer Flickenteppich, bestehend aus einer Vielzahl von Territorien, der Reichsstadt Dortmund und den zwei Reichsabteien von Herford und Essen. Welche Spannungen lassen sich zwischen den Hochstiften und weltlichen Grafschaften nachweisen? Wie entwickelte sich Westfalen zu einer Sakrallandschaft? Welche Rolle spielten dabei die Bischofsstädte Paderborn, Minden, Münster und Osnabrück sowie die Damenstifte? Warum scheiterte die Täuferbewegung in Münster? War soziale Ungleichheit das Kennzeichen der ländlichen Gesellschaft im Alten Westfalen? Wie wirkte sich der Westfälische Frieden auf die einzelnen Territorien und Städte aus? Welche Städte waren Verlierer und Gewinner in der Frühen Neuzeit? Wie wurde in Westfalen – insbesondere in Krisenzeiten - mit Minderheiten umgegangen? Gab es in Westfalen ein Zentrum der Aufklärung? Fundierte Antworten auf diese landesgeschichtlichen Fragen gibt Freitag unter Berücksichtigung des neuesten Forschungsstands. Ihm gelingt es in seinem Band sehr gut, die „Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen“(Bloch) in den verschiedenen Territorien und Städten Westfalens aufzuzeigen. Lehrkräfte, die in Nordrhein-Westfalen Geschichte unterrichten, werden durch das gut lesbare Buch motiviert, sich in ihrem Unterricht mit der Geschichte des Alten Westfalen problemorientiert auseinanderzusetzen. Fazit: Werner Freitag hat mit seiner exzellenten Geschichte „Westfalen“ ein Standardwerk zur westfälischen Landesgeschichte vorgelegt, das einen Platz in jeder guten Bibliothek des Teilbundeslandes verdient. Dr. Marcel Remme, für lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Nach Jahrzehnten liegt mit diesem Buch eine neue Landesgeschichte des Alten Westfalen vor. Sie umfasst das Mittelalter und die Frühe Neuzeit – von den Sachsenkriegen Karls des Großen 772 bis zur Säkularisation 1803. Das Cover zeigt die Heilige Sippe, die Verwandten Jesu, vor der Kulisse der Stadt Dortmund. Auf dem Altarbild von 1470 sind auch die Kirchen und die landwirtschaftlich genutzte Flur zu sehen. Diese Bildinhalte stehen für die Stadt- und Agrargeschichte sowie für die Kirchen- und Alltagsgeschichte, die wesentliche Teile des Buches ausmachen. Analyse und Chronologie leiten dabei die einzelnen Kapitel. Doch keine westfälische Geschichte sollte ohne Geschichten sein. Anschauliche Beispiele, regionale Vielfalt und der Blick auf interessante Gestalten sowie an die 100 Karten und Abbildungen versprechen eine entdeckungsreiche Lektüre über ein Land, das reich an Geschichte ist. Inhaltsverzeichnis
EINLEITUNG: WARUM EINE GESCHICHTE WESTFALENS
IN MITTELALTER UND FRÜHER NEUZEIT? 9 i. Biografische Bedeutung einer Geschichte Westfalens 9 2. Westfalen als Teilbundesland 10 3. Westfalen als Mental-Map, Heimat und Organisationsrahmen 12 4. Stereotype und Alltagshandeln 15 5. Aufbau des Buches 18 II. DIE „SACHSEN“ IM WESTEN: SIEDLUNG, GESELLSCHAFTSPYRAMIDE, RELIGION, ORGANISATION UND KULTURAUSTAUSCH 27 1. Siedlung 28 2. Gesellschaftspyramide 32 3. Religion 34 4. Organisation 36 5. Kultureller Austausch 39 III. FRÄNKISCHE EROBERUNG UND BEREITWILLIGE ÖFFNUNG (750-900/950) 43 1. Friedliche Mission, Christianisierung mit dem Schwert, die neuen Bistümer und die Macht der Heiligen 43 2. Paderborn als Herrschafts- und Missionszentrum 58 3. Männer und Frauen des Adels als alter und neuer Herrschaftsstand 62 4. Villikationen als Fundament der neuen Gesellschaftspyramide und als Institut langer Dauer (9-13. Jahrhundert) 67 IV. ADELSLAND, STÄDTISCHE SIEDLUNGEN UND GEFESTIGTES CHRISTENTUM (900/950-1200] 79 1. Westfalen als königsfernes Gebiet - die Loslösung von (Ost-)Sachsen 79 2. Die Stadt um 1000 84 3. Festigung der kirchlichen Institutionen - Vertiefung des Christentums 97 4. Zwischenfazit: Wege zur Ständegesellschaft 105 UMBRÜCHE (1180-CA. 1350] 113 i. Territorialisierung: vom Herzogtum des Kölner Erzbischofs zum Flickenteppich der Äbtissinnen, Bischöfe, Grafen und Edelherren 113 2. „Helden“ und „Heldinnen“ der westfälischen Territorialgeschichte: Personen und Profile 140 3. Aufstieg der Städte 149 4. Veränderungen auf dem Land: Rentengrundherrschaft, Siedlungswachstum und Wüstungen 172 5. Bistum, Pfarrei, neue Orden und fromme Praxis 180 VI. DAS „LANGE" 15. JAHRHUNDERT [CA. 1350-1530/50) 205 1. Der Charakter des Zeitabschnitts 205 2. Imaginiertes und kommuniziertes Westfalen 207 3. Die Territorien 211 4. Gute Zeiten im Agrarsektor 223 5. Die Städte: Sozialgeschichte, Ratsherrschaft und Alltagswelten 231 6. Westfalen als Sakrallandschaft 258 7. Aufruhr statt Reformation: die 1520er Jahre 276 VII. DER VERSPÄTETE BEGINN DER FRÜHEN NEUZEIT: DIE REFORMATION 293 1. Die Epoche des Schon und des Noch in Westfalen 293 2. Die Reformation als Zäsur: die 1530er und 1540er Jahre 296 3. Der Lippstädter Augustinereremit Johann Westermann (um 1500-1536) als Wegbereiter der Reformation 297 4. Erfolgreiche Reformation in den Autonomiestädten 299 5. Gescheiterte Stadtreformationen: die Täufer in Münster und die Bischofsstadt Paderborn 310 6. Die landesherrliche Reformation 324 7. Zwischen den Bekenntnissen: die humanistische Reform in den Grafschaften Mark und Ravensberg sowie in Dortmund und Essen 335 VIII. KONFESSIONELLE KULTUREN UND INNERE STAATSBILDUNG. NEUE GLAUBENSWELTEN IN STADT UND LAND (CA. 1600-1750/70) 349 1. Vermeintliche Missstände und tatsächliche Uneindeutigkeiten 350 2. Die Spitzen der Hierarchie - Handlungsbedingungen und religiöse Motivationen 351 3. Kirchenordnungen, Synodalstatuten und Agenden als Grundgesetze des Konfessionsstaates 358 4. Ein neuer Instanzenzug 360 5. Die neuen Pfarrer: Anforderungsprofile, Stabsdisziplinierung und „Gute Hirten" 364 6. Bildungsinnovation und Funktionseliten 371 7. Ausschaltung lokaler Autonomien 376 8. Vermittlung und rituelle Praxis 380 9. Fromme Erfahrungen und Plausibilitäten 395 IX. DAS BRANDENBURGISCH-PREUSSISCHE WESTFALEN: PROVINZENBILDUNG DURCH VERWALTUNG, KIRCHENAUFSICHT, STAATSORIENTIERTE ELITEN UND WIRTSCHAFTSKRAFT 411 1. Phase I: Kooperationsbereitschaft der brandenburgischen Kurfürsten (1609/1650-1723) 412 2. Phase II: Provinzenbildung. Akzise, Kriegs- und Domänenkammern, städtisches Regiment und ein neuer Stadttypus 424 3. Politische Klugheit: Kirchenaufsicht statt Kirchenregiment 436 4. Merkantilpolitik, Gewerbeförderung und Industriespionage 442 5. Herrschaft im Systemvergleich: westfälische Fürstbistümer und preußisches Westfalen 452 X. GEWINNER UND VERLIERER: STÄDTE IN DER FRÜHEN NEUZEIT 473 1. Residenz- und Hauptstädte der geistlichen Staaten: Arnsberg, Münster, Osnabrück und Paderborn 474 2. Detmold als Haupt- und Residenzstadt der Grafschaft Lippe 482 3. Die preußische Verwaltungsstadt Hamm 486 4. Die brandenburgisch-preußischen Festungsstädte: Hamm, Lippstadt und Minden 488 5. Iserlohn: die Stadt des Wirtschaftsbürgertums 492 6. Der Niedergang der Reichsstadt Dortmund 495 7. Klein- und Minderstädte: landesherrlicher Herrschaftsanspruch, Beharrung und moderate Wandlungen 496 XL DYNAMIK UND SOZIALE UNRAST AUF DEM LAND 503 1. Marktorientierung 505 2. Siedlungsgeschichte 507 3. Soziale Ungleichheit und Bevölkerungswachstum: einige Fallstudien 514 4. Agrarverfassung 523 5. Genossenschaftsbildung 530 6. Neue Dorftypen 535 7. Agrarreformen vor der Bauernbefreiung 542 XII. KNAPPHEITSGESELLSCHAFT: HUNGERKRISEN, KRIEGSNÖTE, POLICEYORDNUNGEN GEGEN VERSCHWENDUNG UND DER UMGANG MIT AUSSENSEITERN 553 1. Hungerkrisen 553 2. Kriegserfahrungen 559 3. Policeyordnungen für die Untertanen: Regulierung des Alltags und Demonstration vonHerrschaft 570 4. Randgruppen und Außenseiter: Arme, Diebe, „Zigeuner“ und Hexen 572 5. Fragile Koexistenz: die jüdische Minderheit 589 XIII. DAS WESTFALEN DER AUFKLÄRER: DIE LETZTEN JAHRZEHNTE DES 18. JAHRHUNDERTS 603 1. Ideen und Mentalitäten 605 2. Gebildete Eliten und ihre Sozietäten: die ständeübergreifende Vergesellschaftung 611 3. Periodika aus, für und über Westfalen 615 4. Westfalen als aufgeklärte Zukunftsvision 617 5. Landesherrliche und kommunale Reformprojekte 621 6. Kirchliche Projekte und die tragende Rolle der Pfarrer 632 7. Grenzen der Aufklärung 638 XIV. DAS ENDE DES ALTEN WESTFALEN 647 ABKÜRZUNGEN 649 REGISTER 651 |
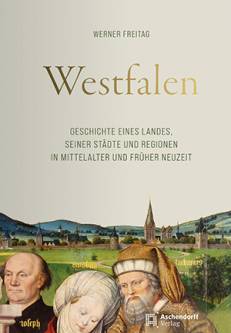
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen