|
|
|
Umschlagtext
Die lebensbedrohliche Erkrankung und der Tod eines Kindes gehören zu den schwersten Schicksalsschlägen, die eine Familie treffen können.
Mechthild Ritter, seit 1989 Seelsorgerin auf der onkologischen Kinderstation des Universitätsklinikums Würzburg, beschreibt in diesem Buch die Zeit vor und nach dem Tod, die unterschiedlichen Wege der Bewältigung für jedes einzelne Familienmitglied und die verschiedenen Möglichkeiten einer nachsorgenden Begleitung. Beispiele unterschiedlicher Umgangsweisen bieten Orientierung, Entlastung, Anregung oder Bestätigung. Ein gesondertes und bemerkenswertes Kapitel widmet die Autorin der Ansprache der professionellen Begleiter. Mechthild Ritter, geboren 1958, Diplom-Pädagogin und Transaktionsanalytikerin, ist seit 1989 Seelsorgerin auf der Kinderkrebsstation der Universitätskinderklinik Würzburg. Freiberuflich bietet sie Beratungen, Supervisionen und Fortbildungen sowie regelmäßige Referententätigkeiten zu den Themen Sterbebegleitung, Trauer, Selbstsorge und Kinder an. Im Jahr 2000 erhielt sie für das psychosoziale Projekt "Trauerseminare für Verwaiste Familien" eine Auszeichnung der Deutschen Leukämie-Forschungshilfe. Rezension
Auch in der Schule erleben Lehrer/innen und Mitschüler/innen immer wieder einmal den Tod eines Kindes: Wenn ein Kind stirbt bedeutet das nicht nur für die Eltern, sondern auch für die Geschwister und andere Angehörige sowie Begleitende eine unvorstellbar schmerzhafte Veränderung. Die Zeit vor und nach dem Tod, die unterschiedlichen Wege der Bewältigung für jedes einzelne Familienmitglied, die verschiedenen Möglichkeiten einer nachsorgenden Begleitung sowie das gesonderte Ansprache der professionellen Begleiter sind die zentralen Themen des Buches. Die vielen Beispiele unterschiedlicher Umgangsweisen bieten Orientierung, Entlastung, Anregung oder Bestätigung.
Jens Walter, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
»Damit ich weiter weinen kann als allein …« - Mehr als ein Trauerbegleiter - Für die ganze Familie, für professionelle und ehrenamtliche Begleitende und für Selbsthilfegruppen - Mit zahlreichen Beispielen und mentalen Vorstellungsbildern Inhaltsverzeichnis
Ein Wort vorab 10
Alles, was ist, darf sein 11 Kapitel 1: Zeiten der Trauer 16 1.1 Trauerarbeit vor dem Tod 16 Die Wahrheit ist wie ein Puzzle 17 Vertrauen statt Tabu 20 Leben, solange es geht 24 Lassen statt Tun 27 So soll es werden 29 1.2 Begleitung in direkter Nähe zum Tod 32 Wahrnehmen, was ist 32 Dem Tod ins Angesicht schauen 34 Gestalten, was möglich ist 38 Abschied auf der Station im Krankenhaus 39 Totenwache halten 39 Beerdigen 41 Grabgestaltung 49 Mit anderen in Verbindung sein 51 Leichenschmaus oder »Tröster« 51 Kondolieren 52 1.3 Trauer braucht Zeit – wer trägt das Leid? 54 Jede/r Einzelne 54 Die Partner 56 Die Geschwister – Schattenkinder? 57 12 gute Wünsche: Was Kinder brauchen, wenn ein Familienmitglied gestorben ist 64 Freunde, Verwandte, Nachbarn, Mitmenschen 65 Schicksalsgenossen / Selbsthilfegruppen 68 Was kann eine Klinik, ein Hospiz, eine Behinderteneinrichtung tun? 69 Die Einladung, sich auf der Station im Krankenhaus zu verabschieden 70 Das Erinnerungsbuch 71 Der immerwährende Kalender 72 Gedenkfeiern und Begegnungsmöglichkeiten 73 Weiterführende Hilfen 74 Zusammenfassung 74 1.4 Erinnern als lebenslanger Prozess 76 Zulassen statt loslassen 76 Die Lebensmelodie darf weiterklingen 78 Trauer gegen das Vergessen 81 Erinnerungen gestalten und feiern 82 Über den Himmel reden 84 Kapitel 2: Bilder, die helfen 87 2.0 Einleitung 87 2.1 Sich einlassen und ausdrücken 90 Der Schlüssel liegt im Dunklen – sich auf den Weg machen 90 Die Talfahrt – Höhen und Tiefen 91 Das Körpergefäß – sich ausdrücken 93 Flüchten oder standhalten 96 2.2 Beistehen und zumuten 98 Durchhängen und ausruhen 98 Mitschwingen und nahe sein 100 Schuld und Vergebung 102 Stark sein und schwach sein – das Familienbudget 106 Wundversorgung – wie und was heilt? 108 2.3 Überleben und heilen 111 Der Berg der Trauer – Schmerz abtragen 112 Das Labyrinth – wo stehe ich? 114 Der geschlossene Kreis – was fehlt dir? 116 Die gefasste Quelle – die Liebe freigeben 119 Die Türen öffnen – das Leben wieder einkehren lassen 121 2.4 Sterben und leben 125 Ursprung und Ziel 125 Sterben als Verwandlung 128 Leben jenseits unserer Vorstellung 131 Kapitel 3: Die Kraft einer Gruppe 133 3.0 Einleitung: Erfahrungen und Methoden des Würzburger Modells – Entstehung und Weiterentwicklung 133 3.1 Der Gesprächskreis 135 Begleitung als Weichenstellung 136 Warum nicht eine reine Selbsthilfegruppe? 137 »Spielregeln« 137 Wem gehört die Aufmerksamkeit? 139 Die drei wiederkehrenden Fragen 140 Weiterführende Gesprächsimpulse 142 Die heilsame Wirkung 142 3.2 Weitere Begegnungsformen 144 Wandertag – oder: Wie geht es weiter? 144 »Elternkaffee« 145 Geschwisterfreizeiten 146 3.3 Die Wochenenden für verwaiste Familien 147 Das Konzept: Belastet kommen, erleichtert und gestärkt gehen 147 Zeit, Raum, Schutz und gute Gesellschaft 148 Die Geschwister: Ich bin einmalig 150 Die gute Mischung 152 Der erste Abend: Zusammenfinden und kennenlernen 152 Das Betthupferl 153 Der Samstagvormittag: In die Tiefe gehen 154 Sich stärken und bedient werden 155 Der Samstagnachmittag: Bewegt sein und in Bewegung kommen 155 Kindervernissage: Schau mich an 155 Der Feierabend: Die Lebensgeister erwachen 156 Der Sonntagmorgen: Die Kirche kommt zu uns 157 Abschied nehmen und in Verbindung bleiben 157 Kapitel 4 : Der getroste Begleiter – eine persönliche Standortbestimmung 160 Grenzen und Bedürfnisse 161 Respekt vor dem Schicksal der Leidtragenden 163 Nähe um jeden Preis? 165 Profi oder Mensch? – Die falsche Frage 166 Auf gutes Beenden achten 167 Aus dem Vollen gehen 168 Die Kostbarkeit meines Lebens 169 Dank 171 Literaturangaben und Anmerkungen 173 Leseprobe: Ein Wort vorab Nach Erscheinen der ersten Ausgabe dieses Buches habe ich selbst oft gezögert, es den Eltern der erkrankten Kinder auf der Kinderkrebsstation in die Hand zu geben. Allein der Titel scheint eine Zumutung zu sein. So stand es bescheiden im Regal. Manche haben es entdeckt und stehen gelassen, manche haben es in die Hand genommen und gelesen. Ab und zu war es verschwunden. Hatte es jemand »aussortiert«, weil an den Tod von Kindern nicht gedacht werden darf? Oder erschien es jemandem so lesenswert, dass er es mitgenommen hat, um sich vorsichtig, unbemerkt dem Unabänderlichen zu nähern? Jedenfalls habe ich von verwaisten Eltern immer wieder gehört: »Schade, dass wir das nicht schon vor dem Tod unseres Kindes gelesen haben.« Die Halbwertzeit von Trauerbüchern ist wesentlich kürzer als die Zeit der Trauer. Deshalb bin ich dem Gütersloher Verlagshaus, insbesondere Frau Susanne Myller und Herrn Thomas Schmitz, für das Erscheinen dieser überarbeiteten Neuausgabe sehr dankbar. 11 Alles, was ist, darf sein Wenn ein Kind stirbt, bleibt eine »verwaiste Familie« zurück. Die Formulierung ist in der Umgangssprache kaum geläufig. Dass Kinder ihre Eltern verlieren, entspricht der vermeintlichen Logik des Lebens. Dass Kinder vor ihren Eltern sterben, diese »verlassen«, wie uns der mittelhochdeutsche Ursprung »entwisen « verrät, widerspricht unserem Denken und unserer Vorstellung und vor allem unseren Gefühlen. Wir möchten es uns auch gar nicht vorstellen, weil es zu schlimm ist. Es ist wohl einer der schwersten Schicksalsschläge überhaupt, der Eltern treffen kann. Die Begegnung mit verwaisten Eltern ruft die eigenen Ängste vor solch einem Schicksal wach. Sie konfrontiert uns mit großem Schmerz und der eigenen Ohnmacht. Bagatellisieren funktioniert nicht. Aktionismus hat angesichts des Todes keinen Sinn. Verdrängen und Vermeiden werden als kurzfristige Mittel gesucht, halten aber Angst und Druck aufrecht. Wer oder was kann in der freiwilligen oder unfreiwilligen Begegnung mit trauernden Eltern oder Geschwistern tröstlich und hilfreich sein? Was ist überhaupt tröstlich und hilfreich, damit die Not sich wenden kann? Ist es, wenn der andere danach nicht mehr weint? Wenn er erfolgreich abgelenkt ist? Wenn das schwierige Thema nicht zu Worte kam? Wenn der Betroffene wieder »gute Miene« (zum bösen Spiel) machen kann? Wenn er sich (uns zuliebe) wieder hoffnungsvoll und zukunftsorientiert zeigt, damit wir beruhigt sind? Ich habe diesem Buch ein Gedicht von Hans Curt Flemming vorangestellt. Es ist die Zusammenfassung all dessen, was ich in Bezug auf die Begleitung von Trauernden, in Bezug auf das Trösten schlechthin, für gut und sinnvoll halte: »Weiter weinen als allein ...«. Wir können uns schwer vorstellen, dass jemandem ein besonderer Dienst erwiesen wurde, wenn wir ihm ermöglicht haben, weiter zu weinen, als er es allein gekonnt hätte. Haben wir da- 12 mit nicht alles noch schlimmer gemacht? Die weit verbreitete Angst steigt auf, bereits erworbene Stabilität könnte erschüttert und Wunden aufgerissen werden. Unsere eigenen Erfahrungen mit Tod und Trauer, seien sie noch so früh entstanden, prägen unsere Weltsicht, unsere Meinung, über das, was gut und richtig ist bezogen auf den Umgang mit starken Gefühlen und tiefen Erfahrungen. Daraus entstehen vertraute Gewohnheiten, die sich in bestimmten Situationen (automatisch) einstellen. Mehr noch: in Belastungssituationen und in Krisen kommen unsere Überzeugungen über das Leben zu Tage, unsere Glaubenssätze und Einstellungen, die entweder lösungsorientiert oder problemverstärkend sind. Für professionelle wie ehrenamtliche Begleiter heißt das: persönliche Erfahrungen beeinflussen uns in großem Maß im Umgang mit Tod und Trauer bei anderen. Je heilvoller, gelungener, positiver unsere eigenen Begegnungen mit »Bruder Tod«, wie ihn Franz von Assisi vertrauensvoll nennt, abgelaufen und bewältigt worden sind, umso eher können wir andere hilfreich unterstützen, umso mehr wird es uns gelingen, Schmerz und Leid zuzulassen. Verletzende Erfahrungen in unserem eigenen Leben, die belastend und ungelöst geblieben sind, beeinflussen uns noch mehr. Sie steuern uns in die Enge oder in Sackgassen. Die Angst oder der Wunsch, Schmerz zu vermeiden, sind verständlich, aber keine guten Berater. Werden diese Erlebnisse aufgearbeitet, können wir anderen Menschen in ähnlichen Situationen hilfreich zur Verfügung stehen. Aus der eigenen Wunde kann dann ein besonderes Talent entwickelt werden. Hieraus leitet sich die Bedeutung von Fortbildung und Supervision für Professionelle und Ehrenamtliche ab, in fachspezifischen Aus- und Weiterbildungen ist entsprechende Selbsterfahrung ein wichtiger Bestandteil. Gleichermaßen können betroffene Eltern mit gelungenen oder gut verarbeiteten Erfahrungen einander zu wesentlichen Stützen in ihrer Trauerarbeit werden. Menschen, die sich ehrenamtlich in der Hospizarbeit engagie- 13 ren, haben oft selber beim Sterben eines Angehörigen gute Unterstützung erfahren und möchten diese weitergeben. Eine Mutter hat vor der Erkrankung ihres Sohnes und auch wieder nach seinem Tod in einem Sonnenstudio gearbeitet. Ein Jahr nach dem Tod ist sie entschlossen, sich eine neue Aufgabe zu suchen. Sie will nicht mehr »für die schöne Fassade« arbeiten und selber immer »gut drauf sein« müssen, sondern sich um behinderte oder alte Menschen kümmern. Ihre Erfahrungen und die Liebe, die sie gerne ihrem Sohn geschenkt hätte, sollen nun in neue Kanäle fließen. Eine Grundvoraussetzung für einen heilsamen Weg ist, dass alles, was sich zeigen will, unbewertet ans Tageslicht kommen darf. Alle Gedanken, alle Gefühle, alle Erinnerungen, alle Verhaltensweisen, die menschenmöglich sind, sollten Raum haben. Gut gemeinte Ratschläge sind oft Einschränkungen, weil sie in eine bestimmte – für gut befundene – Richtung weisen. Die eigene Zensur ist oft noch strenger als Urteile von außen. Statt des oft empfohlenen »Loslassens« geht es um das »Zulassen « all dessen, was gerade da ist. »Es ist, was es ist«, sagt der Dichter Erich Fried2 und gewährt der Realität, die sich zeigt, Vorrang vor Vernunft und Einsicht, vor Angst, Vorsicht und Erfahrung. Die gewährende und annehmende Haltung des »Es ist, was es ist« wächst aus der Liebe. Je liebevoller ich mit mir selbst umgehe, umso mehr kann ich dies auf wirksame und nachhaltige Weise mit anderen tun. Für einen heilsamen Trauerprozess brauchen wir diese Liebe. Wir brauchen dazu Geduld und Mut. Mut in Form von Ermut- igung und Zu-mut-ung, dass jeder seinen Lösungsweg finden kann. Trauer ist Arbeit, ein aufwendiger Prozess. Falsche Weichenstellungen auf dem Weg der Trauerbegleitung rühren oft daher, dass »Abkürzungen« gesucht werden, schnelle Lösungen für eine große Aufgabe, für ein lebenslanges Thema. Wenn anerkannt wird, dass der Trauerprozess der eingehenden und liebevollen, geduldigen Pflege von innen und von außen 14 bedarf, tun sich möglicherweise unverhofft wirksame Erleichterungen und ungeahnte Möglichkeiten auf. Aber Unverhofftes und Ungeahntes kann man nicht planen, nicht erzwingen, nicht erhoffen, nicht einmal ahnen. Man kann es – als Betroffener wie als Begleiter – nur für möglich halten und dafür offen sein, mit derselben Offenheit, die auch Unerwünschtes und Schweres zulässt. Es gibt viel zu lesen zum Thema Trauer. Ein Buch kann unterstützen, indem es Ideen, Modelle und Bilder anbietet, die jeder nach Bedarf wählt, wenn sie ihn ansprechen und ihm passend und nützlich erscheinen. Die Stärke eines persönlichen Begleiters liegt darin, die aktuelle und individuelle Situation zu erspüren und darauf einzugehen. Entscheidend wird sein, ob und wie das Wissen zur Umsetzung gelangt. Dies ist umso schwieriger, je mehr wir selber betroffen sind. In einer Fortbildungsgruppe wird der Suizid eines Familienmitglieds angesprochen. Eine Teilnehmerin sucht engagiert nach Wegen, wie sie die Menschen in ihrer Umgebung und die Gesellschaft schlechthin ermutigen kann, mit diesem Tabuthema offener umzugehen. Bei aller Entschlossenheit fällt auf, dass das 6-jährige Enkelkind der Teilnehmerin noch nicht erfahren hat, dass sich der Großvater vor zwei Jahren suizidiert hat. Vieles, was der Erfahrung im Umgang mit trauernden Eltern erwachsen ist, ist auf andere schwerwiegende Verluste und auf die Trauer um Menschen anderer Lebensalter zu übertragen. Bezogen auf das Schicksal von Kindern, die sterben, und deren Eltern sind wir möglicherweise sensibler und offener, um gute Formen des Begleitens und der Trauerbewältigung zu finden. Dieses Buch ist entstanden im Kontakt und in der Begleitung von verwaisten Familien der onkologischen Kinderstation der Universitätskliniken in Würzburg. Es sind Schätze, die ich dort gesammelt habe und die mich für meine weitere Arbeit mit schwerkranken Kindern und ihren Familien gestärkt haben. Alle Beispiele sind unterschiedliche Weisen, mit dem Tod des eigenen Kindes umzugehen. Jede persönliche Variante ist ein 15 Beitrag zu einem großen Erfahrungsschatz der Menschheit. Werden diese mit-geteilt, können sie sich zum Nutzen vieler entwickeln: als Orientierung, als Entlastung, als Anregung, als Bestätigung. Dieses überarbeitete und erweiterte Buch gliedert sich in vier Teile. Im ersten Kapitel werden verschiedene Zeiten der Trauer beschrieben, angefangen bei den schmerzlichen Erfahrungen der zerstörten Hoffnungen vor dem Tod bis hin zum Erinnern als lebenslangem Prozess. Das zweite Kapitel bietet Bilder an, die vorrangig betroffene Eltern bei der Bewältigung ihres Trauerweges unterstützen können und Begleitern eine Vorstellung geben, wie sie hilfreich dazu beitragen können. Im dritten Kapitel wird ein Nachsorgemodell vorgestellt, das in der Darstellung seiner Methoden und Strukturen professionellen Trauerbegleitern und Selbsthilfegruppen Anregungen geben will. Abgerundet wird dieses Buch durch das neu hinzugefügte vierte Kapitel »Der getroste Begleiter« – wie uns die Begegnung mit Tod und Sterben stärken kann. Insbesondere professionell Begleitenden sollen hier Ideen und Haltungen vorgestellt werden, die der eigenen Psychohygiene dienen und die es ermöglichen, den Umgang mit Trauer und Leid von anderen Menschen gut zu verkraften, was auch sehr im Sinne der trauernden Eltern sein dürfte. Der Lesbarkeit wegen habe ich mich für die herkömmliche Schreibweise entschieden und überwiegend die männliche Form gewählt. Immer meine ich Menschen, Frauen und Männer, Schwestern und Brüder, Begleiterinnen und Begleiter. 16 |
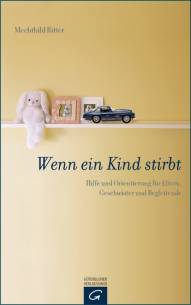
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen