|
|
|
Umschlagtext
Grammatik der deutschen Sprache
- Systematisch: Erklärt anhand aktueller Textbeispiele den Sprachaufbau und den Gebrauch sprachlicher Mittel und unterscheidet konsequent zwischen den Normen der geschriebenen und der gesprochenen Sprache - Leicht verständlich: Sprachsystem und Grammatikregeln sind auch für den Laien nachvollziehbar in übersichtlicher Form dargestellt - Benutzerorientiert: Mit Hilfe des ausführlichen Registers findet der Benutzer zielgerichtet Antwort auf seine Fragen - Zuverlässig: Sprachsystem und Grammatikregeln entsprechen dem heutigen Schulgebrauch Rezension
Es wurde in letzter Zeit viel über die deutsche Rechtschreibung diskutiert. Dabei kam die Grammatik der deutschen Sprache leider ein wenig zu kurz, denn auch hier werden viele Fehler gemacht. Damit dies nicht passiert, ist ein Nachschlagewerk wie das vorliegende von WAHRIG eine unersetzliche Hilfe. Es stellt das Sprachsystem - die Grammatik im engeren Sinne - und den Sprachgebrauch der Gegenwartssprache dar. Dabei werden die wichtigsten Regeln der deutschen Grammatik anschaulich erläutert und dargestellt. Das Besondere an diesem Nachschlagewerk zur deutschen Grammatik ist die Beschreibung der sprachlichen Mittel (Laut, Wort, Satzglied, Satz) in unterschiedlichen sozialen Situationen.
Arthur Thömmes, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Diese gut lesbare, allgemein verständliche Grammatik der deutschen Sprache ist ein umfassendes Handbuch zum deutschen Sprachsystem und zur richtigen Verwendung unserer Sprache. Sie entspricht in Inhalt und Präsentation den Anforderungen des Schulunterrichts und ist vollständig in neuer Orthografie abgefasst. Alle wichtigen grammatischen Begriffe und Regeln werden anhand zahlreicher aktueller Textbeispiele erklärt. Die auf modernen sprachwissenschaftlichen Erkenntnissen basierenden Kapitel zu Text- und Gesprächstypen, Dialekten, Fachsprachen sowie zur Bedeutung von Sprache in Medien und Gesellschaft informieren über interessante Aspekte mündlicher und schriftlicher Kommunikation und sensibilisieren für alltägliche sprachliche Phänomene. Ein ausführliches Register erleichtert die schnelle Orientierung. Inhaltsverzeichnis
DAS WORT
I. Die Wortarten Flektierbare Wortarten Nicht flektierbare Wortarten Das Verb Morphologische Unterscheidung der Verben Finite und infinite Verbformen Finite Verbformen <» Regelmäßige und unregelmäßige Verben Infinite Verbformen Der Infinitiv Das Partizip I Das Partizip II Trennbare und untrennbare Verben Syntaktische Unterscheidung der Verben Vollverben und Hilfsverben Das Formensystem der Hilfsverben Die Vergangenheit mit haben/sein Das Formensystem der modalen Hilfsverben Der Gebrauch der Hilfsverben und modalen Hilfsverben Die Bedeutung der modalen Hilfsverben Persönliche und unpersönliche Verben Reflexive und reziproke Verben Reflexive Verben Reziproke Verben Verben und Ergänzungen Die Valenz des Verbs Semantische Unterscheidung der Verben Die Aktionsarten Klassen der Aktionsarten Formen der Aktionsarten Die Funktionsverben Syntaktische Merkmale der Funktionsverbgefüge Liste der Funktionsverbgefüge Das Tempus Funktionen der Tempora Das Präsens Das Präteritum Das Perfekt Das Plusquamperfekt Das Futur I Das Futur II Empfehlungen zum Gebrauch der Tempora Die Zeitenfolge (Consecutio temporum) Das Genus des Verbs: Aktiv und Passiv Das Formensystem von Aktiv und Passiv Die Funktionen von Aktiv und Passiv Konkurrenzformen des werden-Passivs („Passiversatzformen") Werden- und sein-Passiv Das „unpersönliche" Passiv Der Modus und die Modalität Die Modi Tempusparadigma und Konjunktivparadigma Der Indikativ Der Konjunktiv Empfehlungen zum Gebrauch des Konjunktivs Der Imperativ Lexikalisch-pragmatische Mittel der Modalität Adverbien Modalpartikeln Modale Wortgruppen Modale Hilfsverben Haben/sein + Infinitiv mit zu Der Gebrauch der würde-Form Das Substantiv Die Deklination des Substantivs Die Kasus des Substantivs Die Deklination im Singular Substantiv und Deklinationstyp Die Deklination im Plural Substantiv und Deklinationstyp Doppelfi^rmen bei der Pluralbildung Die Deklination der Fremdwörter Die Deklination der Eigennamen Die Deklination der geographischen Namen Die Deklination von Straßen-, Firmen-, Institutions-, Zeitschriften-, Schiffs- und Flugzeugnamen Die Deklination der Völker- und Städtenamen Die Deklination von Kurz- und Abkürzungswörtern Wegfall der Deklination Die Deklination der substantivierten Verben. Adjektive und Partizipien Der Numerus des Substantivs Singular und Plural Die Valenz des Substantivs Das Genus des Substantivs Grammatisches Geschlecht - natürliches Geschlecht Das Genus der Konkreta und Abstrakta Das Genus der Eigennamen Das Genus der geographischen Namen Das Genus der Schiffs-, Flugzeug- und Kraftfahrzeugnamen Das Genus der Kurz- und Abkürzungswörter Das Genus der Zusammensetzungen Schwankendes Genus Erkennbarkeit des Genus Bedeutungsgruppen des Substantivs Konkreta und Abstrakta Das Adjektiv Die Deklination des Adjektivs Die starke Deklination Die schwache Deklination Die gemischte Deklination Besonderheiten der Deklination Die Deklination substantivierter Adjektive und Partizipien Die Komparation des Adjektivs Die Steigerungsformen Der Positiv Der Komparativ Der Superlativ Der Gebrauch des Adjektivs Attributiv und prädikativ gebrauchte Adjektive Attributiv gebrauchte Adjektive Prädikativ gebrauchte Adjektive Die Valenz des Adjektivs Adjektive mit einer Ergänzung Adjektive mit zwei Ergänzungen Adjektive mit drei Ergänzungen Das Zahladjektiv Die Kardinalzahlen Die Ordinalzahlen Die Bruchzahlen Die Gattungszahlen Die Vervielfältigungszahlen Die Einteilungszahlen Die unbestimmten Zahladjektive Die Artikelwörter Liste der Artikelwörter Die Deklination der Artikelwörter Wichtige Funktionen des bestimmten, unbestimmten und des Nullartikels Verschmelzungen des bestimmten Artikels mit einer Präposition Weitere Artikelwörter Das Pronomen Das Personalpronomen Das Personalpronomen der 1. und 2. Person Das Personalpronomen der 3. Person Das Reflexivpronomen Das Relativpronomen Die Deklination und der Gebrauch von der, die, das Der Gebrauch von deren - derer Die Deklination und der Gebrauch von welcher, welche, welches Die Deklination und der Gebrauch von »wund was Das Indefinitpronomen Der Gebrauch von man Die Deklination und der Gebrauch von jemand, niemand Der Gebrauch von etwas, nichts Es als Pronomen Der Gebrauch von es Nicht flektierbare Wortarten Das Adverb Die Komparation des Adverbs Die Klassifikation des Adverbs Die Lokaladverbien Die Temporaladverbien Die Modaladverbien Die Kausaladverbien Die Pronominaladverbien Besonderheiten des Gebrauchs des Adverbs Die Präposition Präposition und Kasus Präpositionen mit einem Kasus Präpositionen mit zwei Kasus Präpositionen ohne Kasusrektion Semantische Gliederung der Präpositionen Besonderheiten des Gebrauchs der Präpositionen Die Konjunktion Koordinierende Konjunktionen Besonderheiten des Gebrauchs der koordinierenden Konjunktionen 318 Satzteilkonjunktionen Subordinierende Konjunktionen Konjunktionen, die rnfinitivkonstruktionen einleiten Die Partikeln Die Modalpartikeln Der Gebrauch der Modalpartikeln Die Gradpartikeln Der Gebrauch der Gradpartikeln Die Negationspartikel Nicht und kein Besonderheiten der Negation Die Interjektion und das Satzwort Die Interjektionen Die Satzwörter Ja, nein, doch Bitte, danke II. Die Wortbildung Wortfamilien und Wortfelder Die Struktur des Wortes Wortbildungsmittel der deutschen Sprache Wortbildung durch Zusammensetzung (Komposition) Arten der Zusammensetzung Wortbildung durch Zusammenbildung Wortbildung durch Ableitung (Derivation) Ableitung durch Vorsilben oder Nachsilben (explizite Ableitung) Ableitung durch Ablaut oder Konsonantenveränderung (implizite Ableitung) Wortbildung durch Umbildung Wortbildung durch Kürzung Wortbildung durch Terminologisierung Wortbildung des Substantivs Wortbildung des Verbs Wortbildung des Adjektivs Tendenzen der Wortbildung DER SATZ Was ist ein Satz? Proben der operationalen Satzgliedanalyse Satzarten Aussagesätze Aufforderungssätze Wunschsätze Fragesätze Umwandlung der Satzarten Satztypen Der einfache Satz Das Prädikat Die Satzglieder Konstitutive Satzglieder Ergänzungen und Angaben Die Attribute Der zusammengesetzte Satz Die Satzverbindung (Parataxe, Koordination) Das Satzgefüge (Hypotaxe) Form der Nebensätze Ergänzungssätze Dass-Sätze, ob-Sätze, «'-Sätze Dass-Sätze Dass-Sälze und »»-Sätze Oft-Sätze und «»-Sätze Infinitivsätze Besonderheiten des Gebrauchs Die Korrelate Angabesätze Kausalsätze Temporalsätze Modalsätze Konsekutivsätze Konzessivsätze Finalsätze Konditionalsätze Adversativsätze Weiterführende Nebensätze Attributsätze Satzbaupläne Subjektlose Sätze Verb + Subjekt (Nominativergänzung) Verb + Subjekt + Akkusativergänzung Verb + Subjekt + Akkusativergänzung + Akkusativergänzung Verb + Subjekt + Genitivergänzung Verb + Subjekt + Genitivergänzung + Akkusativergänzung Verb + Subjekt + Dativergänzung Verb + Subjekt + Dativergänzung + Akkusativergänzung Verb + Subjekt + Präpositionalergänzung Verb + Subjekt + Akkusativergänzung + Präpositionalergänzung Verb + Subjekt + Situativergänzung Verb + Subjekt + Akkusativergänzung + Situativergänzung Verb + Subjekt + Richtungsergänzung Verb + Subjekt + Akkusativergänzung + Richtungsergänzung Verb + Subjekt + Einordnungsergänzung Verb + Subjekt + Akkusativergänzung + Einordnungsergänzung Verb + Subjekt + Artergänzung Verb + Subjekt + Akkusativergänzung + Artergänzung Verb + Subjekt ( + Akkusativergänzung) + Infinitivergänzung Satzgliedstellung Faktoren für die Bestimmung der Satzgliedfolge Hauptstellungstypen im einfachen Satz Der Kernsatz Der Stirnsatz Der Spannsatz Satzfeld und Satzklammer Besetzung des Vorfeldes Thema-Rhema-Struktur Besetzung des Nachfeldes Besetzung des Mittelfeldes Die Stellung von nicht Satznegation und Satzteilnegation (Sondernegation) Besonderheiten der Stellung von nicht Stellungsregeln innerhalb komplexer Satzglieder sowie beim mehrgliedrigen Prädikat Besonderheiten der Stellung einzelner Wortarten Grammatische Kongruenz Subjekt und finites Verb Substantiv und Artikelwort Substantiv und dazugehöriges Adjektiv bzw. Apposition Substantiv/Pronomen und Korrelat es Substantiv/Pronomen und Einordnungsergänzung Vom Satz zum Text Was ist ein Text? Elemente der Textanalyse Textsorten DER TEXT Sprache und Sprachgebrauch Faktoren der Verständigung Grammatik und Praxis Sprachgebrauch: Kommunikation im Vollzug Zeichen Sprachliche und nicht sprachliche Zeichen Kommunikation und Interaktion Kommunikation als sprachliches Handeln Meinen und Bedeuten: vom Sinn des Sprechens Die Bedeutung der Wörter Die Akte des Sprechens Gesprächstypen und Texttypen Dialog und Text Gesprochene Sprache - geschriebene Sprache Dialoggrammatik Dialoge in der Literatur - Gespräche im Alltag Gesprächstypen Möglichkeiten der Einteilung Beratungsgespräch Konversation - oder: Partygespräch Texttypen Gattungen und Textsorten Textklassen Stiltypen und Stilmittel Sprachstil Stilbegriffe Stilnormen Stil und Grammatik: Auswahl aus dem Sprachsystem Stiltypen Stilebenen, Stillagen, Stilschichten Funktionalstile Stilregister Redestile* Stilmittel Möglichkeiten der Einteilung Stilelemente Stilfiguren Sprachliche Varianten Einheit und Vielfalt der Sprache: sprachliche Normen - soziale Normen Historische Variation: Sprachwandel Die Formen des Deutschen Deutsch als Nationalsprache in vier Varianten Deutsch an den Rändern Deutsch in Sprachinseln Deutsch von Ausländern, Deutsch für Ausländer Regionale Variation: Dialekte Dialekt als Sprachbarriere Dialekt und Schule Dialekt und Standardsprache Pflege des Dialektes und Erziehung zur Standardsprache Soziale Variation: Soziolekte Sondersprachen Gruppensprachen ,Jugendsprachen': Variation und Alter ,Frauensprachen': Variation und Geschlecht Sprachschichten, Sprachbarrieren Sprache als soziales Symptom Fachsprachen Fachsprachen im Alltag Fachsprachen in Texten Der Begriff,Fachsprachen' Wortschatz und Satzbau in Fachsprachen Zeichenklassen Wortschatz und Terminologie Wortbildungsprozesse Morphologie Syntax Gliederung der Fachsprachen Fächer und Fachsprachen Fachsprachliche Ebenen, Stufen, Textsorten Fachsprachen als Geheimsprachen? Sprache und Institution Amtsdeutsch Alltagssprache und institutionelle Kommunikation Zum Begriff der Institution' Die Vielfalt der Institutionen Institution und Sprache Institutionelle Kommunikation im Gesundheitswesen: Gespräche zwischen Arzt und Patienten Institutionelle Kommunikation im Rechtswesen: Gespräche zwischen Richter und Angeklagtem Institutionelle Kommunikation in Verwaltungsbehörden: Gespräche auf dem Sozialamt Sprache in den Massenmedien Öffentliche Kommunikation Journalisten-Jargon Die Verständlichkeit von Texten: Produktion und Rezeption Massenkommunikation Mediensorten Printmedien: Presse Auditive Medien: Hörfunk Audiovisuelle Medien: Film und Fernsehen Textsorten in den Massenmedien Zum Beispiel: Nachrichten Alternative Medien, neue Medien Alternativpresse Lernen mit neuen Medien Sprache und Erziehung Sprachnorm und Sprachpflege Einheit der Normen und Vielfalt der Sprache: ein Rückblick Vom richtigen und vom guten Sprachgebrauch Spracherwerb und Sprachunterricht Spracherwerb und Sprachentwicklung Sprachunterricht und Spracherziehung Sprachkritik und Sprachkultur ABKÜRZUNGEN UND ZEICHEN SACHREGISTER |
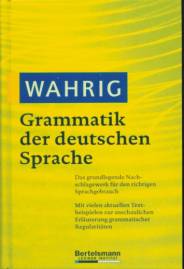
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen