|
|
|
Umschlagtext
Dieses Buch gibt beispielhafte Einblicke in die schulische Praxis von Wochenplanunterricht und Freiarbeit im Sprachenunterricht der Sekundarstufe 1.
Die einzelnen Beiträge beziehen sich auf verschiedene konzeptionelle Zugänge und unterschiedliche Realisierungsmöglichkeiten. Es werden nicht nur methodisch erprobte Wege und Strategien der praktischen Umsetzung aufgezeigt, sondern sich auch mit den während des Unterrichts unvermeidlich auftretenden Problemen und Schwierigkeiten befasst. Konkrete Anregungen und zahlreiche Hinweise für die Praxis runden die mit viel Engagement geschriebenen Berichte der Autorinnen und Autoren ab. Insgesamt entsteht ein facettenreiches Bild aus persönlichen Erfahrungen und gelungener Theorie-Praxis-Verzahnung, das der Leserschaft Mut macht und zeigt, dass die bessere Schule schon mit kleinen Schritten möglich ist. Der Herausgeber: Eiko Jürgens, Prof. Dr. phil. habil., hat lang jährig in verschiedenen Schulformen des allgemeinbildenden Schulwesens gearbeitet. Seit 1991 ist er als Professor für Schulpädagogik zunächst in Köln ‚seit Ende 1994 in Bielefeld tätig. Außerdem führt er seit zehn Jahren Fortbildungen für Lehrer, Schulleiter und die Schulaufsicht vor allem in Bereichen der Leistungsbeurteilung, der Reformpädagogik und des Offenen Unterrichts, der Schulentwicklung und Schulprogrammatik durch. Inhaltsverzeichnis
Vorwort mit Hinweisen zu den Beiträgen XI
EIKO JÜRGENS Mut zur Öffnung von Unterricht und Nachdenken über Freiarbeit und Wochenplanunterricht 1. Einordnung der Freiarbeit in den Kontext Offenen Unterrichts 1 2. Offenheit: Was ist damit gemeint? 2 3. Definitionen Offenen Unterrichts 3 4. Was ist unter Freiarbeit zu verstehen? 6 5. Zur Begriffsbestimmung von Freiarbeit 10 6. Was ist Wochenplanarbeit im Unterschied zu Freiarbeit? 12 7. Weiterentwicklung der Wochenplanarbeit und Verknüpfungsmöglichkeit mit Freiarbeit und Projektlernen 13 Literatur 14 Fachbezogener Sprachunterricht Deutsch ANNETTE BROCKÖTTER Die Arbeit mit der Lernkartei. Eine individuelle Fördermöglichkeit im Rahmen der Wochenplanarbeit einer Hauptschulklasse. 1. Die Ausgangssituation 16 2. Der erste Schritt: Feststellung des Förderbedarfs 17 3. Welche Voraussetzungen gibt es? 18 4. Wie fangen wir an? 20 5. Wie geht es weiter? 22 6. Und die Motivation der Kinder 26 7. Methodenkompetenz 26 Literatur 27 ANETTE MERTENS So geht‘s — Freiarbeit im Deutsch unterricht der 5. Klasse einer Realschule 1. Wie alles anfing—Viele Fragen! 28 2. Wie sag‘ ich‘s meinen Kollegen? 30 2.1 Schulorganisatorische Fragen 30 2.2 Kollegiumsinterne Aspekte 31 3. Wie kann ich Freiarbeit organisieren? 33 3.1 Voraussetzungen bei den Schülerinnen 33 3.2 Zeitpunkt/Dauer 34 3.3 Klassenraumgestaltung 34 3.4 Was benötigen die Schüler? 35 3.5 Regeln für die Freiarbeit 37 3.6 Die erste(n) Freiarbeitsstunde(n) 38 4. Wie beschaffe, gestalte und ordne ich Freiarbeitsmaterial? 39 4.1 Mögliche Bereiche der Freiarbeit im Deutschunterricht 39 4.2 Die Ordnung des Materials 40 4.3 Vorschläge und Adressen für die Materialbeschaffung 42 4.4 Materialbeispiele 43 5. Wie bewerte ich Freiarbeit? 45 6. Das Wichtigste in Kurzform 48 7. Was hat‘s bisher gebracht? Wie kann‘s weitergehen? 49 Literatur 49 CHRISTOPH KÜCH Einführung von Wochenplanarbeit im Fach Deutsch der 6. Klasse einer integrierten Gesamtschule 1. Planung: Didaktisch-methodische Überlegungen 51 2. Lernmöglichkeiten 55 3. Darstellung und Reflexion der Unterrichtsreihe 55 3.1 Kurzübersicht 56 3.2 16 Stunden Wochenplanunterricht 57 4. Gesamtreflexion 68 Literatur 72 URSULA WEIß „Irgendwann braucht jedermann ein Buch, mit dem er reden, lachen, weinen, träumen, reisen kann.“ Eine Lese-Werkstatt für die Sekundarstufe 1. Mein Weg zu einem veränderten Unterricht 82 2. Eine Prise Theorie zum Auftakt: Was ist eine Erfahrungswerkstatt? 84 3. Praxisbeispiele aus der Lesewerkstatt 85 4. Die Werkstatt-Einrichtung 99 5. Schlussbemerkung 100 Literatur 100 DIETER VAUPEL Mit Wochenplänen den Deutschunterricht in der Sekundarstufe öffnen 1. Was sagen wochenplanerfahrene Schüler? 101 2. Lernen — eine zwangsläufige Form von Belehrung? 102 3. Was ist ein Wochenplan? 103 3.1 Vom Tagesplan zum Wochenplan 104 3.2 Zweite Einstiegsmöglichkeit: Zielgerichtete Arbeit an einer Aufgabe 105 3.3 Ein überschaubarer Wochenplan: Anagramm und Geschichtenbuch 107 3.4 Deutsch als Bestandteil eines Wochenplans mit mehreren Fächern 109 3.5 Offene Wochenplangestaltung 111 Literatur 114 RENATE THIEL Nur Mut zum Einsatz des Computers im Deutschunterricht 1. Hemmnisse überwinden 121 2. Computer als nützliches Hilfsmittel 122 3. Vom Förderunterricht zum Deutschunterricht 123 4. Unterstützung der Ziele des Deutschunterrichts 124 Englisch BERND MUNDERLOH Vermittlung von Schlüsselqualifikationen — aber wie? Zwei Beispiele aus dem Englischunterricht der Mittelstufe 1. Einleitung 127 2. Wochenplanarbeit mit dem Lehrbuch in Klasse 8 128 2.1 Vorgehensweise 128 2.2 Auswertung der Wochenplanarbeit (Schüler) 129 2.3 Auswertung der Wochenplanarbeit (Lehrer) 130 3. Unterrichtsprojekt „English in Germany“ in Klasse 9 131 3.1 Vorgehensweise der einzelnen Gruppen 132 3.2 Ergebnisse des Projektes 132 3.3 Auswertung (Methode / Schüler) 133 3.4 Auswertung (Methode / Lehrer) 134 4. Schluss(-folgerung) 134 Literatur 134 Französisch GÜNTER KRAUKE Fotos — Dialoge — Sketche zur Förderung von geöffneten Lernsituationen Im Französischunterricht 1. Erlebtes Lernen — Rückblick und Ausblick 143 2. Rahmenbedingungen 144 3. Fazit 144 4. Eckpunkte für freiere Lernarrangements im Französischunterricht 145 5. Beispiele zur Arbeit in geöffneten Lernphasen 147 5.1 Falsch/wahr? A 147 5.2 Je suis fatigué B 148 5.3 Lesinconnus B/C 149 5.4 Einzelfotos B/C 150 5.5 La télé D 154 5.6 La télé — Notre journal D 156 5.7. Étapix raconte B/D 156 5.8 Dreier-Bildgeschichte D 158 5.9 Vorbereitung für den Austausch B/C/D 159 6. Schlussbemerkung 162 Latein FRED RADEWALDT Schüler arbeiten auch ohne mich. Erfahrungen mit Wochenplanarbeit im Lateinunterricht 1. Einleitung 163 2. Gestaltung der Wochenpläne 164 3. Anforderungen an die Schüler 165 4. Selbstkontrolle der Arbeitsergebnisse 166 5. Schülerverhalten 167 6. Lehrerrolle 167 7. Einsatz von Wochenplänen im Fach Latein 169 8. Fazit 171 Literatur 171 WULF BRENDEL Lebendiges Latein — schülerzentrierter Unterricht in der Lehrbuchphase 1 Einleitung 180 2. Grundsätzliches 181 3. Phase 1: Texterschließung 181 4. Phase II: Textvertiefung 182 5. Phase III: Grammatikübung 185 6. Zusammenfassung 187 Literatur 187 Überfachlicher Sprachunterricht MANFRED BRANDT Schritt für Schritt selbständiger 1. Ein Weg zur Einführung offener Unterrichtsformen 205 2. Die Überraschung 205 3. Der Hintergrund 206 4. Der lange, gewundene Weg 207 4.1 Der erste Schritt: Ein Projekttag 207 4.2 Der zweite Schritt: Schwerpunktgruppen 208 4.3 Der dritte Schritt: Auflösung der strikten Gruppenstruktur 210 4.4 Der vierte Schritt: Individualisierung 213 4.5 Der fünfte Schritt: Beratung 215 5. Lob der Flexibilität 217 Literatur 218 GABRIELE ROENTGEN / TORSTEN STEININGER Ein fächerübergreifendes Projekt zum Thema „Hexen“ 1. Vorstellung des Hexenprojekts 219 2. Beschreibung der Segmente des Projektes 221 2.1 Die Materialgruppe Deutsch 221 2.2 Die Materialgruppe Geschichte 222 2.3 Die Materialgruppe Englisch 223 2.4 Die Möglichkeit weiterer Materialgruppen 223 2.5 Die Form des Produkts 224 Literatur 224 BRIGITTE MUNSCH Fachunabhängiges Freies Arbeiten in der Sekundarstufe. Drei Schulen — drei Konzepte 1. Einleitung 235 2. Von der Skeptikerin zur Verfechterin 235 3. Meine Erfahrungen mit freiem Arbeiten an der Kurt-Tucholsky-Gesamtschule in Krefeld 236 3.1 Der Jahrgang 5/6 und seine Materialien 236 3.2 Die Einführung der Materialien 236 3.3 Immer diese Unruhe 237 3.4 Die Problemkinder 238 3.5 Das Kontrollsystem 239 4. Der Jahrgang 7/8 mit der Fachanbindung und den Themenmappen 240 5. Der Jahrgang 9/10 als Endspurt 241 6. Bewertung der Arbeitsergebnisse 242 7. Das Material 243 Angaben über die Autorinnen und Autoren 252 |
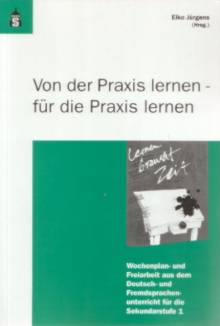
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen