|
|
|
Rezension
Beim ersten Blick in das Inhaltsverzeichnis des Buches fällt die Zweiteilung des Buches in " Literatur" und "Kommunikation und Sprachreflexion" auf. Damit nennt das Autorenteam seine Schwerpunkte, die sich an den Lehrplanvorgaben der jeweiligen Bundesländer orientieren.
Es ist also kein klassisches Lesebuch, also vorrangig eine Zusammenstellung von Texten, sondern in erster Linie ein Arbeitsbuch. Es enthält deswegen im ersten Teil auch Anregungen zur Lektüre und bietet Hilfestellung für Schülerinnen und Schüler der Oberstufe zum besseren Verständnis und zur Einordnung der Litreratur einer bestimmten Epoche. Die Konzeption des vorliegenden Werkes folgt dem Leitgedanken: Am besten versteht man eine Sache, wenn man sie selber macht. Auf der Basis dieses Leitgedankens möchte das Buch in seinem ersten Teil zu einem besseren Verständnis des Produktionsprozesses von Literatur verhelfen. Die verschiedenen literarischen Epochen und Gattungen werden ansprechend dargestellt. Entsprechende Arbeitsaufträge die vom Schüler selbstständig oder in Arbeitsgruppen werden können sind vorhanden. Den zweiten Teil des Arbeitsbuches widmen die Autoren dem Bereich der Kommunikation. Dabei werden sowohl Grundlagen der Kommunikation, wie auch Möglichkeiten der Sprachreflexion vorgestellt. Mit Beispielen aus dem Alltagsleben wird hier in sehr fundierter Form ein immer wichtiger werdendes Grundgerüst für Studium und Beruf angeboten.Dafür ist das letzte Buchkapitel mit der Überschrift: Schriftliches Argumentieren - Erörterung und Facharbeit ein guter Beleg, Schülerinnen und Schüler werden im Hinblick auf ihre eigene Facharbeit für die Anregungen dieses Kapitels dankbar sein. Ingesamt also eine Wohltat für alle, die sich im Rahmen des Deutschunterrichts der Oberstufe mit dem Thema Kommununikation beschäftigen wollen. Frank Kohl, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Dieses einbändige Arbeitsbuch bietet Material für alle Lernbereiche des Deutschunterrichtes der gesamten Sekundarstufe II. Damit unterstützt „Überschrift Deutsch“ den Unterricht genau in den Bereichen, die nicht durch die Ganzschriftlektüre abgedeckt werden. Durch die zahlreichen Aufgaben ist „Überschrift Deutsch“ mehr als eine bloße Textsammlung und setzt gleichzeitig einen Schwerpunkt auf den produktiven und handlungsorientierten Umgang mit Literatur, ohne auf die Textanalyse zu verzichten. Das eigene Schreiben der Schülerinnen und Schüler steht dabei aber im Vordergrund, so dass es dieses Oberstufenbuch ermöglicht, Schreiberfahrungen zu machen und Schreibprozesse zu reflektieren. Auf diese Weise hilft „Überschrift Deutsch“ den Schülerinnen und Schülern den Literatur- und Sprachproduktionsprozeß zu verstehen. Das Buch orientiert sich nachdrücklich an den Interessen, Motiven und Herangehensweisen von Jugendlichen. Dabei führt es durch eine intensive Auseinandersetzung mit Wesentlichem zu Kenntnissen über literarische Gattungen, Formen und Stilmittel, problematisiert mündlichen Aspekte der Kommunikation und trainiert die schriftliche Erörterung. Neben den „klassischen“ und für ein Oberstufenbuch unverzichtbaren Texten enthält „Überschrift Deutsch“ viele kaum bekannte und erstmals in einem Schulbuch erscheinende Texte aus Gegenwart und jüngster Vergangenheit. Besonders wird auch die Literatur der ehemaligen DDR berücksichtigt. Mit seinem reichhaltigen Textangebot, seinen vielfältigen Materialien, seinen Aufgaben und Arbeitsanregungen in einer frischen Aufmachung bietet „Überschrift Deutsch“ das, was Lehrerinnen und Lehrer für einen anregenden Deutschunterricht benötigen. Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Vorwort 7 Teil I Literatur Kapitel 1 Autor und Text - Der Schreibprozess 8 1 . Einen Anfang setzen 8 2. Über das Schreiben 10 3. Bildirnpulse 14 4. Schreiben und Biografie 24 5. Arbeit am Mythos 30 6. Material auffinden - kombinieren - montieren 39 7. Vorher und nachher - Überarbeitung 46 Kapitel 2 Schreibhaltungen: Wozu schreiben? 50 1.Etwas festhalten 51 2. "Sich schreiben lassen" - Assoziationsverfahren 59 2.1 Automatisches Schreiben 59 2.2 Bewusstseinsstrom als literarische Technik 61 2.3 Clustern 64 2.4 Gedichte wachsen 65 3. Ein Zeichen setzen 66 4. Kontakt herstellen 70 4.1 Romantische Geselligkeit 70 4.2 Literarische Geselligkeit auf Japanisch 73 4.3 Surrealistische Geselligkeit 76 Kapitel 3 Literarische Gattungen 80 1 Epik: Erzählendes Schreiben 80 1.1 Erinnern 80 1.2 Aus "Ich wird Er" 81 1.3 Ich ist nicht Ich 84 1.4 Recherche und Maskierung 85 1.5 "Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind rein zufällig" 88 1.6 Figuren -und Handlungsentwicklung 90 1.7 Eine Figur wird lebendig 93 1.8 Auktoriales Erzählen 99 1.9 Personales Erzählen 101 1.10 Zeitgestaltung 106 1.11 Raum und Atmosphäre 109 1.12 Collage und Montage 113 2. Das Drama: Dialogisches Sprechen und Schreiben 120 2.1 Das Drama - eine Spielvorlage 120 2.2 Der dramatische Dialog 122 2.3 Dialogverlauf 126 2.4 dramatische Figur und Rolle 129 2.5 Figuren zum Leben erwecken 135 2.6 Die dramatische Handlung: Handlungsvariante 137 2.7 Das epische Theater Berthold Brechts 142 3. Lyrik, Schreiben von Gedichten 148 3.1.Gedichte an der Anschlagsäule 148 3.2. Dichter "schöner Wahnsinn"? Wie entstehen Gedichte? 150 3.3 Aus der Fassung geraten 156 3.4 Gedichte gebrauchen 158 3.5 Begegnung mit dem lyrischen Subjekt 160 3.6 bildhaftes Sprechen, Metapher und Vergleich 162 3.7 Experimente mit poetischen Bilder 166 3.8 Schreiben einen Vers machen 168 3.9 Das Wort und seine Strahlung 170 3.10 Das Gedicht in seiner Druckgestalt 172 Kapitel 4 Literatur und Tradition 174 1.Tradition wozu? Eine Einführung 174 2. Der Schriftsteller als Leser 179 3. Figuren der Weltliteratur -literarisch neugestaltet 182 4. Biblische Stücke - literarisch gestaltet 192 5. Wahrheit und Verwandlung 195 6. Auf dem Weg zu verschiedenen Traditionen? 199 Kapitel 5 Literatur und Gesellschaft - Epochen und Kultur 200 1. Die Epoche der Aufklärung (1680-1800) 200 1.1 Ein Zeitalter wird umrissen 200 1.2 Textarten und literarische Kurzformen: Aphorismus - Epigramm -Fabel 202 1.3 Die politisch-sozialen Umstände im Zeitalter der Aufklärung 203 1.4 Der literarische Markt 204 1.5 Philosophische Grundlagen der Aufklärung 207 1.6 Thema: Toleranz 212 1.7 Zur Entwicklung des Individuums- Erziehung zum Selbstbewusstsein ? 217 1.8 Thema: Utopie - Joh. G. Schnabel: Die Insel Felsenburg 224 2. Die Epoche der Romantik (1795 1840) 228 2.1 Die Begriffe Romantik und Aufklärung- romantisch im Alltagsbewusstsein 228 2.2 Die Romantik in Texten und Bildern 229 2.3 Zur Kunstauffassung der Romantik 234 2.4 Die Zeit der Romantik 235 2.5 Formen des Zusammenlebens 238 2.6 Das Motiv der Nacht 244 2.7 Texte zur Politik 249 2.8 Meinungen zur Romantik 253 3. Deutsche Literatur 1945-1995 256 3.1 Anstöße Schriftsteller und ihre Zeit 256 3.2 Literarischer Neuanfang oder Kontinuität? 258 3.3. Die literarische Auseinandersetzung mit dem Faschismus 265 3.4 Harte Zeiten - in West und Ost 271 3.5. Literatur und ihre Vermittlung 277 3.6. Ausblicke 281 Teil II Kommunikation und Sprachreflexion Kapitel 1 Kommunikation 284 1. Missverständnisse und Verstimmung 284 2. Kommunikationsanalyse 286 2.1 Kommunikationsmodelle 286 2.2 Nonverbale und verbale Kommunikation 288 2.3 Beziehungsformen in Gespräche 288 2.4 Kommunikationsanalyse als Hilfe bei der Deutung literarischer Texte 290 2.5 Kommunikationsanalyse als Hilfe bei der Bewältigung alltäglicher Probleme 293 3. Ungeschriebene Regeln der Kommunikation 294 3.1 Misslinngen der Kommunikation durch Missachtung kulturspezifischer Regeln 294 3.2 Gesprächskonventionen in anderen Kulturen 296 3.3 Erwerb von Komrnunikation - Ein Teil des Spracherwerbs 298 3.4 Denken Sprache Wirklichkeit 299 4. Gesprächsregeln für Gruppen 304 5. Der Vortrag eines Referat 306 6. Das Protokol 307 Kapitel 2 Sprachnormierung 308 1. Zur Einführung: Testen Sie ihr Sprachwissen! 308 2. Wegwerfsprache oder: Führt der Sprachwandel zur Sprachverhunzung? 310 3. Sprachregelungen, Sprachmoden und Sprachkritik- Fachreferate zu sprachgeschichtlichen Themen 314 4. Wörter und ihre Bedeutungen - Lexikalische Normierungen 316 4.1 Wörter erzählen von ihrer Geschichte 316 4.2 Lexikalische Normierung in der Alltagssprache- ein Netz von Farnilienähnlichkeiten 318 4.3 Enge Grenzen für Fachtermini 320 5. Schwierige Sätz - Grammatische Normen 322 5.1 Ohne Konjunktiv schreiben ? in die Werksstatt 322 5.2 Stirb schneller, Genitiv ! 325 6. Orthographische Leidenswege - Verschriftlichungsnormen 326 6.1 Groß- und Kleinschreibung 326 6.2 Das verflixte Komma- nur eine Wiederholung wichtiger Regeln? 327 7. Stilistisch pragmatische Normen 330 7.1 Mit fremdem Blick: Ausländer erleben deutsche Sprache 330 7.2 Wandel in den Höflichkeitskonventionen: Vom Siezen zum Duzen? 331 7.3 Vom Umgang mit kleinen Wörtern 333 8. Funktioniert unsere Sprache wie ein Computerprogramm? Eine Auseinandersetzung mit J. R. Searles Vorstellung vom "chinesischen Zimmer" 335 Kapitel 3 Sprache in der Öffentlichkeit 336 1. Sprache in den Medien: Recherche statt Hofberichterstattung - Wo Nachrichten herkommen 337 2. Das Wichtigste zuerst - Wie Nachrichten formuliert werden 345 3. Locker einsteigen pointiert aussteigen. Wie man durch Nachrichten unterhält 349 4. Angewandte Rhetorik 353 4.1 Parlamentsrede: Bonn oder Berlin? 353 4.2 Fragen an eine Rednerin 355 4.3 Abiturreden 358 Kapitel 4 Schriftliches Argumentieren - Erörterung und Facharbeit 362 1. Ohne Wissen keine Erörterung Beispiel: Gewalt in der Schule 362 1.1 Interessen feststellen und eine Aufgabenstellung formulieren 364 1.2 Wissenslücken feststellen 364 1.3 Informationen suchen 365 1.4 Anregungen für die Recherche vor Ort 366 1.5 Informationen auswerten und bewerten 368 2. Aller Anfang ist schwer ... - Einleitungen in eine Argumentation. Beispiel: Literatur und ihre Leser 369 3. Einen Gedankengang entwickeln. Beispiel: Literatur in der Schule 374 4. Textgebundene Erörterung. Beispiel: Streitgespräche um Werbung 377 5. Schriftliches Referat (Facharbeit). Beispiel: Ein umstrittener Roman: "Mephisto" von Klaus Mann 382 Anhang Lösungen 389 Epochenübersicht: Daten, Fakten, Text 393 Glossar - Sachregister 403 Quellenverzeichnis406 |
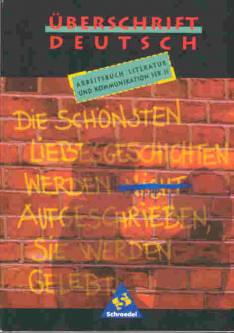
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen