|
|
|
Umschlagtext
Welcher literarische Status kann einem Bilderbuch ohne Text zugeschrieben werden? Ist literarisches und narratives Lernen überhaupt ohne Schriftsprache möglich? Oder: Lassen sich die Visual-Literacy-Studies mit der Bilderbuchtheorie und der Erzähldidaktik verknüpfen?
Während noch immer schriftdominierte Medien den Kern der Literaturwissenschaft und -didaktik ausmachen, legt diese Arbeit das literarische und narrative Potenzial einer Bilderbuchsparte offen, die nahezu ohne Text auskommt und über komplexe visuelle Narrationsformen verfügt. Erstmalig wird eine narratologisch-strukturelle Taxonomie der textlosen Bilderbücher entworfen, die sowohl die gestalterischen Dimensionen der unterschiedlichen Bilderbuchtypen, als auch die visuellen und sprachlichen Ansprüche an ihre Adressaten aufzeigt. Zu analysierten Beispielwerken werden ferner literar-ästhetische Konzepte für die Primarstufe vorgestellt, die das erzähldidaktische Potenzial dieser unterschätzten Literatursparte illustrieren. Anne Krichel, Lehramtsstudium für die Fächer Deutsch und Musik in Köln und Tübingen, war von 2012 bis 2016 als Grundschullehrerin und freiberufliche Musik- und Theaterpädagogin tätig. Derzeit ist sie Wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Arbeitsgruppe „Literatur – Bild – Medium“ an der Universität zu Köln mit den Arbeitsschwerpunkten „Visuelle Narration im textlosen Bilderbuch“ und „Digitale Literatur in der Grundschule“. Rezension
Sprach-, Lese- und Schreibkompetenzen dominieren dominieren als Schlüsselqualifikationen die Kompetenzerwartungen für das Fach Deutsch (in der Grundschule). Visuelle Narration und Bilderbuch begegnen hingegen nicht. Diese Tübinger Dissertation von 2019 wendet sich demgegenüber einer (nicht nur für die Deutschdidaktik der Grundschulpädagogik) relevanten Fragestellung der Germanistik und Deutschdidaktik zu: Anhand von textlosen Bilderbüchern wird die Frage gestellt: Ist literarisches und narratives Lernen überhaupt ohne Schriftsprache möglich? Welche Bedeutung kommt textlosen Bilderbüchern gegenüber den schriftdominierten Medien als Kern der Literaturwissenschaft und -didaktik zu? Welches literarische und narrative Potenzial hat diese Bilderbuchsparte? Davon ausgehende literar-ästhetische Konzepte sind selbstverständlich für die Primarstufe der noch nicht lese-fähigen 1. Klässler/innen von besonderer Relevanz.
Dieter Bach, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Pressestimmen: In diesem Buch findet das pädagogische Team zahlreiche Unterrichtsideen und Praxisbeispiele für den ganzheitlichen Einsatz von Bilderbüchern in der Grundschule. Der theoretische Hintergrund ist fundiert und ansprechend dargestellt. Eine ausführliche Literaturliste und ein Anhang zu den Materialien runden das Buch ab. Fördermagazin Grundschule 3/2021 Reihe: „Didaktik der deutschen Sprache und Literatur“ Herausgegeben von Johanna Fay, Carolin Führer, Johannes Mayer und Tanja Rinker Didaktik der deutschen Sprache und Literatur Die „Didaktik der deutschen Sprache und Literatur“, wie es im Reihentitel heißt, differenziert sich zunehmend in zwei Bereiche aus, der Sprachdidaktik und der Literaturdidaktik. Jeder Bereich versteht sich als eigene wissenschaftliche Disziplin mit speziellen Forschungsgegenständen, -fragen und -methoden. Mit der Reihe „Didaktik der deutschen Sprache und Literatur“ soll ein Fokus auf den gemeinsamen (Unterrichts-)Fachbezug gelegt und somit ‚wieder‘ eine Verbindung beider Teildisziplinen geschaffen werden. Dies kann eine tiefe Integration der beiden Perspektiven meinen, die die Grenzen zwischen ihnen auflöst, wie es zum einen in der Unterrichtspraxis und zum anderen (institutionell) in der Lehramtsausbildung in einigen Bundesländern zu finden ist. Es kann aber durchaus auch eine isolierte Betrachtung beider deutschdidaktischer Felder meinen, sofern ihr Verhältnis zueinander oder kongruente Themenfelder damit erhellt werden. In diesem Spektrum sind sowohl Beiträge zu konzeptionellen und grundlagentheoretischen bis hin zu empirisch-implementativen Untersuchungen willkommen. Dabei sollen Ansprüche und reale Herausforderungen solcher (Forschungs-)Unterfangen offengelegt und in besonderer Weise vor den theoretischen und empirischen Hintergründen aus den germanistischen Bezugsdisziplinen diskutiert werden. Alle Manuskripte müssen vor Aufnahme in die Reihe ein Begutachtungsverfahren positiv durchlaufen. Diese konsequente Begutachtung sichert den hohen Qualitätsstandard der Reihe. Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung 7
2 Von der Bildbetrachtung zur visuellen Narrationskonstruktion: Kognitive, visuelle und sprachliche Voraussetzungen der sequenziellen Bildrezeption 21 2.1 Definition und Abgrenzung erzähltheoretischer Termini 21 2.2 Visual Literacy – Ästhetisch-visuelle Rezeptionskompetenz 24 2.3 Zum Zusammenhang zwischen Bild- und Erzählerwerb 32 3 Narrative textlose Bilderbücher: Differenzierung und Termini 35 3.1 Das Bilderbuch – Definition, historische Entwicklung und aktuelle Trends 35 3.2 Das narrative textlose Bilderbuch – Definition, historische Entwicklung und aktueller Forschungsstand 39 3.2.1 Monoszenische Bilderbücher 47 3.2.2 Pluriszenische Bilderbücher51 3.2.3 Lineare Bilderbücher 55 3.2.4 Mehrperspektivische Bilderbücher 60 3.2.5 Künstlerbücher 64 3.3 Eine narrativ-strukturelle Taxonomie für das textlose Bilderbuch 67 3.4 Zur Korrelation zwischen dem narrativen textlosen Bilderbuch und der Sprach-, Erzähl-, Literatur- und Medienrezeptionskompetenz 70 4 Transmediale Analysen der visuellen Narrationsstrukturen in textlosen Bilderbüchern und literar-ästhetische Anschlusshandlungen 77 4.1 Ein transnarratologisches Analysemodell 77 4.1.1 Die visuelle Erzählinstanz 78 4.1.2 Dramaturgisch-formale Gestaltungsaspekte 85 4.1.3 Symbolische Zeichen- und Bildsprache 91 4.1.4 Fiktionalität 107 4.1.5 Visuelle Narrationsstrukturen im textlosen Bilderbuch – eine ‚Lese‘- Anleitung? 114 4.2 Die pluriszenische Wimmelbuchserie von Rotraut Susanne Berner (2003-2008) 116 4.2.1 Das Winter-, Frühlings-, Sommer-, Herbst- und Nacht-Wimmelbuch – eine textlose Bilderbuchserie 117 4.2.2 Kohärenz und Kohäsion durch formale Gestaltungsmittel und Bildbezüge 119 4.2.3 Zwischenfazit: Narrative Komplexität trotz Einfachheit 125 4.2.4 ‚Was das Jahr so alles bringt‘ – Literar-ästhetische Anschlusshandlungen zu Berners textloser Wimmelbuchserie 127 4.3 Das lineare Bilderbuch Huisbeestenboel von Loes Riphagen (2009) 129 4.3.1 Ein motivisch-mehrsträngiges Panoramabuch ohne Text 130 4.3.2 Visuelle Mehrsträngigkeit auf verschiedenen Fiktionalitätsebenen 132 4.3.3 Zwischenfazit: Fiktionale Komplexität trotz linearer Narrationsstrukturen 146 4.3.4 ‚Olifant und co. allein zuhause‘ – Literar-ästhetische Anschlusshandlungen zu Riphagens Panoramabuch 149 4.4 Das mehrperspektivische Bilderbuch Mr. Wuffles! von David Wiesner (2013) 151 4.4.1 Ein textloses Bilderbuch mit transmedialen Narrationsstrukturen 153 4.4.2 Dramatische Effekte durch filmische, comic- und bilderbuchspezifische Gestaltungsmittel 155 4.4.3 Zwischenfazit: Theory of Mind und Empathiefähigkeit als Voraussetzungen und Herausforderungen des mehrperspektivischen Bilderbuchs 174 4.4.4 ‚Rettet die Aliens!‘ – Literar-ästhetische Anschlusshandlungen zum mehrperspektivischen Bilderbuch Mr. Wuffles! 176 4.5 Das textlose Künstlerbuch Hans im Glück von Warja Lavater (1965) 178 4.5.1 Eine piktografische Neu-Interpretation eines lang tradierten Märchens 182 4.5.2 Narrative Komplexität durch die symbolische Gestaltung von Raum, Figuren, Settings und Objekten 187 4.5.3 Zwischenfazit: Abstraktion und Symbolik als kognitive und narrative Herausforderungen innerhalb der Visual Literacy 209 4.5.4 ‚Formen und Farben zum Leben erwecken‘ – Literar-ästhetische Anschlusshandlungen zum Künstlerbuch Hans im Glück 212 4.6 Das narrative textlose Bilderbuch – Ein literar-ästhetischer Gegenstand mit erzähldidaktischem Potenzial 214 5 Ausblick und Forschungsperspektiven 219 Literatur 225 Abbildungsverzeichnis 247 Anhang 248 |
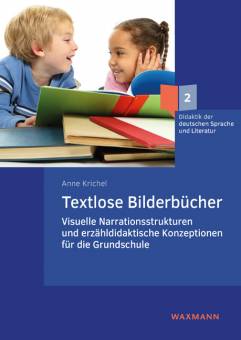
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen