|
|
|
Umschlagtext
Gefahrenpotential Glücksspiel erkennen und behandeln...
Automaten und Kasinospiele, Sportwetten und Rubbel-lose - die Möglichkeit zu einem schnellen »Spielchen« bietet sich an allen Ecken. Fast alle, die »eben mal spielen«, haben ihr Spielverhalten gut im Griff, einige Spieler verlieren jedoch die Kontrolle darüber. Die Betroffenen und/oder ihre Angehörigen fühlen sich schließlich so stark belastet, dass sie therapeutische Hilfe brauchen oder Rat suchen. Der Erfolg der ersten Auflage und die zahlreichen neuen Forschungsergebnisse machen eine Neuauflage der »Spielsucht« notwendig. Zudem ist die Spielsucht inzwischen von den Kostenträgern als Krankheit anerkannt worden. Die Autoren informieren umfassend über die Ursachen des Suchtproblems und legen ein außerordentlich praxisnah geschriebenes Behandlungsmanual vor, in dem auch die typischen »Knackpunkte« nicht fehlen: die oft gegebene Verleugnungstendenz oder fehlende Motivation, der schwierige Übergang von einer stationären Therapie in die Normalität oder Therapieabbruch. ... damit die Spielsucht nicht im Ruin endet. Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Meyer Universität Bremen Dr.phil. Meinolf Bachmann Bernhard-Salzmann-Klinik, Gütersloh Neu in der 2. Auflage: — Glücksspiel im Internet — Ausführliches, praxisorientiertes Therapiemanual — Auch für andere Suchtformen anwendbar — Neurobiologische Theorien — Präventive Maßnahmen Anhand zahlreicher Fallbeispiele werden die therapeutischen Schritte konkret und anschaulich geschildert. Rezension
Die Autoren haben bereits 1993 ein Buch zum Thema vorgelegt unter dem Titel: "Glücksspiel - Wenn der Traum vom Glück zum Alptraum wird", 1999 erschien dann dieses Buch in 1. Aufl., das nun in 2. Aufl. vollständig überarbeitet und erweitert wurde. Der Titel ist vielleicht ein wenig unpräzis; denn es behandelt hauptsächlich die pathologische Glücksspielsucht, nimmt aber jetzt in 2. Aufl. z.B. auch die neu entstandene und in Schüler-Kreisen verbreitete Computer-Spielsucht auf. Excessives Spielverhalten als Sucht ist bislang am besten hinsichtlich der sog. Glücksspielsucht untersucht. Bei nicht stoffgebundenen süchtigen Verhaltensweisen spielen Hirnbotenstoffe wie z.B. Dopamin, quasi als körpereigene psychotrope Substanzen, eine entscheidende Rolle. Das z.Zt. viel diskutierte excessive Computerspielen im Kindes- und Jugendalter ist der pathologischen Glücksspielsucht verwandt. Literarisch ist das Thema Glücksspielsucht spätestens seit dem 19. Jhdt. insbesondere durch Fjodor Dostojewskijs großen, autobiographisch veranlassten Roman "Der Spieler" (1866) vertraut, aber in unseren Zeiten gewinnt die Problematik u.a. durch Spielautomatencenter eine ungeheure Breitenwirkung. Menschliche Sucht und Süchtigkeit meint dabei weitaus mehr als Toxikomanie; die nicht stoffgebundenen Süchte, die Verhaltenssüchte scheinen in letzter Zeit deutlich zuzunehmen und erfahren verstärkte Aufmerksamkeit. Auch im schulischen Kontext treten exzessive Verhaltensweisen wie Kauf-, Glückspiel- oder Computersucht immer drastischer in der Fokus der Wahrnehmung, Süchte, die zu einer deutlichen Einschränkung menschlicher Freiheitsspielräume führen. Dieser Band wendet sich unter den Verhaltenssüchten der Spielart der Glücksspielsucht zu. Die Autoren informieren umfassend über die Ursachen des Suchtproblems und legen ein außerordentlich praxisnah geschriebenes Behandlungsmanual vor, in dem auch die typischen "Knackpunkte" nicht fehlen: die oft gegebene Verleugnungstendenz oder fehlende Motivation und Krankheitseinsicht, der schwierige Übergang von einer stationären Therapie in die Normalität oder Therapieabbruch. Anhand zahlreicher Fallbeispiele werden Therapieschritte und Fragestellungen verständlich beschrieben und konkret besprochen.
Jens Walter, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Spielen ohne Grenzen... Erst das Geld verleiht dem Glücksspiel seine eigentliche Bedeutung. Geld verkörpert das "Maß aller Dinge" in unserer Gesellschaft, es ermöglicht die Befriedigung vielfältiger Bedürfnisse, lässt Träume wahr werden. Einige Spieler verlieren jedoch die Kontrolle über ihr Spielverhalten. Die Betroffenen und/oder ihre Angehörigen fühlen sich schließlich so stark belastet, dass sie therapeutische Hilfe brauchen oder Rat suchen. Die Autoren informieren umfassend über die Ursachen des Suchtproblems und legen ein außerordentlich praxisnah geschriebenes Behandlungsmanual vor, in dem auch die typischen "Knackpunkte" nicht fehlen: die oft gegebene Verleugnungstendenz oder fehlende Motivation und Krankheitseinsicht, der schwierige Übergang von einer stationären Therapie in die Normalität oder Therapieabbruch. Anhand zahlreicher Fallbeispiele werden Therapieschritte und Fragestellungen verständlich beschrieben und konkret besprochen. Neu in der zweiten Auflage - Internet- / Onlinespiele; TV- und Telefonspiele - Ausführliches Therapiemanual - Kontrolle zurückgewinnen durch die richtige Therapie Content Level » Professional/practitioner Stichwörter » Glücksspiel - Psychiatrie - Psychologie - Psychotherapie - Spielsucht - Sucht Verwandte Fachbereiche » Medizin - Psychiatrie Inhaltsverzeichnis
1 Einführung 1
2 Glücksspiel: Allgemeine Hintergrundinformationen 7 2.1 Historische Aspekte des Glücksspiels und der Spielleidenschaft 8 2.2 Aktuelle und rechtliche Situation 10 2.3 Varianten des Glücksspiels 12 2.3.1 Glücksspiele in Spielbanken 12 2.3.2 Geldspielautomaten 13 2.3.3 Wettformen 16 2.3.4 Lotterien 18 2.3.5 Glücksspiele im Internet 19 2.3.6 Illegales Glücksspiel 21 2.3.7 Börsenspekulationen 21 2.4 Nachfrage in der Bevölkerung 23 2.5 Umsätze auf dem Glücksspielmarkt 24 2.6 Zusammenfassung 26 3 Pathologisches Glücksspiel – Spielsucht 29 3.1 Erscheinungsbild 31 3.2 Phasen einer Spielerkarriere 37 3.2.1 Positives Anfangsstadium (Gewinnphase) 39 3.2.2 Kritisches Gewöhnungsstadium (Verlustphase) 39 3.2.3 Suchtstadium (Verzweiflungsphase) 40 3.3 Diagnostische Kriterien 40 3.4 Screeningverfahren 42 3.5 Nosologische Zuordnung 43 3.5.1 Pathologisches Spielen als abnorme Gewohnheit und Störung der Impulskontrolle 43 3.5.2 Pathologisches Spielen als Suchtkrankheit 44 3.6 Spielertypologie 50 3.7 Epidemiologie 52 3.8 Zusammenfassung 55 4 Entstehungsbedingungen pathologischen Glücksspiels: Das Drei-Faktoren-Modell der Suchtentwicklung als übergeordnetes Rahmenkonzept 57 4.1 Eigenschaften des Glücksspiels 58 4.1.1 Psychotrope Wirkung des Glücksspiels 58 4.1.2 Strukturelle Merkmale von Glücksspielen 67 4.2 Charakteristika des Spielers 69 4.2.1 Genetische Bedingungen 69 4.2.2 Neurobiologische Grundlagen 70 4.2.3 Persönlichkeitsstruktur 71 4.2.4 Affektive Störungen und Angststörungen 74 4.2.5 Geschlecht 75 4.2.6 Soziodemographische Merkmale 77 4.3 Soziales Umfeld des Spielers 78 4.3.1 Einstellung der Gesellschaft zum Glücksspiel 78 4.3.2 Verfügbarkeit 79 4.3.3 Arbeits- und Lebensverhältnisse 80 4.3.4 Familiäre Strukturen 81 4.4 Zusammenfassung 82 5 Theoretische Erklärungsansätze zur Entstehung und Aufrechterhaltung pathologischen Spielens 85 5.1 Neurobiologische Theorien 86 5.1.1 Dopaminerges System 87 5.1.2 Serotonerges System 89 5.1.3 Noradrenerges System 89 5.1.4 Opioidsystem 89 5.1.5 Neurobiologie von Entscheidungsprozessen 90 5.2 Psychoanalytische Konzepte 91 5.3 Lerntheorien 94 5.4 Kognitionstheoretische Ansätze 96 5.4.1 Theorie der kognitiven Dissonanz 96 5.4.2 Mechanismen der verzerrten Realitätswahrnehmung 97 5.5 Soziologische und sozialpsychologische Ansätze 100 5.6 Integrative Modelle 102 5.7 Zusammenfassung 107 6 Individuelle und soziale Folgen 109 6.1 Finanzielle Situation und Verschuldung 110 6.2 Emotionale Belastung und Suizidrisiko 110 6.3 Auswirkungen auf die Familie 112 6.4 Beschaffungskriminalität 113 6.4.1 Strafrechtliche Beurteilung 118 6.4.2 Falldarstellungen 123 6.5 Geschäftsfähigkeit 128 6.5.1 Zivilrechtliche Beurteilung 128 6.6 Volkswirtschaftliche Kosten 130 6.7 Zusammenfassung 131 7 Selbsthilfegruppen 133 7.1 Programm der Gamblers Anonymous (GA) 134 7.1.1 Anonyme Spieler 136 7.2 Allgemeine Gesichtspunkte zur Arbeit in Spieler-Selbsthilfegruppen 137 7.3 Beobachtungen bei der Teilnahme an einer Selbsthilfegruppe 138 7.4 Alternative Formen der Selbsthilfe 141 7.5 Zusammenfassung 141 8 Grundsätzliches zur Spielertherapie 143 8.1 Behandlungsangebote und ihre Vernetzung 144 8.2 Suchtmodell als Therapieplan 145 8.3 Therapieziele 147 8.4 Integrativer Behandlungsansatz 148 8.5 Zusammenfassung 151 9 Ambulante Behandlung 153 9.1 Gespräche mit Mitarbeitern von Spielerberatungsstellen 155 9.2 Formen und Aufgaben der Spielerberatung 159 9.3 Phasen und Schwerpunkte der ambulanten Spielerbehandlung 160 9.3.1 Kontaktaufnahme 160 9.3.2 Motivation im Therapieprozess 162 9.3.3 Schritte zur Krankheitseinsicht und Spielabstinenz 164 9.3.4 Die Fragen nach dem Warum – die Ursachen 166 9.4 Gruppenarbeit 169 9.4.1 Konzepte gegen Gruppenfluktuation und Schwellenängste 169 9.5 Themen in der Nachsorge stationär behandelter Spieler 172 9.6 Möglichkeiten und Grenzen ambulanter Therapie 174 9.7 Zusammenfassung 174 10 Spieler in stationärer Therapie 177 10.1 Historisches: die Anfänge stationärer Therapiekonzepte 179 10.2 Indikation 181 10.3 Phasen und Schwerpunkte der stationären Spielerbehandlung 182 10.3.1 Vorgespräche – Kontraindikationen 182 10.3.2 Individuelle Therapieplanung 184 10.3.3 Finanzielle Situation und Geldmanagement 188 10.3.4 Behandlungskonzept 188 10.3.5 Motivation 189 10.3.6 Krankheitseinsicht 192 10.3.7 Abstinenz 194 10.3.8 Psychotherapie der Ursachen und Entwicklung alternativer Verhaltensweisen 197 10.4 Gruppentherapie als zentraler Bestandteil eines multimodalen Therapiekonzepts 201 10.4.1 Rahmenbedingungen gruppentherapeutischer Behandlung 202 10.4.2 Zusätzliche wöchentliche Spieler-Gruppenstunde 204 10.4.3 Wirkfaktoren der Gruppenarbeit 206 10.4.4 Umgang mit problematischen Situationen und Verhaltensweisen in der Gruppentherapie 211 10.4.5 Psychologische Schulen in der Gruppentherapie 216 10.5 Individualtherapie 216 10.6 Sport, kreatives Gestalten, Arbeitstherapie 217 10.6.1 Sport 218 10.6.2 Kreatives Gestalten 219 10.6.3 Arbeitstherapie 220 10.7 Besonderheiten in der Klientel 220 10.7.1 Therapie von spielsüchtigen Frauen 220 10.7.2 Pathologisches Spielverhalten bei (Roulette-)Glücksspielen im Internet 222 10.7.3 Migration 227 10.8 Probleme bei der Behandlung von Spielern in der Psychiatrie 229 10.9 Therapieabbruch 230 10.10 Reintegration und Nachsorge 234 10.10.1 Therapeutische Wohngruppen 234 10.10.2 Reintegration in die Arbeitswelt 235 10.11 Erfolgskriterien 235 10.12 Therapieverlauf – ein Fallbeispiel 236 10.13 Zusammenfassung 239 11 Der pathologische Glücksspieler und seine Familie 243 11.1 Familiäre Faktoren als Ursache der Krankheitsentwicklung 244 11.2 Auswirkungen des pathologischen Glücksspiels auf die Familie 245 11.2.1 Kinder von Spielsüchtigen 246 11.3 Einbeziehung der Familie in die Therapie 251 11.3.1 Familientherapie – eine Fallstudie 251 11.3.2 Gruppentherapie mit Paaren 252 11.3.3 Familiäre Koabhängigkeit und Therapierfolg 253 11.3.4 Unterschiede in der Behandlung von Alkoholiker- und Spielerfrauen 254 11.3.5 Therapeutische Maßnahmen für Eltern 255 11.3.6 Neuere ambulante und stationäre familientherapeutische Ansätze in Deutschland 256 11.4 Familientherapeutische Perspektiven 259 11.5 Zusammenfassung 262 12 Rückfälligkeit 265 12.1 Rückfälligkeit, Krankheitskonzept und die Frage des kontrollierten Suchtmittelgebrauchs 266 12.2 Rückfallmodelle 268 12.3 Rückfälligkeit in der therapeutischen Auseinandersetzung 270 12.4 Rückfallprophylaxe in verschiedenen Behandlungsphasen 274 12.4.1 Kontaktphase 274 12.4.2 Entwöhnungsphase 274 12.4.3 Nachsorgephase 276 12.5 Zusammenfassung 277 13 Evaluation verschiedener Behandlungsansätze 279 14 Ansatzpunkte präventiver Maßnahmen 285 14.1 Glücksspiel und Spielerschutz 287 14.2 Ein regulatives Rahmenmodell sowie primär- und sekundärpräventive Handlungsmöglichkeiten 291 14.3 Erkennungsmerkmale problematischer Spieler in Spielsituationen 291 14.4 Spielsperre 294 14.5 Gestaltung der Spielstruktur 295 14.6 Prävention im Kindes- und Jugendalter 295 14.7 Risikofaktoren im sozialen Umfeld 298 14.8 Schutzfaktoren im sozialen Umfeld 299 14.9 Zusammenfassung 300 15 Ausblick 301 Anhang 305 A Allgemeine Informationen 307 A1 Kontaktadressen 307 A2 Stationäre Einrichtungen 307 A3 Nützliche Internetadressen 308 A4 Ergebnisse der Untersuchung von Bachmann & Banze (1992) sowie Schwarz & Lindner (1990) 309 A5 Persönlichkeitsprofil pathologischer Glücksspieler 310 A6 Psychologische Schulen in der Gruppentherapie pathologischer Glücksspieler 311 B Arbeitsmaterialien zum Therapieverlauf 316 B1 Zwanzig Fragen der Anonymen Spieler 316 B2 Die erste Zeit des Entzugs und der Entwöhnung vom Glücksspielen 316 B3 Therapieplanung 318 B4 Schuldenbilanz und -regulierung 320 B5 Monatshaushaltsplan 321 B6 Tagesausgabenprotokoll 323 B7 Selbsteinschätzungsskalen: Therapieschritte und Fragestellungen 324 B7.1 Therapiemotivation (TMO) 324 B7.2 Krankheitseinsicht (KE) 326 B.7.3 Therapie der Ursachen (TdU) 328 B8 Abstinenz 330 B8.1 Abstinenzgründe auf der Waage 330 B8.2 Ergebnis einer Therapiegruppenarbeit zum Thema Vorteile der Abstinenz und »Vorteile« des Suchtverhaltens 331 B9 Vorteile der Abstinenz 332 B10 Veränderte Einstellungen zum Verlangen 333 B11 Veränderte Einstellungen zu Suchtmitteln 334 B12 Liste von Ideen und Gründen zum Spielen 335 B13 Konsequenzen des Glücksspiels – Checkliste 336 B14 Therapieabbruchgefahr (TAG) 337 B15 Was muss ich beachten, wenn die Therapie zu Ende ist? 339 B16 Rückfallvorhersageskala 340 B17 Rückfallriskante Situationen und Bewältigungsstrategien 342 B18 Ein Mitpatient ist rückfällig 342 B19 Rückfallprävention 343 B19.1 Erkenntnisse und Gedanken 343 B19.2 Planung eines Notfallkärtchens bei Rückfall- oder Therapieabbruchgefahr 344 B19.3 Beispiele für Notfallkärtchen 345 B20 Struktur und Aktivitätsplan: Alternativen zum Suchtverhalten 347 Literatur 355 Personenverzeichnis 381 Sachverzeichnis 387 |
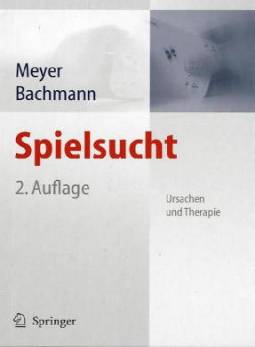
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen