|
|
|
Umschlagtext
Spielen ohne Grenzen ...
Erst das Geld verleiht dem Glücksspiel seine eigentliche Bedeutung. Geld verkörpert das "Maß aller Dinge" in unserer Gesellschaft; es ermöglicht die Befriedigung vielfältiger Bedürfnisse, lässt Träume wahr werden. Auf der Jagd nach dem Glück können die Spieler die Kontrolle über ihr Spielverhalten verlieren und süchtig werden. Die Autoren informieren umfassend über die Ursachen des Suchtproblems, beschreiben ausführlich und praxisnah die Behandlungsmöglichkeiten und zeigen vorbeugende Maßnahmen auf. Anhand zahlreicher Fallbeispiele werden Therapieschritte und Fragestellungen verständlich beschrieben und konkret besprochen. Im Mittelpunkt der Therapie steht nicht der "Verzicht", sondern das konkrete Umsetzen von Alternativen. Nur so ist das Ziel - dauerhafte Abstinenz - erreichbar. Die schädlichen Auswirkungen des Glücksspiels verlangen nach geeigneten präventiven Maßnahmen; das haben inzwischen auch politische Entscheidungsträger erkannt. Das Buch listet eine Reihe proaktiver Handlungsoptionen auf und beurteilt sie hinsichtlich ihrer Effektivität. Rezension
Viele Menschen in unserer Gesellschaft können dem Glücks-Spielen nicht widerstehen, sei es nun das schnelle Spielchen um die Ecke am "einarmigen Banditen", die Sportwette, das Rubbellos oder der Besuch im Kasino. Einige Spieler verlieren die Kontrolle und werden spielsüchtig. (Glücks-)Spielsucht ist inzwischen als Krankheit anerkannt worden. Sie endet nicht selten im Ruin. Dieser Band zeigt ebenso die Ursachen des Suchtproblems auf wie er ein praxisnahes Behandlungsmanual vorlegt, das um die typischen Schwierigkeiten bei der Behandlung von Spielsucht weiss: von der Verleugnungstendenz über fehlende Motivation, der Einweihung der Angehörigen und dem schwierigen Übergang von stationärer Therapie in die Normalität. Auch das z.Zt. viel diskutierte exzessive Computerspielen im Kindes- und Jugendalter ist der pathologischen Glücksspielsucht verwandt. Anhand zahlreicher Fallbeispiele werden Therapieschritte und Fragestellungen verständlich beschrieben und konkret besprochen. In der Neuauflage wurde insbesondere vielfältige neuere Literatur und die neue Rechtslage (Änderung des Glücksspielstaatsvertrags 2011) aufgenommen und verarbeitet. Kap. 4 beschreibt die Charakteristika des Spielers neu, Kap. 8 nimmt die Aktivierung von Selbsthilferessourcen auf, ambulante und stationäre Verfahren (Kap. 9-11) wurden erweitert und das familiäre Umfeld (Kap. 12) und die Rückfallprävention (Kap. 13) neu ausgeleuchtet.
Jens Walter, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Einziges deutschsprachiges Therapiefachbuch Geschrieben von zwei renommierten und auf diesem Gebiet sehr erfahrenen Autoren Mit ausführlichem Therapiemanual Schwerpunkt: Glücksspiele Content Level » Professional/practitioner Stichwörter » Glücksspiel - Psychiatrie - Psychologie - Psychotherapie - Spielsucht - Sucht Verwandte Fachbereiche » Medizin & Gesundheitsberufe - Psychiatrie Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Meyer, Institut für Psychologie und Kognitionsforschung der Universität Bremen. Dr. phil. Meinolf Bachmann, Psychologischer Psychotherapeut, Praxis für Psychotherapie, Gütersloh. Inhaltsverzeichnis
1 Einführung 1
1.1 Zum Aufbau und Inhalt des Buchs 4 2 Glücksspiel: Allgemeine Hintergrundinformationen 7 2.1 Historische Aspekte des Glücksspiels und der Spielleidenschaft 8 2.2 Aktuelle und rechtliche Situation 10 2.3 Varianten des Glücksspiels 13 2.3.1 Glücksspiele in Spielbanken 13 2.3.2 Geldspielautomaten 16 2.3.3 Sport- und Pferdewetten 20 2.3.4 Lotterien 22 2.3.5 Telegewinnspiele 23 2.3.6 Börsenspekulationen 24 2.3.7 Illegales Glücksspiel 25 2.4 Nachfrage in der Bevölkerung 27 2.5 Umsätze und Erträge auf dem deutschen Glücksspielmarkt 28 2.6 Zusammenfassung 31 3 Pathologisches Glücksspiel-Spielsucht 33 3.1 Erscheinungsbild 35 3.2 Phasen einer Spielerkarriere 40 3.2.1 Positives Anfangsstadium (Gewinnphase) 41 3.2.2 Kritisches Gewöhnungsstadium (Verlustphase) 42 3.2.3 Suchtstadium (Verzweiflungsphase) 42 3.2.4 Episodische, kurvenförmige und anfallsartige Entwicklungsverläufe 43 3.3 Diagnostische Kriterien 44 3.4 Screeningverfahren 46 3.5 Nosologische Zuordnung 49 3.5.1 Pathologisches Spielen als abnorme Gewohnheit und Störung der Impulskontrolle 49 3.5.2 Pathologisches Spielen als Suchtkrankheit 51 3.6 Spielertypologie 58 3.6.1 Subtypen pathologischer Spieler 59 3.7 Epidemiologie 61 3.7.1 Behandlungsnachfrage 65 3.8 Zusammenfassung 65 4 Entstehungsbedingungen pathologischen Glücksspiels: Das Drei-Faktoren-Modell der Suchtentwicklung als übergeordnetes Rahmenkonzept 69 4.1 Eigenschaften des Glücksspiels 70 4.1.1 Psychotrope Wirkung 70 4.1.2 Veranstaltungsmerkmale 80 4.1.3 Bewertungsinstrument zur Einschätzung des Gefährdungspotenzials von Glücksspielen 86 4.2 Charakteristika des Spielers 91 4.2.1 Alter 92 4.2.2 Geschlecht 93 4.2.3 Soziodemographische Merkmale 95 4.2.4 Genetische Disposition 97 4.2.5 Persönlichkeitsstruktur 99 4.2.6 Komorbide psychische Störungen 102 4.3 Soziales Umfeld des Spielers 107 4.3.1 Einstellung der Gesellschaft zum Glücksspiel 107 4.3.2 Verfügbarkeit 108 4.3.3 Arbeits-und Lebensverhältnisse 112 4.3.4 Familiäre Strukturen 112 4.4 Zusammenfassung 113 5 Theoretische Erklärungsansätze zur Entstehung und Aufrechterhaltung pathologischen Spielens 115 5.1 Neurobiologische Theorien 116 5.1.1 Dopamin 117 5.1.2 Serotonin 119 5.1.3 Noradrenalin 119 5.1.4 Opioide 120 5.1.5 Glutamat und GABA 120 5.1.6 Kognitive und neurobiologische Funktionen 121 5.2 Psychoanalytische Konzepte 125 5.2.1 Ödipuskomplex 126 5.2.2 Infantile Allmachtsfiktion 126 5.2.3 Frühe Störungen 127 5.2.4 Narzissmus 127 5.3 Lerntheorien 128 5.4 Kognitionstheoretische Ansätze 133 5.4.1 Theorie der kognitiven Dissonanz 133 5.4.2 Mechanismen der verzerrten Realitätswahrnehmung 134 5.5 Soziologische und sozialpsychologische Ansätze 139 5.6 Integrative Modelle 141 5.7 Zusammenfassung 148 6 Individuelle und soziale Folgen 151 6.1 Finanzielle Situation und Verschuldung 152 6.2 Emotionale Belastung und Suizidrisiko 153 6.3 Auswirkungen auf die Familie 155 6.4 Beschaffungskriminalität 157 6.4.1 Strafrechtliche Beurteilung 162 6.4.2 Falldarstellungen 168 6.5 Geschäftsfähigkeit 173 6.5.1 Zivilrechtliche Beurteilung 173 6.6 Volkswirtschaftliche Kosten 175 6.7 Zusammenfassung 177 7 Selbsthilfe 179 7.1 Ratgeber und Selbsthilfemanuale 180 7.2 Selbsthilfegruppen 182 7.2.1 Programm der Gamblers Anonymous (GA) 183 7.2.2 Anonyme Spieler 185 7.2.3 Analyse des Konzepts von Spieler-Selbsthilfegruppen 186 7.3 Zusammenfassung 190 8 Telefon-Hotline und Online-Beratung 193 9 Grundsätzliches zur Spielertherapie 197 9.1 Behandlungsangebote und ihre Vernetzung 199 9.2 Suchtmodell alsTherapieplan 199 9.3 Therapieschritte und Fragestellungen 201 9.3.1 Motivation 202 9.3.2 Krankheitseinsicht und Abstinenzüberlegungen 206 9.3.3 Therapie der Ursachen 210 9.3.4 Geld zum Thema machen 215 9.3.5 Verzerrte Kognitionen (abergläubisches Denken) 218 9.3.6 Individuelle Therapieplanung 221 9.4 Theoretische Ansätze 222 9.4.1 Historie und Überblick verschiedener Behandlungsansätze 222 9.4.2 Psychobiologischer Ansatz: Neurobiologisches Verhaltens-/ Konditionierungsmodell und die Schlussfolgerungen für das therapeutische Vorgehen 224 9.4.3 Die Suchtformel 226 9.4.4 Integrativer Behandlungsansatz 226 9.5 Gruppentherapeutische Behandlung 229 9.5.1 Kritische Fragestellungen zur Gruppentherapie 231 9.5.2 Allgemeine Wirkfaktoren der Gruppenarbeit 235 9.6 Individualtherapie 236 9.7 Besonderheiten in der Klientel 237 9.7.1 Pathologisches Spielverhalten bei (Roulette-)Glücksspielen im Internet 237 9.7.2 Therapie von spielsüchtigen Frauen 242 9.8 Erfolgskriterien 246 9.9 Zusammenfassung 247 10 Ambulante Behandlung 251 10.1 Gespräche mit Mitarbeitern von Spielerberatungsstellen 253 10.2 Formen und Aufgaben der Spielerberatung 256 10.3 Phasen und Schwerpunkte der ambulanten Spielerbehandlung 257 10.3.1 Kontaktaufnahme 257 10.3.2 Besonderheiten der Motivation/Krankheitseinsicht-Abstinenz/ Therapie der Ursachen im ambulanten Therapieprozess 260 10.3.3 Konzepte gegen Gruppenfluktuation und Schwellenängste 262 10.4 Themen in der Nachsorge stationär behandelter Spieler 264 10.5 Möglichkeiten und Grenzen ambulanter Therapie 266 10.6 Zusammenfassung 266 11 Spieler in stationärer Therapie 269 11.1 Historisches: die Anfänge stationärer Therapiekonzepte 270 11.2 Indikation 272 11.3 Phasen und Schwerpunkte der stationären Spielerbehandlung 273 11.3.1 Vorgespräche-Kontraindikationen 274 11.3.2 IndividuelleTherapieplanung 275 11.3.3 Behandlungskonzept-Besonderheiten der Motivation/Krankheitseinsicht 279 11.3.4 Motivation 279 11.3.5 Krankheitseinsicht 281 11.3.6 Abstinenz 282 11.3.7 Therapie der Ursachen und Entwicklung alternativer Verhaltensweisen in der stationären Therapie 284 11.4 Gruppentherapie als zentraler Bestandteil eines stationären Therapiekonzepts 285 11.5 Sport, kreatives Gestalten, Ergotherapie 286 11.5.1 Sport 287 11.5.2 Kreatives Gestalten 288 11.5.3 Ergotherapie 289 11.6 Probleme des Therapieabbruchs in der stationären Therapie 289 11.7 Reintegration und Nachsorge 293 11.7.1 Therapeutische Wohngruppen 294 11.7.2 Reintegration in die Arbeitswelt 294 11.8 Probleme bei der Behandlung von Spielern in der Psychiatrie 295 11.9 Der Therapieverlauf-ein Fallbeispiel 296 11.10 Zusammenfassung 298 12 Der pathologische Glücksspieler und die Familie 301 12.1 Familiäre Faktoren als Ursache der Krankheitsentwicklung 302 12.2 Auswirkungen des pathologischen Glücksspielsauf die Familie 303 12.2.1 Kinder von Spielsüchtigen 304 12.3 Einbeziehung der Familie in die Therapie 309 12.3.1 Familientherapie - eine Fallstudie 309 12.3.2 Gruppentherapie mit Paaren 310 12.3.3 Familiäre Koabhängigkeit und Therapieerfolg 311 12.3.4 Unterschiede in der Behandlung von Alkoholiker-und Spielerfrauen 312 12.3.5 Therapeutische Maßnahmen für Eltern 313 12.3.6 Neuere ambulante und stationäre familientherapeutische Ansätze in Deutschland 314 12.4 Familientherapeutische Perspektiven 317 12.5 Zusammenfassung 322 13 Rückfälligkeit 325 13.1 Rückfälligkeit, Krankheitskonzept und die Frage des kontrollierten Suchtmittelgebrauchs 326 13.2 Rückfallmodelle 328 13.3 Rückfälligkeit in der therapeutischen Auseinandersetzung 330 13.4 Rückfallprophylaxe in verschiedenen Behandlungsphasen 334 13.4.1 Kontaktphase 334 13.4.2 Entwöhnungsphase 335 13.4.3 Nachsorgephase 337 13.5 Zusammenfassung 338 14 Ansatzpunkte präventiver Maßnahmen 341 14.1 Glücksspiel und Spielerschutz 344 14.2 Primär-und sekundärpräventive Handlungsmöglichkeiten 347 14.2.1 Wirksamkeit der präventiven Maßnahmen 347 14.2.2 Stärkung von Lebenskompetenzen 351 14.2.3 Aufklärung 352 14.2.4 Regulierungskonzepte 354 14.2.5 Jugendschutz 357 14.2.6 Eingriffe in die Spielstruktur und Angebotsform 358 14.2.7 Früherkennung 360 14.2.8 Spielsperre 366 14.2.9 Erhöhung der Kosten, Beschränkungen der Werbung und des Alkohol- und Tabakkonsums 370 14.3 Zusammenfassung 371 Anhang 375 Literatur 389 Stichwortverzeichnis 433 |
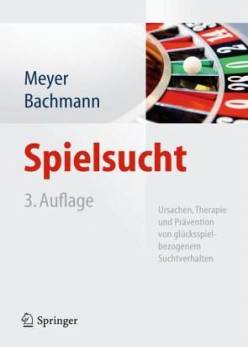
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen