|
|
|
Umschlagtext
Konsequent an persönlichen Ressourcen orientiert, kann Selbstmanagement ausgesprochen lustvoll sein. Das Zürcher Ressourcen Modell (ZRM) ist eine vielfach erprobte Methode zur gezielten Entwicklung von Handlungspotenzialen. An Grundlagen interessierte Fachleute und Laien finden im einleitenden Theorieteil eine Fülle aktueller neurowissenschaftlicher und psychologischer Befunde zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und Selbststeuerung. Sie bilden das Fundament für das ZRM-Training und gewährleisten ein systematisches und jederzeit begründetes Vorgehen. «Selbstkonsequenz», «Somatische Marker» oder «Rubikon-Prozess» benennen Themen, die auch für sich gelesen zu faszinieren vermögen.
Praktikerinnen und Praktikern bietet das Buch im Trainingsteil ein sorgfältig ausgearbeitetes und wissenschaftlich fundiertes Werkzeug für die erfolgreiche Durchführung von Trainingsseminaren. Der Trainingsablauf wird Schritt für Schritt beschrieben. Impulsreferate, Arbeitsmaterialien für die Trainingsteilnehmer sowie die Anweisungen für die Arbeit in Kleingruppen sind nachvollziehbar dokumentiert. Diese können als Kopiervorlagen benutzt werden und stehen in aktueller Version als Download unter http://www.verlag-hanshuber.com/zrm/ zur Verfügung. «Souveräne AutorInnen, ein nützliches und einladendes Buch und eine respektvolle Perspektive auf Ressourcen. Sehr zu empfehlen!» (systhema) Rezension
Das «Zürcher Ressourcen Modell» basiert auf neurowissenschaftlichen Forschungsergebnissen und einem psychologischen Selbstmanagementmodell. Auch únsere Schülerinnen und Schüler leiden oft darunter, dass sie ihre eigenen Fähigkeiten und Ressourcen nicht angemessen zur Bewältigung von Problemen, aber auch von grundlegenden Lebenszielen einzuschätzen wissen. – Dieses Buch, das das „Zürcher Ressourcen Modell“ repräsentiert, bietet ein komplettes Trainingsprogramm zur ressourcenorientierten Arbeit. Es zielt ab auf Motivation zum Erreichen eigener Ziele und verhilft zu einer sinnvollen Vorgehensweise zum Erreichen dieser Ziele. Es achtet dabei insbesondere auf individuelle Körpersignale. Mit dem «Zürcher Ressourcen Modell» erkennen auch Jugendliche, in welcher Lebenslage sie gerade stehen und was ihnen besonders wichtig ist. Sie durchschauen, wohin sie am sinnvollsten ihre Aufmerksamkeit und Energien lenken sollten. - Ein Trainingsmanual, das von Schulsozialarbeitern, schulpsychologischem Dienst und Lehrern beachtet werden sollte!
Jens Walter, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
«Souveräne AutorInnen, ein nützliches und einladendes Buch und eine respektvolle Perspektive auf Ressourcen. Sehr zu empfehlen!» (systhema) Die dritte Auflage wurde von den Autoren korrigiert und ergänzt Inhaltsverzeichnis
Einleitung 11
Für wen dieses Buch geschrieben wurde 11 Warum wir das Zürcher Ressourcen Modell entwickelt haben 13 Integrationsabsichten 13 Ressourcenorientierung 16 Transfereffizienz 19 Wie dieses Buch benutzt werden kann 22 Teil 1: Theorie 1.1 Die Sichtweise der Neurowissenschaft 25 1.1.1 Das Gehirn ist ein selbstorganisierender Erfahrungsspeicher 25 1.1.2 Wie Erfahrungen im Gehirn gespeichert werden 29 1.1.3 Gedächtnis beruht auf neuronalen Netzen 32 1.1.4 Neuronale Netze gestalten psychisches Geschehen 35 1.1.5 Das Gedächtnis hat ein emotionales Bewertungssystem 38 1.1.6 Das emotionale Bewertungssystem und die somatischen Marker 42 1.1.7 Wer entscheidet - Gefühl oder Verstand? 48 1.1.8 Psychische Entwicklung aus neurowissenschaftlicher Sicht 52 1.2 Der Rubikon-Prozess 57 1.2.1 Das Bedürfnis 60 1.2.2 Das Motiv 62 1.2.3 Der Übergang über den Rubikon 64 1.2.4 Die Intention 65 1.2.5 Die präaktionale Vorbereitung 67 1.2.6 Die Handlung 71 1.3 Die Phasen des Zürcher Ressourcen Modells 75 1.3.1 Phase 1: Das Thema 77 1.3.2 Phase 2: Vom Thema zum Ziel 84 1.3.2.1 Die Ausgangslage zu Beginn der Phase 2 84 1.3.2.2 Die drei Kernkriterien für ein handlungswirksames Ziel 86 1.3.3 Phase 3: Vom Ziel zum Ressourcenpool 100 1.3.3.1 Ressource 1: Das handlungswirksam formulierte Ziel 102 1.3.3.2 Ressource 2: Erinnerungshilfen 105 1.3.3.3 Ressource 3: Der Körper 109 1.3.4 Phase 4: Die Ressourcen gezielt einsetzen 122 1.3.5 Phase 5: Integration und Transfer 128 1.3.5.1 Der Identitätsaspekt 130 1.3.5.2 Der Umweltaspekt 132 Teil 2: Trainingsmanual Einleitung 137 Der Nutzen für Trainerinnen 137 Der Nutzen für Trainingsteilnehmerinnen 137 Tipps zum Gebrauch des Manuals 138 Aufbau des Trainings 139 Trainingsübersicht - Advance Organizer 139 Transfersicherung 139 Der Trainingsrahmen 139 Durchführungsmodi und Zeitbedarf 139 Teilnehmerzahl und Teilnehmervoraussetzungen 140 Bedarf an Räumen, Material, Medien 140 Didaktische Empfehlungen 141 Wieviel Theorie braucht es?. 141 Arbeiten und Kommunizieren nach dem «Hebammen-Prinzip» 142 Die Gruppe gezielt als Ressource nutzen 143 Einen privaten und einen öffentlichen Kursbereich vorsehen 143 Visualisierung und Teilnehmerunterlagen 145 Förderung von Eigenwahrnehmung - ein paralleler Lehrplan 146 2.1 Trainingsphase 1: Mein aktuelles Thema klären 149 2.1.1 Der Einstieg 149 2.1.1.1 Informationen zum Training 149 2.1.1.2 Entspannt starten 149 2.1.1.3 Über Bilder einander kennenlernen 151 2.1.2 Mein aktuelles Thema klären 152 2.1.2.1 Warum wir mit Bildern und «somatischen Markern» arbeiten - Impuls 153 2.1.2.2 Die Ressourcen der Gruppe nutzen im «Ideenkorb» 154 2.1.2.3 Öffentlichkeit herstellen 155 2.2 Trainingsphase 2: Vom Thema zu meinem Ziel 159 2.2.1 Ziele handlungswirksam formulieren! 159 2.2.1.1 Drei Kernkriterien der Handlungswirksamkeit - Impuls 159 2.2.1.2 Die Gruppenarbeit vorbereiten 162 2.2.1.3 Das handlungswirksame Ziel in Gruppen erarbeiten 164 2.2.1.4 Öffentlichkeit herstellen und Kriterienerfüllung sichern 164 2.2.1.5 Das Ziel systemisch optimieren 165 2.3 Trainingsphase 3: Vom Ziel zu meinem Ressourcenpool 167 2.3.0 «Ressourcen» und «Ressourcenpool» - Impuls 167 2.3.1 Ressourcenaufbau 1: Das «handlungswirksam formulierte Ziel» - ein zentrales Element im Ressourcenpool 168 2.3.2 Ressourcenaufbau 2: Erinnerungshilfen und Auslöser entwickeln 169 2.3.2.1 Neuronale Plastizität oder «Vom Trampelpfad zur Autobahn» - Impuls 169 2.3.2.2 Die Umsetzung im Training 170 2.3.2.3 Öffentlichkeit herstellen und Austauschen 171 2.3.3 Ressourcenaufbau 3: «Das Ziel in den Körper bringen» 171 2.3.3.1 Das Handlungsmodell im ZRM - Impuls 171 2.3.3.2 Den Ressourcenaufbau mental bahnen 173 2.3.3.3 Die zieladäquate Körperverfassung real entwickeln 175 2.3.3.4 Die Ergebnisse einprägsam festhalten 176 2.3.3.5 Öffentlichkeit herstellen und Austauschen 177 2.3.4 Den Ressourcenpool aktualisieren 177 2.4 Trainingsphase 4: Mit meinen ressourcen zielgerichtet handeln 179 2.4.1 Die ZRM-Strategie zur Realisierung von Zielen - Impuls 179 2.4.2 Planung des Ressourceneinsatzes für vorhersehbare Situationen (Situationstyp 1) 180 2.4.2.1 Auswahl einer geeigneten Situation und Festlegen konkreter Ausführungsmaßnahmen 180 2.4.2.2 Öffentlichkeit herstellen und Planungen austauschen 181 2.4.3 Planung des Ressourceneinsatzes für unvorhersehbare Situationen (Situationstyp 2) 182 2.4.3.1 Ausgangslage, «Grenzerfahrung», Konsequenzen - Impuls 182 2.4.3.2 Unerwünschte Belastungs-Routinen, Vorläufersignale, Stopp-Befehle - Impuls 185 2.4.3.3 Analyse, Vorsatzbildung und Austausch 189 2.4.3.4 Den Ressourcenpool aktualisieren 190 2.5 Trainlngsphase 5: Integration,Transfer und Abschluss 193 2.5.1 Den Trainingsprozess reflektieren, integrieren, symbolisieren 193 2.5.2 Den Transfer sichern, die Trainingsgruppe als Ressource nutzen 194 2.5.2.1 Transfereffizienz: Ein Qualitätsmerkmal des ZRM - Impuls 195 2.5.2.2 Soziale Ressourcen — Kooperation vereinbaren in Tandems und Netzwerken 197 2.5.2.3 Der Ressourcenpool - Endstand 197 2.5.3 Ausblick und Abschluss 197 ZRM-Forschung 201 Prozessorientierte Untersuchung von Persönlichkeitsentwicklung mittels Zeitreihen (von Ferdinand Keller und Maja Storch) 201 Literatur zum Kapitel «ZRM-Forschung» 212 Nachwort 215 Warum wir mit dem Zürcher Ressourcen Modell zufrieden sind 215 Was uns noch am Herzen liegt 217 Anhang 219 Einladung zum Kopieren und Kooperieren 220 Arbeitsblätter für die Teilnehmenden - Kopiervorlagen 221 ZRM®-Aus- und Weiterbildung 238 Literatur 239 Verzeichnisse der der Abbildungen und Flipchartblätter 248 Register 250 |
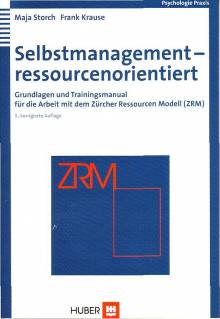
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen