|
|
|
Umschlagtext
Was sich ändern muss, damit die Schule jedem Kind gerecht wird
Auch nach etlichen Reformen gelingt es den Schulen nicht, Kinder nach ihrer jeweiligen Leistungsfähigkeit zu fördern. Statt Schülern Raum zu geben, um sich in ihrem eigenen Tempo Wissen zu erwerben, werden sie schon früh in starre Lehr- und Zeitpläne gezwungen. Vor allem leistungsschwächere Schüler und Kinder aus nicht privilegierten Elternhäusern werden so rasch abgehängt und ausgesiebt. Am Beispiel von vier ganz unterschiedlichen, aber typischen Jugendlichen zeigt Jutta Allmendinger in ihrem neuen Buch, was schiefläuft im deutschen Bildungswesen. Die authentischen Lebenswege der vier Freunde, die gemeinsam die Kita besuchten und sich dann schnell auseinanderentwickeln, verwebt die Autorin mit den Ergebnissen neuer Analysen zur Sozial- und Bildungsstruktur. Dabei weist Jutta Allmendinger nicht nur auf Fehlentwicklungen im deutschen Bildungswesen hin, sondern macht vor allem konkrete Vorschläge für ein besseres Schulsystem. Fest steht: Wenn wir die Bildungsbarrieren in unserem Land endlich einreißen wollen, brauchen wir mehr Zeit, mehr Geld und eine bessere Vernetzung für unsere Schulen. Jutta Allmendinger, geboren 1956, ist nach Stationen am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin, an der Harvard Business School und an der Ludwig-Maximilians-Universität München seit 2007 Professorin für Bildungssoziologie und Arbeitsmarktforschung an der Humboldt-Universität zu Berlin und Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB). Für ihre wissenschaftliche und gesellschaftspolitische Arbeit wurde sie mehrfach ausgezeichnet, zuletzt mit dem Communicator-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft. Allmendinger ist Autorin zahlreicher Bücher, darunter „Frauen auf dem Sprung“ (2009) und „Verschenkte Potenziale“ (2010). Rezension
Die deutsche Bildungspolitik ist spätestens seit den Ergebnissen der ersten internationalen PISA-Schulleistungsvergleichsstudien maßgeblich verunsichert, bewegt sich quasi auf vermintem Gelände, sucht in ständig neuen Reformen die Flucht nach vorn - und endet dabei nicht selten in bildungspolitischem Aktivismus. Jedenfalls sind die Bildungsbarrieren in unserem Land erschreckend hoch, kaum irgendwo anders in Europa spielt die soziale Herkunft eine dermaßen große Rolle für schulische Lernerfolge oder Nicht-Erfolge wie in Deutschland. Die Schere zwischen denen, die Bildungsangebote nutzen (können) und denen, die davon ausgeschlossen bleiben, ist weit geöffnet - wie die Kluft zwischen Arm und Reich, die sich in den vergangenen Jahren auch eher verschärft hat. Leistungsschwächere Schüler und Kinder aus nicht privilegierten Elternhäusern werden rasch abgehängt und ausgesiebt. Deshalb plädiert die Autorin dieses Buchs engagiert dafür: Wenn wir die Bildungsbarrieren in unserem Land endlich einreißen wollen, brauchen wir mehr Zeit, mehr Geld und eine bessere Vernetzung für unsere Schulen.
Oliver Neumann, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
„Kinder brauchen Vertrauen, Unterstützung, Zeit und Zuwendung. Das liest sich wie eine Aufforderung, nicht nur an die Schule und die Eltern, schließlich gibt es auch Paten und Mentoren, Freunde und Bekannte. Und diese so scheinbare Randbemerkung ist der überraschende Mehrwert des Buches - denn Jutta Allmendingen, die Präsidentin des Wissenschaftszentrums für Sozialforschung Berlin erzählt in ihrem Buch auch ganz privat von ihrer Patenrolle und bringt vielleicht auch manchen Leser damit auf eine Idee.“ MDR Figaro »Ein respektvolles, fundiertes und berührendes Sachbuch.« Deutschlandradio Kultur – Radiofeuilleton, 09.10.2012 »Es ist erschreckend zu sehen, wie vorhersehbar Bildungsbiografien heutzutage immer noch sind. Und dennoch ist es absolut spannend, dieses Buch zu lesen und mit zu verfolgen, wie die Bildungswege tatsächlich verlaufen.« mediation-berlin-blog.de (22.10.2012) Was sich ändern muss, damit die Schule jedem Kind gerecht wird Auch nach etlichen Reformen gelingt es den Schulen nicht, Kinder nach ihrer jeweiligen Leistungsfähigkeit zu fördern. Statt Schülern Raum zu geben, um sich in ihrem eigenen Tempo Wissen zu erwerben, werden sie schon früh in starre Lehr- und Zeitpläne gezwungen. Vor allem leistungsschwächere Schüler und Kinder aus nicht privilegierten Elternhäusern werden so rasch abgehängt und ausgesiebt. Am Beispiel von vier ganz unterschiedlichen, aber typischen Jugendlichen zeigt Jutta Allmendinger in ihrem neuen Buch, was schiefläuft im deutschen Bildungswesen. Die authentischen Lebenswege der vier Freunde, die gemeinsam die Kita besuchten und sich dann schnell auseinanderentwickeln, verwebt die Autorin mit den Ergebnissen neuer Analysen zur Sozial- und Bildungsstruktur. Dabei weist Jutta Allmendinger nicht nur auf Fehlentwicklungen im deutschen Bildungswesen hin, sondern macht vor allem konkrete Vorschläge für ein besseres Schulsystem. Fest steht: Wenn wir die Bildungsbarrieren in unserem Land endlich einreißen wollen, brauchen wir mehr Zeit, mehr Geld und eine bessere Vernetzung für unsere Schulen. Inhaltsverzeichnis
Einleitung 7
Bildungsketten 11 kapitel 1 Aller Anfang braucht mehr als Zeit Die Prägung der ersten Lebensjahre 13 kapitel 2 Die Macht der Integration Was Kindergärten leisten können 35 kapitel 3 Zurück auf die Plätze Grundschule und Entscheidungszwang 61 kapitel 4 Die Abschottung sozialer Kreise Schulen unserer Kinder 85 Gewinner und Verlierer 107 kapitel 5 Alex im Glück Was Schule auch sein kann 109 kapitel 6 Erkan geht in die Lehre Mit dem falschen Namen auf den Markt 125 kapitel 7 Laura sucht ihren Weg Inklusion als Menschenrecht 139 kapitel 8 Jenny trägt die rote Laterne Ohne verwertbaren Abschluss in die Welt 159 Wie wir das Bildungssystem verändern müssen 175 kapitel 9 Gemeinsam Fahrt aufnehmen Bildungs- und Sozialstaat im Einklang 177 kapitel 10 Länger gemeinsam lernen Soziale Mobilität für unsere Kinder 191 kapitel 11 Demokratie wagen Breite Bildung in unserem Unterricht 209 kapitel 12 Einer für alle – alle für einen Ein Pakt von Bund, Ländern und Gemeinden 221 Unsere Schulaufgaben 233 Anmerkungen 247 Literatur 275 Dank 303 Leseprobe: Einleitung Dieses Buch verfolgt den Werdegang von vier Kindern, die soeben volljährig geworden sind. Einst waren sie die besten Freunde, heute haben sie sich nichts mehr zu sagen. Aus dem mit Stöcken und Plastikschwertern beschworenen »Einer für alle, alle für einen« wurde ein gleichgültiges Schulterzucken. Die Spuren dieser zerbrochenen Freundschaft führen schnurstracks zu den Eltern, in die Schulen und Nachbarschaften zurück. Sie zeigen unser aller Mangel an Geld, Zeit, Geduld und Kraft. Und damit die verführerische Macht, alles beim Alten zu lassen. Die Freundschaft der vier begann im Alter von drei Jahren. In einem Kindergarten, der gezielt Kinder aus ganz unterschiedlichen sozialen Kreisen zusammenbringen wollte, fanden sie gut Platz: Alexander, genannt Alex, das Kind zweier Akademiker, Erkan, der Sohn türkischer Händler, Jenny, deren alleinerziehende Mutter arbeitslos war, und Laura, das leicht behinderte Kind eines Künstlers und einer Friseurin. Die vier Kinder erwartete eine schöne Zeit. Viele Geburtstage, viele Wochenenden, viele Ausflüge verbrachten sie gemeinsam und mit ihnen die Eltern. Jenny siegte stets beim Memory-Spiel, Erkan rechnete blitzsauber für alle die Bonbons zusammen, Laura malte die wunderbarsten Bilder, und von Alex lernten sie Großmut und Deutsch. Nach drei Jahren wurden die Freunde getrennt. War der Kindergarten für die meisten noch frei wählbar, so wurde die Schule durch den Wohnbezirk fest zugewiesen. Jenny und Erkan kamen auf Grundschulen, die in unmittelbarer Nähe zu ihrer Wohnung lagen. Alex besuchte die gutbürgerliche Schule in seinem Stadtteil. Laura dagegen blieb ein Jahr länger im Kindergarten, kam dann auf eine Grundschule und wurde bald auf eine Förderschule geschickt, die eben nicht mehr integrativ war. Einige Jahre hielt die Freundschaft, insbesondere die Eltern von Alex kümmerten sich darum. Zuerst riss das Band zu Laura. Die neuen Freunde von Alex, Erkan und Jenny konnten mit ihr nichts anfangen, hänselten und gängelten sie. Den dreien fehlte der Mut zu widersprechen. Und die Eltern konnten nicht mehr helfen. Nach der vierten Klasse standen weitere Schulwechsel an. Würden die drei jetzt eine gemeinsame Schule besuchen? Alle hofften es, doch daraus wurde nichts. Die Noten von Jenny reichten gerade so für die Realschule, bald jedoch rutschte sie auf die Hauptschule ab. Ihre Mutter regte sich nicht. Die Eltern von Erkan wünschten sich den höchstmöglichen Bildungsabschluss für ihren Sohn. Er kam auf eine Realschule. Bei Alex dagegen stand das Gymnasium von Geburt an fest. Sein Klassenlehrer wörtlich: »Deine Noten sind nicht besonders. Aber das wird schon. Bei deinen Eltern braucht man sich keine Sorgen zu machen.« Noch hatten die drei sich fest im Blick. Geburtstage feierten sie gemeinsam, überreichten sich Geschenke, krakelig beschriftet: »Von Deinem besten Kumpel.« Doch die Fäden lösten sich unaufhaltsam. Die Schule, die Freunde, das Leben unterschieden sich und damit die Interessen, der Sport, die Musik, die Urlaube, die Sprache. Bald weigerte sich Alex, seine Kumpels einzuladen, er schämte sich. Erkan traute sich nicht mehr, einfach bei seinen alten Freunden anzurufen, sie waren ihm fremd geworden. Jenny fand die anderen nur noch uncool. Und Laura suchte von sich aus sowieso nicht den Kontakt. Heute, mit achtzehn Jahren, fehlt ihnen jeder Kitt. Laura, Erkan, Alex und Jenny sind meine Freunde. Es gibt sie wirklich. Meine Schilderungen folgen ihrem Leben. Persönlich wollen sie nicht erkannt werden. Das respektiere ich. In dem Buch ändere ich daher ihre Namen und die Lebensräume, vernachlässige einige Details und überziehe andere deutlich. Eigentlich braucht es nur diese vier Leben und achtzehn Jahre, um zu zeigen, wie unser Bildungswesen funktioniert, wie es führt und verführt, wie es solange rüttelt und schüttelt, bis wir wieder dort angelangt sind, wo wir begonnen haben. Dies schlicht zu behaupten, wäre freilich billig. Also illustriere und belege ich die vier Bildungsverläufe mit Daten und Fakten. Das macht aus diesem Buch kein akademisches Werk, aber doch eine Darstellung, der die Forschung und die wissenschaftliche Verankerung nicht fehlen. Anprangern will ich mit diesem Buch nicht. Schwarzmalerei und Larmoyanz sind mir fremd. Ich will beschreiben, warum es so gekommen ist. Begreifen, wo wir einhaken können. Die Bildungsverläufe dieser vier Kinder und die Forschung zeigen uns im Kleinen wie im Großen, wie Deutschland zu einer Bildungsrepublik werden kann. Noch sind wir das nicht. Die Bildung der Kinder hängt jenseits ihrer Fähigkeiten und Potenziale zu stark von ihren Elternhäusern ab. Gerade für die vielen neugierigen Kinder mit Einwanderungsstatus ist das besonders hart. Die Unterschiede zwischen den Bundesländern sind so ausgeprägt, dass daraus ungleiche Lebenschancen für die Kinder entstehen. Den Anspruch auf Bildung als Bürgerrecht verwirklichen wir nicht. Warum eigentlich? Wir wissen, was zu tun ist. Wir sehen die Erfolge im Ausland, sehen viele wunderbare Schulen bei uns um die Ecke. Schulen, die Eltern mit ins Boot holen. Schulen, die mit kleinen Klassen, guten Lehrern und Sozialpädagogen die Schülerinnen und Schüler mitnehmen, die sie in ihrem Ehrgeiz piksen und sie motivieren. Wir stellen uns vor: Gemeinden lassen Schulen, Schüler, Lehrer und Eltern einen Pakt auf die Zukunft schließen. Sie ziehen an einem Strang und erzeugen das, was für sie und die Gesellschaft das Wichtigste ist: Unabhängigkeit, Selbstverwirklichung, ein gutes Leben. Auch davon handeln die folgenden Seiten. Gewidmet ist dieses Buch meiner Mutter, die sich über meine Frauenbücher immer gefreut hat, ein Bildungsbuch aber stets wichtiger fand. Nun ist es da, ohne dass sie es noch lesen und mir in zarten Nebensätzen deutlich kommentieren kann. Jutta Allmendinger Berlin, im August 2012 |
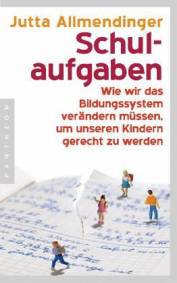
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen