|
|
|
Rezension
Was soll man zu diesem Schiller-Handbuch sagen? Es ist gelungen - durch und durch! Warum? 1) Es bietet auf fast 1000 S. einen umfassenden Zugang zu allen Aspekten des Schilerschen Werks. 2) 25 Schiller-Fachleute aus dem In- und Ausland bürgen für hohe Qualität der einzelnen Kapitel. 3) Es ist auf dem neuesten Stand. 4) Es ist klar und übersichtlich angelegt. 5) Es ist auch formal erstklassig gearbeitet: mit ausführlichen, mehr als 50 S. Register und jeweils weiterführender Literatur am Ende der jeweiligen Beiträge. - Schiller steht nicht nur laufend auf den Spielplänen der Theater, er ist auch Standard in den Lehrplänen und schulische Pflichtlektüre. An diesem Schiller-Handbuch wird kaum vorbeikommen, wer Schiller schulisch thematisiert.
Thomas Bernhard für lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Die von renommierten Schiller-Spezialisten verfasste Gesamtdarstellung von Schillers Leben und Werk gliedert sich in fünf Teile. Der einleitende Abschnitt gilt der Biographie und Schillers Auseinandersetzung mit Kultur und Gesellschaft seiner Zeit. Der zweite Teil stellt die Quellen dar, aus denen Schiller als Dramatiker und Lyriker, im Bereich der Philosophie, Rhetorik, Musikästhetik und der Antike-Rezeption schöpfte. Es folgt eine Bestimmung des individuellen Stils, den Schiller in den einzelnen literarischen Genres und als Kunstphilosoph entwickelt hat. Der umfangreiche vierte Teil erschließt das Gesamtwerk, die Dramen, die philosophischen und historischen Schriften, die Lyrik, das erzählerische Schaffen sowie literaturkritische Arbeiten und Übersetzungen. Die Wirkungsgeschichte im 19. und 20. Jahrhundert sowie ein ausführlicher Forschungsbericht bilden den Schlussteil. Prof. Dr. Helmut Koopmann, geboren 1933, war bis 2001 Ordinarius für Neuere Deutsche Literaturwissenschaft an der Universität Augsburg. Buchveröffentlichungen über das 18. Jahrhundert, Schiller, Heine, Thomas Mann. Bei Kröner hat er 1990 das ›Thomas- Mann-Handbuch‹ (3. Aufl. 2001) und 1998 das ›Schiller-Handbuch‹ herausgegeben. Weitere Veröffentlichungen u.a.: ›Friedrich Schiller‹ (1966, 2. Aufl. 1977), ›Schiller-Kommentar zu sämtlichen Werken des Dichters‹ (1969), ›Das junge Deutschland‹ (1970), ›Das Drama der Aufklärung‹ (1978), ›Schiller‹ (1988), ›Freiheitssonne und Revolutionsgewitter. Reflexe der Französischen Revolution im literarischen Deutschland‹ (1989), ›Schillers Leben in Briefen‹ (2000). Inhaltsverzeichnis
Vorwort XV
I. Schiller in seiner Zeit Schillers Leben und Persönlichkeit von T.J. REED 1 Leben und Legende 1 Kindheit und Natur 4 Erziehung. Rhetorische Welten 5 Flucht. Neue Abhängigkeit 9 Freundschaften 12 »Dieser Mensch, dieser Göthe 16 Ein literarisches Leben 19 Schiller und die zeitgenössische Literatur von G. SCHULZ 23 Frühe literarische Begegnungen 23 Literaturkritische Anfänge 27 Publizistische Unternehmungen 30 Literaturpolitik im Bund mit Goethe 35 Schillers politische Welt von O.W. JOHNSTON 44 Quellen, Vorlagen, Einflüsse 44 Die moralische Irrfahrt als getarnte Politik 48 Staat und Kirche. Mittel zum Zweck 50 Kantlektüre, Geschichtsstudien und deren Politisierung 51 Die Internalisierung der Politik 53 Weibliche Herrschaftsansprüche 57 Der unkorrumpierte Kampf um Freiheit 64 Schiller und die Verleger von H. FRÖHLICH 70 Der Selbstverleger 71 Erste Honorare 73 Der Buchmarkt um 1800 74 Schiller und Göschen 79 Der Fall Michaelis 82 Schiller und Cotta 83 Die letzten Jahre: Erfolg und Ertrag 85 II. Schüler und die kulturelle Tradition Schiller und die Antike von W. FRICK 91 »Affinitaet zu den Griechen«? Annäherungen und Hindernisse . . 91 »Schöne Welt, wo bist du?« - Elegischer Klassizismus 1785-1788 . . 95 »Vertrauter Umgang mit den Alten«: Lektüren und Studien 1788/89 98 »Übertriebene Bewunderung des Alterthums«: Distanzierung als Selbstbehauptung 101 Antike versus Moderne: Zur Diagnose einer produktiven Differenz 103 »Tiefere Blicke in die Kunst«: Die griechische Tragödie als Modell und Herausforderung 108 Schiller und die lyrische Tradition von A. BARTL 117 Über Bürgers Gedichte 117 Schiller und die Lyrik des Petrarkismus 119 Schiller und die Lyrik des Barock 123 Schiller und die Lyrik der Aufklärung 128 Die Fesseln der Sprache 132 Schiller und die dramatische Tradition von H. KOOPMANN 137 Die frühen Dramen: Schillers Montagetechnik und Kombinationsfähigkeit 137 Die klassische Zeit: Shakespeare und Sophokles 147 Schiller und die popularphilosophische Tradition von W RIEDEL 155 Popularphilosophie und Spätaufklärung 155 Schillers philosophische Bildung (bis zu den Kantstudien) 160 Schiller und die Musik von F. BRUSNIAK 167 Schillers Musikalität und Musikästhetik 167 Schillers Verhältnis zur Musik und zu Musikern seiner Zeit .... 175 Exkurs: Beethoven und die »Ode« An die Freude 179 Schillers Verhältnis zur Musik in der Weimarer Zeit 181 Wirkung 184 Schiller und die Rhetorik von G. UEDING 190 Schiller und die Religion von M. MISCH 198 Grundsätzliches zu Schillers Religionsverständnis 198 Religion in der Schaubühnen-Schrift von 1785 2O2 Die Sendung Moses und Etwas über die erste Menschengesellschaft nach dem Leitfaden der Mosaischen Urkunde 203 Schillers Auseinandersetzung mit Kants Religionsschrift von 1793 207 Ästhetische Tugend und Religion 209 III. Ästhetik Schiller und die Weimarer Klassik von T.J. REED 216 Hälften 216 Halbheiten 220 Ganzheit? 225 Reste 229 Schillers Theater- und Bühnenpraxis von H. KOOPMANN 233 Schillers Plan einer Mannheimer Dramaturgie 233 Die Dramaturgie der Theaterschriften 236 Vorbilder und Einflüsse 237 Schillers dramatischer Stil von M. RITZER 240 Das Schauspiel der Seele: Die Räuber 240 Ein republikanisches Trauerspiel: Die Verschwörung des Fiesko zu Genua 243 Das bürgerliche Trauerspiel: Kabale und Liebe 246 Vom Charakterdrama zur Tragödie: Don Karlos 248 Vom Geschichtsdrama zur Tragödie: Wallenstein 252 Die klassische Tragödie: Maria Stuart 256 Eine romantische Tragödie: Die Jungfrau von Orleans 259 Tragik in Reinform: Die Braut von Messina 201 Das »Volksstück«: Wilhelm Teil 265 Schillers lyrischer Stil von S. SCHWARZ 270 1776-1782: »die unsichern Versuche einer anfangenden Kunst« - Ausbildung eines lyrischen Stilwillens 271 1782-1795: »mehr Simplicität in Plan und Stil« - Entwicklung des klassischen Stilideals 278 1795-1803: »Kunstwahrheit. Schönheit. Vollendung« - stilistische Vollkommenheit 284 Schillers philosophischer Stil von K. L. BERGHAHN 289 Die rhetorische Tradition 289 Schillers philosophisches Stilideal 291 Der philosophische Stil der Ästhetischen Briefe 296 IV. Das Werk Lyrik Schillers Lyrik von H. KOOPMANN 303 Anthologie auf das Jahr 1782 306 Vorklassische Lyrik (1782-1788) 308 Die großen Gedichte der frühen Weimarer Zeit 311 Die klassische Lyrik 316 Schillers Dramen Die Räuber von H. R. BRITTNACHER 326 Die mißhandelte und die versöhnte Ordnung 326 Verstoßene Söhne, verlorene Väter 331 Die feindlichen Brüder 336 Räuber 344 Die Verschwörung des Fiesko zu Genua von H. KOOPMANN 354 Die Abkehr von der historischen Wahrheit 354 Schiller und die Psychologie 358 Die verschiedenen Fassungen 360 Das Theaterexperiment 361 Kabale und Liebe von H. KOOPMANN 365 Das bürgerliche Trauerspiel 366 Kabale und Liebe — ein Drama des Ständekonflikts, ein politisches Drama? 372 Grenzen und Gefährdungen des bürgerlichen Daseins 373 Der Kern der Tragödie 376 Don Karlos von H. REINHARDT 379 Entstehung und Überlieferung 380 Figuren, Themen, Zusammenhänge 383 Der »Held« und seine »Geheimnisse« 387 Konsequenzen 391 Wallenstein von H. REINHARDT 395 Komposition und Struktur 396 Ein Verräter mit »Tiefsinn« 402 Wo die Freiheit bleibt 406 Historischer Kontext 409 Maria Stuart von K. S. GUTHKE 415 Drama der inneren Handlung und Doppeltragödie 415 Elisabeths >gemischter Charakter< 422 Marias >Wandlung< 427 Die Jungfrau von Orleans von K. S. GUTHKE 442 Fragen der Motivation und Deutung 442 Johanna - >National Die Braut von Messina von K. S. GUTHKE 466 Schillers dramatisches >Sorgenkind< 466 Sinnfragen 473 Don Cesar — der Tod als Glück 478 Wilhelm Teil von H.-J. KNOBLOCH Stoff und Entstehung 486 Von Arkadien nach Elysium? 490 Der Bund der Eidgenossen 492 Teils »Privatsache« 496 Die Auseinandersetzung mit der Französischen Revolution .... 502 Demetrius von K.-H. HUCKE / O. KUTZMUTZ 513 Entstehung 513 Reichstagsfassung versus Samborszenen 515 Der Herrscher als Heiland: Messianismus 518 Versöhnte Geschichte: Schillers Huldigung Rußlands 519 Entwürfe, Fragmente von K.-H. HUCKE / O. KUTZMUTZ 523 Die Braut in Trauer 523 DieMaltheser 524 Die Polizey 527 Die Kinder des Hauses 529 Agrippina 531 Warbeck 532 Rosamund oder die Braut der Hölle 534 Die Gräfin von Flandern 536 Themistokles 537 Die Seedramen: Das Schiff, Die Flibustiers, Seestück 538 Elfride 540 Die Prinzessin von Zelle 541 Entwurf eines Lustspiels im Geschmack von Goethes Bürgergeneral 543 Marbacher Dramenverzeichnis und Marbacher Themenliste . . . 544 Schillers philosophische Schriften Schriften der Karlsschulzeit von W. RIEDEL 547 Medizinisch-philosophische Dissertationen 547 Festreden 555 Sonstiges 557 Schriften zum Theater, zur bildenden Kunst und zur Philosophie vor 1790 von W. RIEDEL 560 Theater 560 Bildende Kunst 566 Philosophie 569 Kleinere Schriften nach der Begegnung mit Kant von H. KOOPMANN 575 Schiller und Kants Theorie des Erhabenen 575 Schillers Theorie der Tragödie 577 Schillers Inokulations-Theorie 581 Schillers Auseinandersetzung mit Fichte 583 Die Überwindung Kants 584 Über Anmut und Würde von H. R. BRITTNACHER 587 Entstehung, Intention, Bedeutung 587 Die Allegorese des Mythos 590 Die Analyse der Bewegungen 593 Echte und falsche Grazie 596 Die schöne Seele 598 Würde 603 Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen von R.-P.JANZ 610 Entstehung 610 Ästhetische Versöhnung 611 Ästhetische und politische Theorie 612 Juno Ludovisi; Schönheit als Freiheit in der Erscheinung 615 Anthropologie und Ästhetik des Spiels 617 Natur und Kunst 618 Autonomie der Kunst und ästhetische Erziehung 619 Schöner Schein 620 Widersprüche, Mehrdeutigkeit, Ambivalenz 623 »Ästhetischer Staat«? 624 Über naive und sentimentalische Dichtung von H. KOOPMANN 627 Das Naive und die Krise der Aufklärung 627 Schillers Selbstverteidigung gegenüber Goethe 632 Die Abrechnung mit der zeitgenössischen Literatur 634 Gattungstheoretisches 635 Schriften von Schiller und Goethe von H. KOOPMANN 639 Ueber epische und dramatische Dichtung und der Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe 639 Das Schema zu Der Sammler und die Seinigen 645 Die Schemata Über den Dilettantismus 647 Schiller als Historiker von J.EDER 653 Vorbemerkungen 653 Geschichte des Abfalls der vereinigten Niederlande von der Spanischen Regierung 662 Geschichte des Dreyßigj ährigen Kriegs 672 Antrittsvorlesung zur Universalgeschichte und kleinere historische Schriften 684 Schillers Erzählungen von H. KOOPMANN 699 Eine großmütige Handlung, aus der neusten Geschichte 700 Der Verbrecher aus verlorener Ehre 702 Herzog von Alba/Spiel des Schicksals 704 Der Geisterseher 705 Übersetzungen, Bearbeitungen 708 Schiller als Rezensent von M. MISCH 711 Rezensorische Anfänge 711 Die Egmont-Rezension von 1788 716 Die Bürger-Rezension von 1791 720 Die Matthisson-Rezension von 1794 724 Übersetzungen, Bühnenbearbeitungen von H. KOOPMANN 729 Vergil-Übersetzungen 730 Euripides-Übersetzungen 732 Phädra 734 Bühnenbearbeitungen 735 Macbeth 736 Nathan der Weise 737 Turandot 738 Weitere nicht erhaltene Theaterbearbeitungen, Othello 739 Weitere Übersetzungen bzw. Bearbeitungen aus dem Französischen 740 Schillers Zeitschriften von M. MISCH 743 Wirtembergisches Repertorium der Litteratur (1782-1783) .... 744 Rheinische Thalia (1785) 746 Thalia (1785-1791) 749 Neue Thalia (1792-1795) 751 Die Hören (1795-1798) 752 V. Schiller und seine Wirkung Schiller im 19. Jahrhundert von U. GERHARD 758 Zitatsammlungen, Deklamationen und Leseabende 760 Schillerrezeption und gesellschaftliche Modernisierung 764 Pathos und Politik 767 Das Schillerfest 1859 als bürgerliche Demonstration 770 Schiller im 20. Jahrhundert von C. ALBERT 773 Monumentalisierung und Enthistorisierung 774 Schiller im Deutschland des Nationalsozialismus und im Exil . . . 779 Schiller in den beiden deutschen Staaten (1945-1959) 783 »Schiller spielen« oder »mit Schiller spielen« - Inszenierungen seit 1945 786 Schiller-Forschung im Nationalsozialismus 788 Schiller im Ausland: Dichter-Denker und Herold der nationalen Befreiung von P. BOERNER 795 Früher Ruhm durch Die Räuber 795 Madame de Stael: Apotheose des deutschen Dichter-Denkers . . . 796 Schiller auf französischen Bühnen 797 Erhebung und Verklärung in England 798 Herold der nationalen Befreiung in Polen, Italien und Spanien . . 800 Der Triumph in Rußland 801 Dänische Sympathien 802 Divergenzen und Gemeinsamkeiten der Urteile 803 Epoche der Ablehnung und des Vergessens. Urteile der Forschung 804 Symbol des Deutschtums in Amerika 805 Forschungsgeschichte von H. KOOPMANN 809 Schiller-Ausgaben 810 Frühe Schiller-Forschung 813 Schiller-Forschung 1950-1970 819 Zur Lyrik 819 Zu den Dramen 823 Zu den Erzählungen, historischen Arbeiten, ästhetischen Schriften 840 Schiller-Forschung 1970-1980 843 Größere Gesamt- bzw. Teildarstellungen 845 Zur Lyrik 851 Zu den Dramen 854 Zu den Erzählungen, historischen Arbeiten, ästhetischen Schriften 872 Schiller-Literatur 1980-1996 88l Zur Lyrik 889 Zu den Dramen 892 Zu den Erzählungen, historischen Arbeiten, ästhetischen Schriften 915 Neuere Sammelwerke 930 Die Mitarbeiter 933 Personenregister 939 Register der Werke Schillers 951 Sachregister 957 |
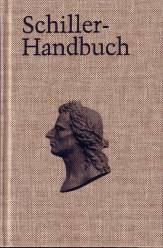
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen