|
|
|
Umschlagtext
Der ROUGH GUIDE JAZZ ist das umfassendste und aktuellste Lexikon über rund einhundert Jahre Jazz und zugleich das einzige, das von aktiven Jazz-Musikern verfaßt wurde, lan Carr, der als Gründer und Trompeter der Band Nucleus Jazz-Rock-Geschichte geschrieben hat, ist u.a. Verfasser einer vielgerühmten Miles Davis-Biographie; Trompeter Digby Fairweather und Pianist Brian Priestley sind bekannte Rundfunkautoren. In über 1700 Einträgen behandeln sie biographische Daten von
Künstlern, kommentieren Werdegang und Werk: angefangen bei dem sagenumwobenen Kornettisten der ersten Stunde, Buddy Bolden aus New Orleans, über Swing und den revolutionären Umbruch in der Bebop-Ära, Free Jazz und Weltmusik-Verschmelzungen bis hin zu jungen Musikern wie Courtney Pine oder Nils Wogram, die die zeitgenössischen Entwicklungen repräsentieren. Die Beiträge, die durchgängig von klassischen Porträtaufnahmen und bahnbrechenden Plattencovern begleitet werden, sind um eine ausführliche Diskographie mit über 3000 LP- und CD-Empfehlungen ergänzt. Ein umfangreiches Glossar informiert neben Erklärungen von Fachbegriffen in Essais über Stilrichtungen und Bewegungen im historischen und musikalischen Kontext. Rezension
Der "Rough Guide: Jazz" ist wohl tatsächlich, - wie der Untertitel behauptet -, der ultimative Führer zum Jazz für die Handbibliothek jeden Jazz-Freunds, aber auch für die Schulbibliothek und den Musikunterricht. Das angefügte Glossar auf den S. 725-762 bietet darüber hinaus präzise Begriffsbestimmungen zum Thema.
Thomas Bernhard für lehrerbibliothek.de Pressestimmen: Die Beiträge, die sachliche Information mit differenzierter Wertung verbinden, zeugen durchwegs von Kompetenz, Umsicht und Augenmaß. Neue Zürcher Zeitung Eine unentbehrliche Anschaffung, die im Regal jedes Jazzfans stehen sollte. Jazz Journal International Als Ratgeber jedoch, der nicht mit Kritik spart, aber Größe immer vollkommen anzuerkennen weiß (und oft auch sehr gut erklären kann, wie es dazu kommt), ist der Rough Guide Jazz wohl in jeder kleineren privaten Musikbibliothek unentbehrlich. Stuttgarter Zeitung Verlagsinfo
Der unentbehrliche Leitfaden durch den Jazz. 1700 Künstler und Bands von den Anfängen bis heute. Mit 3000 CD- und LP-Empfehlungen sowie 300 Fotos und Plattencovers. Der Rough Guide Jazz ist das umfassendste und aktuellste Lexikon über einhundert Jahre Jazz und zugleich das einzige, das von aktiven Jazz-Musikern verfaßt wurde. Autoreninformation: Die Autoren sind selbst aktive Jazzmusiker: Ian Carr, der als Gründer und Trompeter der Band Nucleus Jazz-Rock-Geschichte geschrieben hat, ist u.a. der Verfasser einer vielgerühmten Miles Davis-Biographie; Trompeter Digby Fairweather und Pianist Brian Priestley sind bekannte Rundfunkautoren. Inhaltsverzeichnis
A-Z
Leseprobe: Jan Garbarek Sopran-, Tenor- und Baßsaxophon, Flöte. geb. am 4. März 1947 in Mysen, Norwegen. Der Autodidakt Garbarek wollte, nachdem er 1961 im Radio John Coltrane gehört hatte, Saxophon spielen. 1962 gewann er einen Wettbewerb für Amateurjazzer, was zu einem ersten professionellen Job führte. Er schrieb sich an der Universität in Oslo ein, gab das Studium aber bald wieder auf, weil er als Musiker zu eingespannt war. Seit Anfang der 60er hat er seine eigenen Gruppen geleitet, aber auch mit George Russell gearbeitet, der Ende der 60er vier Jahre in Skandinavien ansässig gewesen ist. Garbarek studierte Russells Buch The Lydian Chromatic Concept Of Tonal Organisation. Außerdem spielte er mit der Sängerin Karin Krog. 1970 ging er als Stipendiat in die USA und nahm erstmals für ECM auf; seither ist er diesem Label verbunden geblieben. Desweiteren hat er mit Chick Corea und Don Cherry gespielt und Mitte der 70er mit Keith Jarrett, Falle Danielsson (b.) und Jon Christen-sen zwei klassische Alben, Belonging und My Song, herausgebracht. Garbareks Beitrag zu diesen Platten etablierte ihn als einen der wichtigsten Saxophonisten der Post-Coltrane-Ära. Sein als Belonging-Band bekanntes Quartett gastierte gegen Ende des Jahrzehnts in Europa, Japan und in den USA und nahm im Village Vanguard, New York, ein Live-Doppelalbum mit neuem Material auf. In den 80ern leitete Garbarek ein sehr charakteristisches Quartett mit dem Bassisten Eberhard Weber, Christensen (dem erst Michael Di Pasqua und dann Nana Vasconcelos nachfolgten) als Schlagzeuger und Perkussionist und einer Reihe von Gitarristen wie Bill Frisell, Moss Trout und David Torn; gegen Ende der 80er machten die Gitarristen dem Keyboarder Rainer Brüninghaus Platz. Ende der 80er und Anfang der 90er hat Garbarek mit seinem Saxophon unterschiedliche Besetzungen und Genre ausgekundschaftet; er hat mit verschiedenen nordischen Sängerinnen und Musikern aus dem Osten aufgenommen und ist mit dem Hilliard Ensemble aufgetreten, mit dem er auch mittelalterliche und liturgische Musik aus der Renaissance eingespielt hat. Seine Reputation bei Kritikern und Publikum ist auf internationaler Ebene konstant gewachsen, und in künstlerischer wie in finanzieller Hinsicht zählt er zu den erfolgreichsten Jazz-Musikern Europas. Seine bevorzugten Saxophonisten sind Johnny Hodges, John Coltrane, Albert Ayler, Pharoah Sanders, Archie Shepp und Gene Ammons; andere Inspirationen bezieht er von Miles Davis, Ornette Coleman und Jarrett. Manfred Eicher, sein Produzent bei ECM, hat Garbarek einmal als „eine sehr asketische Persönlichkeit mit einem asketischen Auftritt und asketischem Sound" beschrieben. Askese kennzeichnet jedoch seine sparsame Phrasierung und keineswegs das Feeling, das ihr zugrunde liegt. Garbarek spielt keine ,licks' (vorgefaßte oder gängige Figuren), seine Improvisationen klingen vielmehr wie destillierte Gedanken oder Ideen, die in der Eingebung des Augenblicks greifbar werden und ihren Ausdruck finden. Unter dem kristallklaren Eis lodert ein Feuer an Feeling, das umso mächtiger wird, je stärker es unter Kontrolle steht. Jede Note, jede Phrase ist bedeutungsvoll, es gibt keine Rhetorik, nur Poesie. Seine außergewöhnlichen klanglichen Qualitäten transportieren das intensive Feeling; er verfügt über eine breite Palette von subtilen Modulationen, Timbres und Möglichkeiten, Töne auszudrücken, die allesamt emotional beredt sind. Seine großartigen Kompositionen für kleine Besetzungen bergen die gleichen Charakteristika wie sein Spiel in sich. Seine Musik ist affirmativ und läßt die Vergangenheit nachhallen — Echos von nordischen Volksliedern, alter Kirchenmusik, Halbvergessenem aus längst vergangenen Zeiten. [IC] 0 Afric Pepperbird (1970; ECM). Das ist ein Debüt in zweifacher Hinsicht - Garbareks erste Platte und auch das erste Album von ECM - und ein vielversprechender Anfang: Das Album weist auf die impressionistische Richtung hin, die Garbarek später einschlagen wird, enthüllt aber auch seine nach innen gekehrte, deklamatorische Seite, die Coltrane und Ayler so viel zu verdanken hat. Der Titeltrack bezieht sich auch auf den Miles Davis jener Tage. 0 Places (1977; ECM); Paths Prints (1981; ECM). Garbareks passioniertem, brennenden Romantizismus und klangvollen Kompositionen werden auf diesen beiden Quartettalben freie Bahn gewährt - das erste ist mit dem Gitarristen Bill Connors, John Taylor und Jack Dejohnette und das zweite mit Bill Frisell, Eberhard Weber und Jon Christensen. 0 Legend Of The Seven Dreams (1988; ECM). Mit Rainer Brüninghaus, Eberhard Weber und Nana Vasconcelos hat Garbarek nun damit begonnen, sich gründlicher in die nordische Volksmusik zu versenken. Die nackte Emotion auf diesem Album hypnotisiert. 0 Ragas And Sagas (1990; ECM); Madar (1992; ECM). Garbarek fühlt sich neben den indischen Musikern auf diesen beiden Alben richtig wohl. Seine sparsamen Phrasierungen sind marmorn und passen perfekt zu dieser Sachlichkeit. 0 Twelve Moons (1993; ECM). Zu Garbarek, Brüninghaus und Weber gesellen sich der Rock-Schlagzeuger Manu Katche, die Perkussionistin Marylin Mazur und zwei Sängerinnen. Garbareks leidenschaftliches Herabstürzen und Emporschnellen sowie die Rhythmusgruppe beeindrucken tief: ein exquisites Album voll wundervoller Dynamik, Klangreichtum und großem Lyrismus. 0 Officium (1993; ECM). Garbarek improvisiert hieran der Seite des Hilliard Ensembles, ein britisches Gesangsquartett, das sich auf alte Musik spezialisiert hat. Die glorios klangvolle, liturgische Atmosphäre wird von Garbareks Sopran- und Tenorsaxophon durchdrungen. Das Album mußte den Nerv des internationalen Publikums getroffen haben, denn es war wenige Wochen nach seiner Veröffentlichung 350.000 Mal über den Ladentisch gegangen. 0 Rites (1998; ECM). Die Doppel-CD bietet nordische Anklänge, synthetische Sounds und Samples, Marilyn Mazun Rainer Brüninghaus und vieles mehr: Keith Jarrett (Belonging; My Song); Shankar (Song For Everyone); Ralph Towner (Solstice); Kenny Wheeler (Deer Wan). |
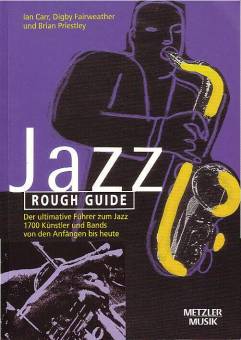
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen