|
|
|
Umschlagtext
Die Aufarbeitung der Vergangenheit der evangelischen Kirche im Nationalsozialismus ist durch das Auftauchen neuer Vorwürfe nach wie vor im Fokus der öffentlichen Diskussion. Wie sehr waren die Kirchenleitungen dieser Zeit angepasst oder leisteten sie den nötigen Widerstand gegen Hitler? Die Didaktische FWU-DVD sucht nach Antworten jenseits von einseitigen Schuldzuweisungen. Sie porträtiert drei evangelische Christen, die sich der Anpassung an und in das NS-System verweigerten. Ein Dokumentationsfilm zeichnet exemplarisch Leben und Wirken des bayerischen Landesbischofs Hans Meiser nach und stellt es zur Diskussion. Die Zeit nach 1945 wird unter anderem mittels Denkmälern zu Ehren Dietrich Bonhoeffers thematisiert. Die DVD bietet eine Einführung in die historische Situation der Protestanten zwischen Kreuz und Hakenkreuz und beleuchtet die stets aktuelle Frage nach Anpassung und Widerstand. Arbeitsblätter und Verwendungstipps erschließen die Materialien für den Unterricht.
Schlagwörter Kirche, Drittes Reich, Nationalsozialismus, Hans Meiser, Widerstand, Verweigerung, Dietrich Bonhoeffer, Denkmal, Gedenken, NS-Vergangenheit Evangelische Kirche, Bekennende Kirche, Deutsche Christen, Religion Kirche und Gesellschaft • Kirchengeschichte Kirche und Gesellschaft • Kirche und Staat Geschichte Epochen • Nationalsozialismus • Verfolgung Epochen • Nationalsozialismus • Widerstand Biografien Allgemeinbildende Schule (9-13) Kinder- und Jugendbildung (14-18) Erwachsenenbildung Alle Urheber- und Leistungsschutzrechte vorbehalten. Nicht erlaubte/ genehmigte Nutzungen werden zivilund/ oder strafrechtlich verfolgt. LEHRProgramm gemäß § 14 JuSchG GEMA Laufzeit: 55 min 10 Sequenzen (deutsch) 4 interaktive Menüs (deutsch) 5 Bilder Sprachen: deutsch DVD-ROM-Teil: Unterrichtsmaterialien Systemvoraussetzungen bei Nutzung am PC DVD-Laufwerk und DVD-Player- Software, empfohlen für Windows ME/2000/XP/Vista Rezension
Das "Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht" bietet ganz hervorragendes visuelles Unterrichtsmaterial zu fast allen Unterrichtsbereichen und für alle Altersstufen an; die Materialien sollten viel stärker im schulischen Unterricht genutzt und eingesetzt werden, zumal sie neben kompaktem Bildmaterial auch hervorragend didaktisch aufbereitet sind und heutzutage im DVD-Zeitalter auch viel besser in Sequenzen eingesetzt werden können als noch zu Zeiten der VHS-Cassette oder gar der frühen 16mm-Filme. Außerdem stehen auf der DVD selbst Arbeitsblätter, didaktische Hinweise und ergänzende Unterrichtsmaterialien zur Verfügung, die unmittelbar unterrichtlich verwendet werden können. Die FWU-Medien sind in den Kreisbildstellen oder den Stadt- bzw. Schulbibliotheken in der Regel schnell ausleihbar und heute ohne größere Umstände einsetzbar (früher wurde noch ein 16mm-Film-Vorführschein benötigt ...). - Die hier anzuzeigende DVD bietet in 55 Min. Laufzeit 10 Sequenzen, die auch je einzheln gezeigt werden können, zum Thema "Kirche im Dritten Reich" / "Protestantismus und Nationalsozialismus", - ein Thema, das immer wieder im Religionsunterricht begegnet, u.a. verknüpft mit dem Namen Dietrich Bonhoeffer, und das zur fächerverbindenden Zusammenarbeit mit dem Fach Geschichte (Politik) genutzt werden sollte.
Jens Walter, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Lizenzpreise: Unterrichtslizenz 85,00 EUR Sachgebiete: Geschichte Biographien Epochen --> Neuere Geschichte --> Faschismus und Nationalsozialismus --> Verfolgung Religion Religionskunde --> Weltanschauungen, Ideologien Kirche und Gesellschaft Kirchengeschichte Kirche und Staat Religiöse Lebensgestaltung --> Grunderfahrungen --> Vertrauen Schlagworte: Kirche; Meiser, Hans; Widerstand; Verweigerung; Bonhoeffer, Dietrich; Denkmal; Gedenken; NS-Vergangenheit; Evangelische Kirche; Bekennende Kirche; Deutsche Christen; Landeskirche; Verfolgung; Anpassung; Kirchenkampf; Staat und Kirche; Protestantismus; Judenmission; Niemöller, Martin; Praun, Friedrich von; Sylten, Werner; Leipelt, Hans; Weiße Rose; Huber, Kurt; Nachfolge Christi; Märtyrer; Stuttgarter Erklärung; Kirchliches Schuldbekenntnis Vorkenntnisse: Den Schülerinnen und Schülern sollten innen- und außenpolitische Belastungsfaktoren (politisch systemisch, wirtschaftlich, sozial und geographisch) der Weimarer Republik und die sich daraus ergebenden Bedingungen für Machtübertragung und "Gleichschaltung" bekannt sein. Die Geschichte des Nationalsozialismus sollte ihnen zumindest in Grundzügen vertraut sein. Lernziele: Die Schülerinnen und Schüler können: unterschiedliche Haltungen von Christen zum Nationalsozialismus aus deren theologischen Vorstellungen herleiten; an einem Beispiel erläutern, wie aus christlicher Überzeugung gegen die nationalsozialistische Ideologie und Praxis Widerstand geleistet wurde; die Problematik des Umgangs mit Schuld an Beispielen aus der neueren Kirchengeschichte erläutern und in Beziehung setzen zu einem evangelischen Verständnis von Rechtfertigung und Verantwortung; Schlüsselereignisse, Personen und Merkmale des Kirchenkampfes benennen; Ideologie und Unterdrückungsmechanismen der NS-Diktatur charakterisieren; das Problem von Anpassung und Widerstand unter dem NS-Regime und in totalitären Systemen allgemein diskutieren; ein Bewusstsein für das Problem eines kollektiven Schuldbekenntnisses, eines kollektiven Gewissens und eines kirchlichen Schuldbekenntnisses ohne Erteilung der Absolution vor dem Hintergrund protestantischer Lehren und Grundüberzeugungen haben; die Problematik von Widerstand bzw. Verweigerung auf die heutigen politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse übertragen; Argumente für und wider politisches Engagement seitens der Kirche vortragen; die Wirkungen von Meinungsäußerungen von Amtsträgern und Privatmenschen ein- und deren Folgen abschätzen; verschiedene Sichtweisen wahrnehmen, gegenüberstellen und als berechtigt anerkennen; einseitige Darstellungen von Ereignissen erkennen und kritisch reflektieren. Adressatenempfehlung: Allgemeinbildende Schule (9-13); Kinder- und Jugendbildung (14-18); Erwachsenenbildung Sprache: Deutsch Begleitmaterial: Beiheft: FWU (Grünwald), 2008, 10 S. Kontextmedien: DVD-Video 46 02599 Hitler an der Macht DVD-Video 46 10499 Der Priesterblock VHS 42 02924 Die weiße Rose DVD-Video 46 02304 Deutsche im Widerstand 1933 - 1945 DVD-Video 46 10553 Otto Weidt - ein stiller Held: Widerstand im Nazideutschland DVD-Merkmale: 10 Sequenzen, 4 interaktive Menüs, 5 Bilder, DVD-ROM-Teil: Unterrichtsmaterialien Inhaltsverzeichnis
DVD-Video didaktisch, 55 min f
Bundesrepublik Deutschland 2008 Zum Inhalt Hauptmenü „Protestanten zwischen Kreuz und Hakenkreuz“ Vom Hauptmenü aus können drei weitere Menüs aufgerufen werden. Hauptmenü Menü „Biografien der Verweigerung“ Anhand von Archivaufnahmen, Fotografien und Interviews mit Angehörigen sowie Zeitgenossen werden in einzelnen Sequenzen die evangelischen Christen Friedrich von Praun, Hans Leipelt und der evangelische Pfarrer Werner Sylten porträtiert. Ihre Biografien zeigen, auf welche individuelle Art und Weise und aus welchen Gründen sich Menschen dem nationalsozialistischen System verweigerten und welche Rolle ihr Glaube dabei spielte. Sie verdeutlichen aber auch, wie grausam der Nationalsozialismus seine Gegner definierte, ausgrenzte und vernichtete. Friedrich von Praun Friedrich von Praun verkörpert den gläubigen, aber nicht theologischen Mitarbeiter in der Evangelischen Kirche. Die knapp sechsminütige Videosequenz porträtiert den eher unbekannten von Praun in erster Linie mittels authentischem Bildmaterial. Von Praun wird 1888 im mittelfränkischen Hersbruck geboren. Wie viele Adelige ist er Anhänger der Monarchie, streng konservativ und ein überzeugter Protestant. Als die Landeskirche 1930 in Ansbach eine Verwaltungs- und Finanzbehörde einrichtet, wird von Praun Leiter dieser Landeskirchenstelle. Drei Jahre lang versieht er hier unbehelligt seinen Dienst. Das ändert sich nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten abrupt. In Ansbach begrüßen die meisten Pfarrer ebenso wie die Gemeindeglieder die neue Reichsregierung unter Hitler. Von Praun wehrt sich über Jahre vehement gegen eine Übernahme der Landeskirche durch die Deutschen Christen. 1943 wird er schließlich verhaftet. Der vermeintliche Grund: Während eines Luftangriffes hatte er ausgesprochen, was viele dachten: „Nun kann nur noch Gott helfen“. 1944 stirbt von Praun auf ungeklärte Weise in Haft. Während der Trauerfeier kommt es zum Eklat. Landesbischof Meiser ist gekommen und geht auf den vermeintlichen Selbstmord ein. Die Witwe von Praun ist von den Anprachen enttäuscht. Sie spricht vor dem Sarg stehend die Worte aus der Bergpredigt: „Selig sind, die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn sie werden Gott schauen“. Daraufhin verlassen Landesbischof Meiser und die übrige Kirchenprominenz die Trauerfeier. Sie fürchten, die Beisetzung werde als politisches Manifest gegen das Naziregime gedeutet. Irene von Praun dagegen ist der festen Überzeugung, dass ihr Mann zum Märtyrer seiner Kirche geworden sei. Hans Leipelt In der zehnminütigen Videosequenz erzählt in erster Linie die damalige Freundin von Hans Leipelt, Marie-Luise Jahn, dessen Geschichte. Die Biografie Leipelts ist unter verschiedenen Gesichtspunkten wie seines jungen Alters und seiner Verbindung zur Widerstandsgruppe „Weiße Rose“ gerade auch für Jugendliche interessant. Hans Leipelt kommt als 20-Jähriger zur Fortsetzung seines Studiums 1941 nach München. Geboren 1921 in Wien, wuchs er in einer evangelischen Familie auf. Doch seine Mutter gilt nach Nazidiktion als „Volljüdin“. Hans Leipelt und Marie-Luise Jahn begegnen sich im Institut ihres Chemieprofessors, dem Nobelpreisträger Heinrich Wieland, der sogenannte halbjüdische Studenten in seinem Institut zum Studium aufnahm. Hans Leipelt und Marie-Luise Jahn hatten in dieser Zeit weder an den Treffen der „Weißen Rose“ teilgenommen noch eines der Flugblätter mitverfasst. Hans Leipelt hatte das sechste Flugblatt mit der Post erhalten. Der Inhalt begeisterte ihn und Marie-Luise. So beschlossen beide spontan, dieses letzte Flugblatt der Gruppe weiter zu verteilen. Im Herbst 1943 wurde Hans Leipelt verhaftet; er war denunziert worden. Zusammen mit Marie-Luise Jahn hatte er für den Unterhalt der Familie des mittlerweile hingerichteten Professors Huber gesammelt. Im Abschiedsbrief an seine Schwester schrieb er: „Zutrauen zu Gott dürfen, ja müssen wir haben, auch wenn wir seine Wege einmal nicht verstehen und vielleicht sogar hart finden. … Ich fühle im wahrsten Sinne des Wortes göttliche Ruhe in mir und sterbe ohne Angst in der Hoffnung auf Gottes Vergebung.“ Am 29. Januar 1945 wird Hans Leipelt in Stadelheim hingerichtet. Werner Sylten Werner Sylten steht beispielhaft für die in nationalsozialistischen Konzentrationslagern ermordeten Pfarrer. Sein Sohn, Walter Sylten, sowie ein ehemaliger Mithäftling, Priester Hermann Scheipers, schildern in der fast vierzehnminütigen Videosequenz eindrücklich diese Biografie der Verweigerung. Werner Sylten wurde 1893 in der Schweiz geboren und wuchs nahe Würzburg auf. Er entstammte einem liberalen Elternhaus. Sein Vater war Jude, seine Mutter Christin. Später lebte er mit seiner Familie in Bad Köstritz in Thüringen, wo er ein evangelisches Mädchenheim leitete. Sylten ist Anhänger der religiösen Sozialisten und für die Nationalsozialisten ein „Halbjude“. Die Arbeit im Mädchenheim wird ihm versagt, für kirchliche Stellen ergeht die Weisung „unerwünscht“. In Berlin arbeitete er schließlich bis zu seiner Verhaftung im Februar 1941 in der „Kirchlichen Hilfsstelle für evangelische Nichtarier“, dem Büro Grüber. Zunächst ist Werner Sylten im KZ Sachsenhausen inhaftiert, noch im Laufe des Jahres wird er nach Dachau deportiert. Katholische und evangelische Geistliche aus ganz Europa sind hier im „Pfarrerblock“ zusammengepfercht. Den Pfarrern ist es gestattet, in ihrem Block Gottesdienste abzuhalten – für viele der Geistlichen ein wichtiger Trost. Im August 1942 ist Werner Sylten mit seinen Kräften am Ende. Er wird ins Krankenrevier verlegt und dort bei einer Selektion durch SS-Ärzte einem Invalidentransport zugeteilt. Der Invalidentransport aus dem KZ Dachau endet in Schloss Hartheim bei Linz. In der sogenannten Euthanasie-Anstalt wird Werner Sylten Mitte August 1942 durch Vergasung ermordet. Menü „Landesbischof im Dritten Reich: Hans Meiser“ Die Dokumentation beleuchtet unter Bezugnahme auf neu entdecktes Archivmaterial und Einschätzungen der Kirchengeschichtsexperten Professor Carsten Nicolaisen und Dr. Björn Mensing kritisch die Amtszeit Hans Meisers als Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern von 1933 bis 1955. Der Sohn des 1956 Verstorbenen schildert zudem eindrucksvoll die Ereignisse rund um die Amtsenthebung und Wiedereinsetzung Meisers 1934. Der ca. 26-minütige Film ist sowohl im Ganzen als auch in folgenden sechs Sequenzen abrufbar, wobei die sechste Sequenz „Wir haben oft genug versagt“ Das Beispiel Hans Meiser im Menü „Und nach 1945?“ zu finden ist. Annäherung von Kirche und NS-Staat Die bayerische Landessynode wandelt das Amt des Kirchenpräsidenten in das eines Landesbischofs um und entmachtet sich damit selbst, indem sie es mit außerordentlichen Vollmachten ausstattet („Gesetz zur Ermächtigung zum Erlass von Kirchengesetzen“). Sie kopiert damit das „Führerprinzip“ für die Kirche. Meiser erkennt „den drohenden Konflikt“ mit dem neuen Regime und verlegt sich auf Diplomatie, um „nicht an den Rand des Geschehens hinausgeschleudert“ zu werden und die Eigenständigkeit und Einflussmöglichkeiten der Kirche gänzlich zu verlieren. „Des Führers allergetreueste Opposition“ Gegen Versuche des deutschchristlichen Reichsbischofs (Ludwig Müller), die Eigenständigkeit der Landeskirchen aufzuheben und deren Leitung zu übernehmen, protestiert Meiser (zusammen mit dem württembergischen Landesbischof Theophil Wurm) bei Hitler persönlich. In einer Audienz weigert sich Hitler, Müller abzuberufen. Die Sequenz beleuchtet mit Einschätzungen des Kirchenhistorikers Prof. Carsten Nicolaisen die denkwürdige Entgegnung Meisers: „Wenn der Führer bei seinem Standpunkt verharren will, bleibt uns nichts anderes übrig als seine allergetreueste Opposition zu werden.“ Kirchenkampf Meiser wird wegen seines Widerstandes gegen den Reichsbischof abgesetzt. An den Originalschauplätzen wird gezeigt, wo Meiser in München seinen Hausarrest verbrachte. Sein Sohn schildert Begegnungen mit der SS und Gestapo. Schnell formiert sich eine gewaltige Opposition in der evangelischen Kirche für den Bischof. Professor Nicolaisen erörtert, dass sich daraus jedoch keine grundsätzliche Opposition gegen die Diktatur entwickelt hat. Hitler nimmt die Amtsentsetzung schließlich zurück. „Intakte Kirche“ Durch den Sieg Meisers im Kirchenkampf bleibt die bayerische Landeskirche vermeintlich „intakt“. Mit diplomatischen Entgegenkommen versucht Meiser, weitere Konflikte mit dem Regime zu vermeiden. Krieg und Holocaust Meiser äußert sich nach dem Polenfeldzug erleichtert über die Rückkehr der in Versailles unter Zwang abgetretenen deutschen Gebiete. Meiser schweigt aus Sorge um die „Intaktheit“ seiner Landeskirche zu Euthanasie und Judenverfolgung und -vernichtung, die bei öffentlichem Protest nicht zu gewährleisten sei. Meisers Lan- deskirche unterstützt jedoch finanziell als einzige Landeskirche die Hilfestellungen der Bekennenden Kirche für verfolgte Juden, das Büro Grüber. Menü „Und nach 1945?“ „Wir haben oft genug versagt.“ Das Beispiel Hans Meiser Meiser setzt sich zusammen mit Kardinal Faulhaber bei der amerikanischen Besatzungsmacht für die Wiederaufnahme von Parteimitgliedern in den kirchlichen Dienst ein. Meiser unterzeichnet die Stuttgarter Erklärung der EKD, hält aber weitere kollektive Schuldbekenntnisse für unnötig. Als erster Landesbischof schafft er das „Führerprinzip“ in der Landeskirche ab und gibt der Landessynode ihre Macht zurück. In der Synode bekennt er eigenes Versagen, Wiedergutmachung könne jedoch nur durch zukünftiges besseres Handeln geleistet werden. Kritik von Leuten, die in der NS-Zeit keine Verantwortung für Viele trugen, hält er für nicht zielführend. Er organisiert Rechtsbeistand für Angeklagte in den alliierten Kriegsverbrecherprozessen. Der Pfarrer und Historiker Björn Mensing kritisiert Meisers Bemühungen um ein ansatzweise faires Verfahren für deutsche evangelische Angeklagte vor den alliierten Gerichten. Meiser hält bis zu seinem Tod an der in den christlichen Kirchen verbreiteten Lehre von der Notwendigkeit der Judenmission fest. Gedenken: Das Beispiel Dietrich Bonhoeffer Die Galerie zeigt vier Fotografien von Denkmalen sowie eine Briefmarke zu Ehren Dietrich Bonhoeffers. Neben der Interpretation der Denkmale an sich, können die Fotografien als Impuls für die Beschäftigung mit folgenden Fragen dienen: Wessen wurde nach 1945 gedacht und auf welche Art und Weise? Was ist ein Denkmal, welche Funktionen soll es erfüllen? Bezug zu Lehrplänen und Bildungsstandards Die Schülerinnen und Schüler können: - unterschiedliche Haltungen von Christen zum Nationalsozialismus aus deren theologischen Vorstellungen herleiten - an einem Beispiel erläutern, wie aus christlicher Überzeugung gegen die nationalsozialistische Ideologie und Praxis Widerstand geleistet wurde - die Problematik des Umgangs mit Schuld an Beispielen aus der neueren Kirchengeschichte erläutern und in Beziehung setzen zu einem evangelischen Verständnis von Rechtfertigung und Verantwortung - Schlüsselereignisse, Personen und Merkmale des Kirchenkampfes benennen - Ideologie und Unterdrückungsmechanismen der NS-Diktatur charakterisieren - das Problem von Anpassung und Widerstand unter dem NS-Regime und in totalitären Systemen allgemein diskutieren - ein Bewusstsein für das Problem eines kollektiven Schuldbekenntnisses, eines kollektiven Gewissens und eines kirchlichen Schuldbekenntnisses ohne Erteilung der Absolution vor dem Hintergrund protestantischer Lehren und Grundüberzeugungen haben - die Problematik von Widerstand bzw. Verweigerung auf die heutigen politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse übertragen - Argumente für und wider politisches Engagement seitens der Kirche vortragen - die Wirkungen von Meinungsäußerungen von Amtsträgern und Privatmenschen ein- und deren Folgen abschätzen - verschiedene Sichtweisen wahrnehmen, gegenüberstellen und als berechtigt anerkennen - einseitige Darstellungen von Ereignissen erkennen und kritisch reflektieren. Vorkenntnisse Den Schülerinnen und Schülern sollten innenund außenpolitische Belastungsfaktoren (politisch systemisch, wirtschaftlich, sozial und geographisch) der Weimarer Republik und die sich daraus ergebenden Bedingungen für Machtübertragung und „Gleichschaltung“ bekannt sein. Die Geschichte des Nationalsozialismus sollte ihnen zumindest in Grundzügen vertraut sein. |
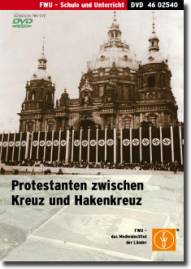
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen