|
|
|
Umschlagtext
Papst Benedikt XVI. hat als Höhepunkt des Paulus-Jahres die Öffnung des Apostelgrabes in der Basilika Sankt Paul vor den Mauern in Rom angeordnet. Michael Hesemann schildert die Geschichte diese Grabes sowie die sensationelle archäologische Untersuchung und nimmt den Leser mit auf eine weitere abenteuerliche Reise auf den Spuren des Völkerapostels, die von Rom nach Jerusalem, Griechenland und in die Türkei, nach Syrien, Israel, Zypern und Malta führt.
Rezension
Pünktlich zu dem von Papst Benedikt XVI. ausgerufenen Paulusjahr hat der katholische Journalist Michael Hesemann nach seinem bekannten Petrus-Buch nun auch ein populärwissenschaftliches Werk zu dem Apostel Paulus vorgelegt. Dabei handelt es sich um so etwas wie eine Nacherzählung der biblischen Apostelgeschichte (bzw. daraus der Kapitel 9-28), die bereichert ist durch Berichte über Hesemanns Besuche an historischen Wirkstätten des Apostels Paulus bzw. archäologischen Ausgrabungsarealen. Grundlegend für dieses Werk ist die methodische Entscheidung des Autors, bei der Erforschung der Person des Paulus der Archäologie einen Vorrang vor dem historisch-kritischen Zugang zu gewähren (vgl. Seite 14), die jedoch in seinem Buch dazu führt, dass die Quellenwerte der biblischen Schriften nicht immer angemessen berücksichtigt werden (vgl. nur S. 37).
Es ist Hesemann gelungen, Informationen über den zeitgeschichtlichen Hintergrund des Apostels Paulus (beispielsweise zu Strömungen im damaligen Judentum, zu antiken Reisebedingungen, zu geographischen Gegebenheiten, zu den römischen Rechtsvorschriften oder zu philosophischen Richtungen des Hellenismus) in gut lesbarer Sprache zu vermitteln. Leider verzichtet Hesemann vielfach auf Erkenntnisse historisch-kritischer Wissenschaft, für die ein weitgehender Konsens vorliegt, und besteht stattdessen auf einigen Außenseiterhypothesen (Frühabfassung der Apostelgeschichte als Verteidigungsschrift vor Gericht [S. 14 u. ö.], Echtheit der Deuteropaulinen [S. 101.174f.231], Abfassung des zweiten Evangeliums durch Johannes Markus, Frühdatierung des Galaterbriefes [S.99.122.125f, was viele chronologische und theologische Probleme mit sich bringt] und Spätdatierung der Gefangenschaftsbriefe [S. 231, was zumal beim Philipperbrief versorgungstechnische Fragen aufwirft]). Einige wenige Ungenauigkeiten im Text sind verzeihlich (wenn es heißt, Paulus werde von Apostelgeschichte 13 an von „Lukas“ forthin vor Barnabas genannt [vgl. S. 90]; wenn der Zweite Korintherbrief als versöhnliches Schreiben benannt ist [vgl. S. 166]; und wenn nach Hesemanns Chronologie für die Missionswirksamkeit des Paulus zwischen Aufbruch aus Antiochia und Ankunft in Korinth nur etwa ein Jahr bleibt [vgl. S. 126.136.250]). Schwerer ins Gewicht fallen da offensichtliche Fehler wie die Erwähnung von „sechs“ echten Paulinen (S. 13) oder verwirrende Angaben zu den Ausgrabungen und Namenszuweisungen im Zusammenhang der römischen Kirche Santa Prisca (S. 155), deren Patronin wohl eher eben nicht die biblische Priska ist. Eine mögliche Integration dieses spannend zu lesenden Buches in den Religionsunterricht (beispielsweise als Ganzschrift) wird unterstützt durch zahlreiche veranschaulichende Farbabbildungen. Andererseits verwendet der Autor leider in seinem Text, der nur wenige Druckfehler enthält, offensichtlich die alte Rechtschreibung, ohne dies jedoch ausnahmslos durchzuhalten (vgl. S. 48). Als erbauliche Paulus-Biographie, basierend auf biblischen Darstellungen – insbesondere derjenigen der Apostelgeschichte – und einigen katholischen Legenden (vgl. nur S. 57.95.223), kann dieses Buch auch im Unterricht seine Dienste leisten, weil Hesemann im Verlauf des Durchgangs durch die Biographie historische Stätten des Glaubens vorstellt, an denen die Zeit des Apostels oder doch zumindest die Wirkungsgeschichte des Christentums lebendig werden kann. Zum Inhalt: Das erste, sehr spannend geschriebene Kapitel (S. 15-31) des Buches beschreibt die Geschichte der Basilika „San Paolo fuori le mura“ in Rom und zumal die Entdeckung eines Marmorsarkophags unter dem dortigen Hauptaltar im Jahre 2006 – dem vermuteten Paulussarg. Nach diesem Hinführungskapitel orientiert sich der weitere Aufbau des Buches an der Abfolge der paulinischen Chronologie, wie sie durch die biblische Apostelgeschichte vorgegeben ist. Hesemann gibt dann die lukanischen Erzählungen wieder und referiert daneben über entsprechende archäologische Ausgrabungen und Erkenntnisse. In Kapitel 2 (S. 32-44) geht es um Tarsus und die kulturelle Bedeutung der Stadt in der paulinischen Zeit. Darauf (S. 45-59) widmet sich Hesemann dem Jerusalemer Tempel heute und zu paulinischer Zeit sowie den vermeintlichen frühen Lebensstationen des Apostels (Schülerzeit unter Rabbi Gamaliel, Anwesenheit bei der Steinigung des Stephanus und Verfolgung der ersten Christen). Im vierten Kapitel (S. 60-75) geht es um das so genannte Damaskus-Erlebnis, das Hesemann hier eher im Sinne einer Bekehrung – gemäß der lukanischen Darstellung – anstelle einer Berufung – wie im paulinischen Eigenbericht – präsentiert (vgl. S. 62f, doch vgl. S. 68), ferner um die Flucht des Paulus aus Damaskus, für deren Zeitpunkt Hesemann eine Datierungshypothese auf das Jahr 37 vorschlägt, und den darauf folgenden Jerusalembesuch des Apostels. Für die archäologische Perspektive bringt Hesemann in diesem Kapitel die ausgegrabenen Fundamente einer christlichen Kirche des 5. Jhs. in Damaskus zur Sprache sowie die vermeintlich antike Markuskirche in Jerusalem. Im fünften Kapitel (S. 76-84) stellt Hesemann Kultur und Religion in Antiochia während der römischen Zeit vor und behandelt die in Apostelgeschichte 11,30 erwähnte Reise des Paulus nach Jerusalem anlässlich einer Kollektenüberbringung. Das sechste Kapitel (S. 85-97) behandelt die Beschwernisse antiker Schiffsreisen sowie aufgefundene Inschriften zu dem zypriotischen Statthalter Sergius Paulus. Entsprechend wird in diesem Kapitel die so genannte erste Missionsreise des Paulus, genauer: der Aufenthalt in Zypern, nacherzählt. Entsprechend fährt Hesemann im siebten Kapitel (S. 98-114) mit der Darstellung des Aufenthalts in Südgalatien fort und gibt dabei Inhalte der romanhaften Thekla-Legende als zumindest historisch möglich wieder. Aus archäologischer Sicht geht es in diesem Kapitel um das antike Reisen auf Römischen Straßen und um den römischen Straßenbau sowie um die Ausgrabungen des römischen Antiochia ad Pisidiam. Das theologisch so wichtige Zusammentreffen der frühchristlichen Apostel in Jerusalem anlässlich der Heidenchristenproblematik – Hesemann verwendet dafür den anachronistischen Begriff des Apostelkonzils – und seine Nachwirkungen dominiert das achte Kapitel (S. 115-127). Als archäologische Spur des Paulus kommt Hesemann dabei auf Ausgrabungen im Essenerviertel Jerusalems zu sprechen. Im neunten Kapitel (S. 128-144) beschreibt Hesemann die größtenteils aus nachpaulinischer Zeit stammenden Ruinen von Philippi, darunter u. a. eine christliche Basilika des 4. Jhs. sowie einen heute verwendeten Taufaltar der orthodoxen Kirche. Ferner widmet er sich dem Judenedikt und der Religionspolitik des Kaisers Claudius. Hinsichtlich der Lebenschronologie des Paulus geht es dementsprechend in diesem Kapitel um die Missionsereignisse in Philippi und Thessaloniki so wie sie sich nach Apostelgeschichte 16f darstellen. Dies findet seine Fortsetzung in dem darauf folgenden Kapitel (S. 145-153) über Athen. Hier referiert Hesemann zumal über die Geschichte der Stadt seit dem zweiten Jahrtausend v. Chr. sowie über Ausgrabungen der Athener Agora, dem lukanischen Schauplatz der Athener Missionsversuche des Paulus. Im elften Kapitel (S. 154-168) ist der paulinische Aufenthalt in Korinth gemäß Apostelgeschichte 18 wiedergegeben, darüber hinaus kommen einige der Probleme in der korinthischen Christengemeinde zur Sprache, wie sie aus dem 1. Korintherbrief zu erheben sind (Frage des Fleischgenusses, Parteiungen in der Gemeinde). Archäologisch widmet sich dieses Kapitel dem aufgefundenen Türfries einer jüdischen Synagoge aus dem 5. Jh. und einem Menora-Relief derselben Zeit, der Ausgrabung der Bema in Korinth und der Bedeutung Korinths in paulinischer Zeit sowie der bekannten Gallio-Inschrift. Die Publikationsgeschichte dieser Inschrift beschreibt Hesemann etwas ausführlicher, jedoch ein wenig reißerisch-übertrieben, wenn unerwähnt bleibt, dass die Inschrift bereits 45 Jahre vor dem von Hesemann genannten Veröffentlichungsjahr (vgl. S. 161) von Theologen ausgewertet und immerhin in Teilen veröffentlicht worden war. Das zwölfte Kapitel (S. 169-181) beschreibt dann die Ausgrabungen des antiken Ephesus (u. a. Agora, Tempel, Marmorstraße), ferner die archäologische Entdeckung eines in die Wand der ephesinischen „Paulusgrotte“ gemalten Porträt des Apostels aus dem 5. Jh., schließlich den berühmten Artemistempel von Ephesus. Demgemäß werden die Ereignisse während der Mission des Paulus gemäß Apostelgeschichte 19f wiedergegeben. Um die anschließende Verhaftung des Apostels in Jerusalem, seine Gefangenschaft in Cäsarea und den Prozessverlauf gemäß der lukanischen Darstellung geht es dann in Kapitel 13 (S. 182-195). Dazu passend beschreibt Hesemann das so genannte „Gefängnis Christi“ in Jerusalem, dessen Verwendung als Gefängnis von Archäologen als eher unwahrscheinlich betrachtet wird und das meist als Stallung der römischen Kavallerie gedeutet wird (vgl. S. 182, doch vgl. andererseits S. 188ff, wo Hesemann dennoch annimmt, dass Paulus dort einsaß). Ferner beschreibt Hesemann in diesem Kapitel den Herodes-Palast in Cäsarea und geht kurz auf einige Münzfunde ein, zum Beweis der Datierung des Statthalterwechsels von Antonius Felix auf Porcius Festus. Das Kapitel 14 (S. 196-205) enthält einige Ausführungen zum antiken Getreidetransport per Schiff sowie Beschreibungen des vermeintlichen Gefängnisses des Paulus auf Kreta während des Zwischenaufenthalts in Kaloi Limenes, auf das Hesemann durch Hinweise von Einheimischen gestoßen ist. In Kapitel 15 (S. 206-220) beschreibt Hesemann die Auffindung diverser antiker Schiffsanker vor der Küste Maltas, die Ausgrabungen von römischen Villen im Landesinneren sowie die so genannte Paulusgrotte, einem vermeintlichen Gefängnis aus der römischen Zeit. Dabei tritt der Autor leidenschaftlich für die These der Strandung des Paulus vor Malta im Gegenüber zu anderen Lokalisierungstheorien ein. Während in Kapitel 16 (S. 221-227) die Ereignisse von Apostelgeschichte 28, bereichert durch einige altkirchliche Legenden, nacherzählt werden, beschäftigt sich das darauf folgende Kapitel (S. 228-242) mit der Frage: Was geschah nach dem – abrupten – Ende der Apostelgeschichte? Hier spekuliert Hesemann auf der Basis sehr alter Handschriften und Legenden über einige Geschehnisse zum Ende des Lebens des Apostels: über dessen Wohnhaus, über den Ausgang des Prozesses vor dem kaiserlichen Gericht, über eine Mission in Spanien sowie in Kreta, über einen letzten Aufenthalt in Griechenland, über eine Gefangenschaft im Marmertinischen Kerker, über eine Begegnung mit Kaiser Nero und über den Martyriumsort. Den Abschluss des Buches bildet ein Nachwort (S. 243-246), in dem es um das äußere Erscheinungsbild des Apostels geht, das nach Vorgaben ikonographischer Darstellungen des 3.-5. Jhs. erstellt worden ist. Holger Zeigan, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Der Autor: Michael Hesemann, geboren 1964, ist ein international tätiger Autor, Historiker, Dokumentarfilmer und Fachjournalist für populärwissenschaftliche und kirchengeschichtliche Themen. Er studierte Geschichte, Kulturanthropologie/Volkskunde, Literaturwissenschaft und Journalistik an der Universität Göttingen und lebt heute in Düsseldorf und in Rom. Von ihm erschien im Sankt Ulrich Verlag bereits: „Die Dunkelmänner. Mythen, Lügen und Legenden um die Kirchengeschichte“ (2007). Inhaltsverzeichnis
Papst Benedikt XVI. zum Paulus-Jahr 2008/09
Einleitung I. Rom: Der Sarg des Völkerapostels II. Tarsus: Spuren im Schlamm III. Jerusalem: Die Steinigung IV. Damaskus: Licht vom Himmel V. Antiochia: Die ersten Christen VI. Zypern: Paulus trifft Paulus VII. Mission in Galatien VIII. Jerusalem: Geburtsstunde einer Weltreligion IX. Philippi: Wie das Christentum nach Europa kam X. Athen: Die Geburt einer Zivilisation XI. Korinth: Botschafter der Liebe XII. Ephesus: In der Höhle des Löwen XIII. Cäsarea: Der Prozess XIV. Kreta: Die Odyssee XV. Malta: Schiffbruch! XVI. Italien: Der Paulus-Pilgerweg XVII. Rom: Das Ende einer Reise Nachwort: Wie sah Paulus aus? Dank/Bildquellen Zeittafel Quellen und Literatur |
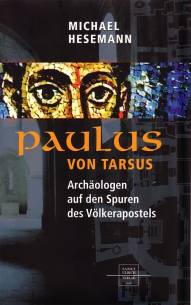
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen