|
|
|
Verlagsinfo
Band 1 1 Pädagogik und Psychologie als Wissenschaft 2 Wahrnehmung und Verhalten 3 Psychische Funktionen und Fähigkeiten 4 Lern- und Studiertechniken 5 Psychische Kräfte 6 Grundlagen der Erziehung 7 Erzieherverhalten und Erziehungsziele 8 Lernen im Erziehungsprozess: Die Konditionierungstheorien 9 Lernen im Erziehungsprozess: Das Lernen am Modell 10 Entwicklung und Erziehung aus psychoanalytischer Sicht Stichwortverzeichnis Band 2 11 Grundlagen der Entwicklungspsychologie 12 Entwicklung auf verschiedenen Altersstufen 13 Soziale Interaktion und Kommunikation 14 Theorien der Kommunikation 15 Soziale Einstellung und Einstellungsänderung 16 Theorie der Persönlichkeit: Die personenzentrierte Theorie 17 Aufgaben sozialpädagogischer Arbeit 18 Handlungsformen sozialpädagogischer Arbeit 19 Die ökologische soziale Arbeit 20 Erziehung unter besonderen Bedingungen 21 Die Anfertigung von schriftlichen Prüfungsarbeiten Stichwortverzeichnis Inhaltsverzeichnis
Einführung in das Lehrbuch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
11 Grundlagen der Entwicklungspsychologie . . . . . . . . . . . . . . . 11 11.1 Der Gegenstand der Entwicklungspsychologie . . . . . . . . . . . . . 12 11.1.1 Der Begriff Entwicklung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 11.1.2 Merkmale der Entwicklung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 11.2 Die Bedingungen der Entwicklung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 11.2.1 Die genetischen Faktoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 11.2.2 Die Umwelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 11.2.3 Die Selbststeuerung des Menschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 11.2.4 Die Wechselwirkungen von Entwicklungsbedingungen . . . . . . . 16 11.3 Die Theorie der kognitiven Entwicklung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 11.3.1 Grundlagen der Theorie der kognitiven Entwicklung . . . . . . . . . 19 11.3.2 Die Bedeutung der Theorie Piagets für die Erziehung . . . . . . . . 23 Materialien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Aufgaben und Anregungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 12 Entwicklung auf verschiedenen Altersstufen . . . . . . . . . . . . . 34 35 12.1 Die Entwicklung der Motorik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 12.1.1 Der Verlauf der Entwicklung der Motorik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 12.1.2 Die Entwicklung der Motorik unter dem Gesichtspunkt der Differenzierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 12.1.3 Die Entwicklung der Motorik unter dem Gesichtspunkt der Integration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 12.2 Die Entwicklung des Denkens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 12.2.1 Die Stufen des Denkens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 12.2.2 Die Entwicklung des Denkens unter dem Gesichtspunkt der Differenzierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 12.2.3 Die Entwicklung des Denkens unter dem Gesichtspunkt der Integration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 12.3 Die Entwicklung der Emotionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 12.3.1 Der Verlauf der Entwicklung der Emotionen . . . . . . . . . . . . . . . . 48 12.3.2 Die Entwicklung der Emotionen unter dem Gesichtspunkt der Differenzierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 12.3.3 Die Entwicklung der Emotionen unter dem Gesichtspunkt der Integration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Materialien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Aufgaben und Anregungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 13 Soziale Interaktion und Kommunikation . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 13.1 Grundlagen sozialer Interaktion und Kommunikation . . . . . . . . . 62 13.1.1 Die Begriffe soziale Interaktion und Kommunikation . . . . . . . . . 62 13.1.2 Soziale Kommunikation als ein Regelkreis . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 13.1.3 Die Bedeutung sozialer Kommunikation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 13.2 Störungen in der Kommunikation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 13.2.1 Erfolgreiche und gestörte Kommunikation . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 13.2.2 Die Art von Botschaften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 13.3 Erfolgreiches Miteinander-Kommunizieren . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 13.3.1 Vorbeugung und Behebung von Kommunikationsstörungen . . . 70 13.3.2 Möglichkeiten erfolgreicher Kommunikation . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Materialien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Aufgaben und Anregungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 14 Theorien der Kommunikation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 14.1 Die Grundsätze der Kommunikation nach Paul Watzlawick und seinen Mitarbeitern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 14.1.1 Soziale Kommunikation und Verhalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 14.1.2 Die Informationsebenen einer sozialen Kommunikation . . . . . . . 93 14.1.3 Soziale Kommunikation als ein System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 14.1.4 Die verschiedenen Arten einer Mitteilung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 14.1.5 Die Beziehungsformen in einer sozialen Kommunikation . . . . . . 99 14.2 Das Kommunikationsmodell nach Friedemann Schulz von Thun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 14.2.1 Das Modell der zwischenmenschlichen Kommunikation . . . . . . 102 14.2.2 Die Interpretation einer Nachricht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 14.2.3 Erfolgreiche und gestörte Kommunikation . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 14.2.4 Der einseitige Empfang einer Nachricht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 14.2.5 Probleme der zwischenmenschlichen Kommunikation . . . . . . . . 111 Materialien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Aufgaben und Anregungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 15 Soziale Einstellung und Einstellungsänderung . . . . . . . . . . . 126 15.1 Merkmale von sozialen Einstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 15.1.1 Der Begriff „soziale Einstellung“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 15.1.2 Der Aufbau von sozialen Einstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 15.1.3 Das Gefüge von sozialen Einstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 15.1.4 Die Bedeutsamkeit von sozialen Einstellungen . . . . . . . . . . . . . . 130 15.2 Soziale Einstellungen und ihre Funktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 15.2.1 Funktionen von sozialen Einstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 15.2.2 Einstellung und Vorurteil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 15.3 Der Erwerb von sozialen Einstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 15.3.1 Die Erklärung des Einstellungserwerbs mit Hilfe der Konditionierungstheorien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 15.3.2 Die Erklärung des Einstellungserwerbs mit Hilfe der sozial-kognitiven Theorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 15.4 Die Änderung von sozialen Einstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 15.4.1 Einstellungsänderung auf der Grundlage von Erkenntnissen über Kommunikation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 15.4.2 Die Theorie der kognitiven Dissonanz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 15.4.3 Einstellungsänderung auf der Grundlage der Theorie der kognitiven Dissonanz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Materialien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Aufgaben und Anregungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 16 Theorie der Persönlichkeit : Die personenzentrierte Theorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 16.1 Persönlichkeit und Persönlichkeitstheorien . . . . . . . . . . . . . . . . 162 16.1.1 Der Begriff Persönlichkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 16.1.2 Die Vielzahl von Persönlichkeitstheorien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 16.2 Die personenzentrierte Theorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 16.2.1 Carl Rogers: Seine Person und sein Menschenbild . . . . . . . . . . 164 16.2.2 Die Selbstaktualisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 16.2.3 Das Selbstkonzept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 16.2.4 Die Entstehung des Selbstkonzeptes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 16.2.5 Aktuelle Erfahrungen und Selbstkonzept . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 16.2.6 Die Bedeutung des Selbstkonzeptes im Alltag . . . . . . . . . . . . . . 173 16.3 Die Bedeutung der personenzentrierten Theorie für die Erziehung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 16.3.1 Wertschätzung und seelische Entwicklung . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 16.3.2 Förderliche Haltungen des Erziehers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Materialien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Aufgaben und Anregungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 17 Aufgaben sozialpädagogischer Arbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 17.1 Grundlagen sozialer Arbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 17.1.1 Das Wesen der Sozialpädagogik/-arbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 17.1.2 Die Sozialpädagogik als Theorie und Praxis der Jugendhilfe . . . 196 17.2 Der Kindergarten als familienergänzende Einrichtung . . . . . . . . 197 17.2.1 Aufgaben des Kindergartens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 17.2.2 Die Organisation des Kindergartens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 17.2.3 Chancen und Probleme der erzieherischen Arbeit im Kindergarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 17.3 Die Erziehungsberatung als Einrichtung der Jugendhilfe . . . . . . 205 17.3.1 Ziele der Erziehungsberatung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 17.3.2 Die Arbeitsweise einer Erziehungsberatungstelle . . . . . . . . . . . . 208 17.3.3 Aufgaben einer Erziehungsberatungstelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 17.3.4 Chancen und Probleme der Arbeit einer Erziehungsberatungsstelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Materialien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Aufgaben und Anregungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 18 Handlungsformen sozialpädagogischer Arbeit . . . . . . . . . . . 220 18.1 Methoden sozialer Arbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 18.1.1 Die soziale Einzelhilfe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 18.1.2 Die soziale Gruppenarbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 18.1.3 Die soziale Gemeinwesenarbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 18.2 Handlungskonzepte der Sozialpädagogik . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 18.2.1 Das verhaltensorientierte Handlungskonzept . . . . . . . . . . . . . . . 226 18.2.2 Das klientenorientierte Beratungskonzept . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 Materialien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 Aufgaben und Anregungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 19 Die ökologische soziale Arbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 19.1 Der ökologische Ansatz in der Sozialpädagogik/-arbeit . . . . . . . 258 19.1.1 Grundlegende Annahmen eines ökologischen Modells: Das „Life Model“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 19.1.2 Die ökologische Sichtweise der Sozialpädagogik/-arbeit . . . . . . 264 19.1.3 Möglichkeiten und Grenzen ökologisch orientierter Sozialarbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 19.2 Das Unterstützungsmanagement als Beispiel für ökologische Sozialarbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 19.2.1 Aufgaben des Unterstützungsmanagements . . . . . . . . . . . . . . . 269 19.2.2 Die Vorgehensweise des Unterstützungsmanagements . . . . . . . 272 Materialien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 Aufgaben und Anregungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 20 Erziehung unter besonderen Bedingungen . . . . . . . . . . . . . . 288 20.1 Erschwerungen in der Entwicklung des Menschen . . . . . . . . . . 289 20.1.1 Der Begriff Beeinträchtigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 20.1.2 Behinderung als schwerste Form der Beeinträchtigung . . . . . . . 290 20.1.3 Störungen als weniger schwere Form der Beeinträchtigung . . . 291 20.1.4 Gefährdungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 20.2 Beeinträchtigungen als Abweichungen von der Norm . . . . . . . . 293 20.2.1 Normales und von der Norm abweichendes Verhalten . . . . . . . . 293 20.2.2 Die Problematik des Beeinträchtigungsbegriffs . . . . . . . . . . . . . 294 20.3 Verhaltensstörung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 20.3.1 Der Begriff Verhaltensstörung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 20.3.2 Ursachen von Verhaltensstörungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 20.4 Die Erklärung der Entstehung einer Verhaltensstörung . . . . . . . . 298 20.4.1 Die Erklärung von Verhaltensstörungen aus psychoanalytischer Sicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 20.4.2 Die Erklärung von Verhaltensstörungen aus der Sicht der Konditionierungstheorien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 20.4.3 Die Erklärung von Verhaltensstörungen aus der Sicht der sozial-kognitiven Theorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 Materialien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 Aufgaben und Anregungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 21 Die Anfertigung von schriftlichen Prüfungsarbeiten . . . . . . . 316 21.1 Der Aufbau einer Prüfungsaufgabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 21.2 Leistungsbereiche einer Prüfungsarbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 21.2.1 Die Beschreibung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 21.2.2 Die Erklärung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 21.2.3 Die Anwendung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 21.3 Leistungskriterien einer Prüfungsarbeit – „Worauf es ankommt“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 21.4 Anfertigung einer Prüfungsarbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 21.4.1 Ausführungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 21.4.2 Einleitung und Schlussgedanke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 21.4.3 „Checkliste“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 21.5 Prüfungsaufgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 Verwendete Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 Sachwortverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 Bildquellenverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 |
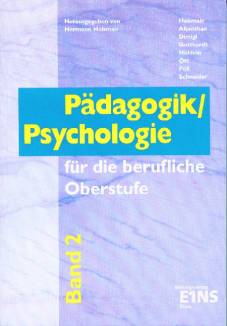
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen