|
|
|
Umschlagtext
Die "Metzler Literatur Chronik" reicht vom frühen Mittelalter bis zum Jahr 1995. Die Werkbeschreibungen geben Hinweise auf den literaturgeschichtlichen Stellenwert, nennen Quellen und Entstehungsumstände, Inhalte, formale Besonderheiten und Daten der Wirkungsgeschichte. Mit dem chronologischen Konzept ergibt sich eine zusammenfassende Sicht auf die Vielfalt der deutschsprachigen Kultur.
Rezension
Wohl am ehesten in Verbindung und als eigenständige Ergänzung einer Literaturgeschichte kann die Literatur-Chronik hilfreich sein. Die konsequent chronologische Vorgehensweise, die auf jede Epocheneinteilung verzichtet, ist ebenso eigenwillig wie gelegentlich erhellend. Jedenfalls kann deutlich werden, wie Heterogenes gleichzeitig sein kann - und doch: Gleichzeitiges auch eine gewisse Homogenität ausstrahlen kann. Darüberhinaus ein hilfreiches Nachschlagewerk und durch das ausführliche Personen- und Werkregister abermals erschließbar.
Thomas Bernhard für lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Autoreninformation: Volker Meid, geb. 1940; Studium der Germanistik, Politik und Volkskunde; 1970-1982 Professor für deutsche Literatur an der University of Massachusetts, Amherst (USA); seit 1982 freier wissenschaftlicher Autor; zahlreiche Veröffentlichungen zur Literatur vom Barock bis zur Moderne. Bei J.B. Metzler sind erschienen: Der deutsche Barockroman (1974), Barocklyrik (1986). Inhaltsverzeichnis
Vorwort V
Werke deutschsprachiger Autoren vom 8. Jahrhundert bis 1995 1-742 Literaturhinweise 743 Personen- und Werkregister von Helmut G. Hermann 747 Vorwort: Die Metzler Literatur Chronik beschreibt in strikter Chronologie Werke der deutschen bzw. deutschsprachigen Literatur von der Zeit Karls des Großen bis zum Jahr 1980, einem - vorläufigen - Schlußpunkt, der schon eine gewisse historische Perspektive ermöglicht. Bei der Konzeption der Chronik wurde von vornherein auf eine Gliederung nach Epochen verzichtet. Sie hätte sich, abgesehen von der Problematik mancher Epochenbegriffe und den damit verbundenen Schwierigkeiten der zeitlichen Abgrenzung, allein wegen der zahlreichen Überschneidungen nicht mit dem Prinzip einer konsequent chronologischen Ordnung vereinbaren lassen. Dessen Leistung besteht gerade darin, die Vielfältigkeit und Gegensätzlichkeit, ja Widersprüchlichkeit der literaturgeschichtlichen Vorgänge, das Nebeneinander der verschiedenen Strömungen und Generationen und die >Ungleichzeitigkeit< des Gleichzeitigen sichtbar zu machen, also eine Sicht der Literaturgeschichte zu bieten, die die Perspektive der literaturgeschichtlichen Erzählung mit ihrer auf Zusammenhänge und Entwicklungslinien gerichteten Darstellungsintention auf erhellende Weise ergänzt. Das bedeutet jedoch nicht, daß die Literatur Chronik nicht auf ihre Weise eine Charakteristik der literarhistorischen Epochen und Strömungen enthielte, übergreifende literarhistorische Zusammenhänge oder gattungs- und formgeschichtliche Traditionen einzubeziehen suchte: Dies geschieht an den einzelnen Werken, an signifikanten Beispielen für die jeweilige Fragestellung. Die Chronologie der Werke orientiert sich am Jahr der ersten Publikation, sei es durch Aufführung, Vorlesung oder Druck. Nur in wenigen Fällen wurden Ausnahmen gemacht, etwa wenn Entstehungs- und Publikationsdatum extrem weit auseinanderliegen und der späteren Veröffentlichung selbst keine literarhistorische Aussagekraft zukommt (so wurde Herders Journal meiner Reise im Jahr 1769, das einen entscheidenden Moment in Herders Biographie und die zum Sturm und Drang hinführende Aufbruchsstimmung dieser Jahre festhält, erst 1846 gedruckt). Bestimmend für die Aufnahme in die Literatur Chronik war nicht allein der ästhetische Rang der Texte; neben dem traditionellen literarhistorischen Kanon (>Höhenkamm<), zu dem selbstverständlich auch Werke in lateinischer Sprache gehören, werden Texte berücksichtigt, die auf andere Weise literarhistorisch bedeutsam sind, sei es - beispielsweise - in ideologiekritischer oder rezeptionsgeschichtlicher Hinsicht. Dabei finden große Übersetzerleistungen ebenso Berücksichtigung wie - exemplarisch - Werke der Unterhaltungsliteratur. Zudem wurde im Einklang mit einem erweiterten Literaturbegriff versucht, den Bereich der nichtfiktiven Literatur wenigstens an ausgewählten Beispielen zu dokumentieren. Allerdings war dies, und hier zeigen sich die Grenzen des Unternehmens, angesichts der ständig wachsenden Produktion für die neuere Literatur immer weniger möglich. Die einzelnen Artikel sind nicht schematisch angelegt; sie enthalten, im Einzelfall jeweils verschieden gewichtet, Informationen über Entstehung, Form, Inhalt, literarhistorischen Kontext, Deutungsmöglichkeiten und Wirkungsgeschichte. Ziel war dabei nicht nur die schnelle, sachliche und zuverlässige Information auf der Basis des gegenwärtigen Forschungsstands; über ihre Funktion als Nachschlagewerk hinaus möchte die Literatur Chronik durch ihren Darstellungsstil zum Lesen und Weiterlesen anregen und so dem Benutzer und Leser ein - hofft der Verfasser - facettenreiches Bild der Literatur und Kultur im deutschen Sprachraum vermitteln. Eine wesentliche Hilfe dabei bietet das kombinierte Personen- und Werkregister Helmut G. Hermanns (Amherst/USA), das die Vielfalt des Buches erst wirklich erschließt (und auch die Lebensdaten der deutschsprachigen Autoren nennt). Dem Registermacher habe ich überdies für mannigfache Hinweise und Korrekturen zu danken. Entsprechender Dank gebührt Petra Wägenbaur, die das Buch als Lektorin betreute, Eva Eckstein, die beim Korrekturlesen half, und Bernd Lutz, ohne dessen Anregungen und Geduld die Literatur Chronik nie geschrieben bzw. beendet worden wäre. Volker Meid Pruzilly, im Juli 1993 Leseprobe: 1995 Günter Grass Ein weites Feld Im Mittelpunkt dieses Romans stehen zwei Figuren, die zugleich zwei Vorgängern nachleben, einem fiktiven und einem realen, und die mit ihren Erinnerungen die deutsche Geschichte des 19. und 20. Jh.s bis zur Wendezeit 1989/90 kritisch vergegenwärtigen. Die beiden alten Männer, »lang und schmal neben breit und kurz«, gehen in den letzten Monaten des Bestehens der DDR kreuz und quer durch Berlin, fahren durch die DDR und kommen an den Orten der Gegenwart auf die Vergangenheit zu sprechen. Das erinnert nicht zufällig an die Methode von Fonta-nes Wanderungen durch die Mark Brandenburg (1861-81). Fontanes alter ego, der einstige Vor-tragsreisende in Sachen Fontäne Theo Wuttke, genannt Fonty, ist die eine Hälfte der »miteinander verwachsenen Doppelgestalt«, genau 100 Jahre später am selben Ort geboren wie sein Urbild und diesem auch zum Verwechseln ähnlich. Die andere Hälfte der an Komikerpaare, aber auch an Don Quijote und Sancho Pansa erinnernden Konstellation ist Hoftaller, Agent, Geheim-dienstmann und Beschützer Fontys, der jedem System dient(e) und dabei eine andere literarische Gestalt wieder aufleben läßt: Tallhover, den Helden des gleichnamigen Romans von Hans Joachim Schädlich (1986) mit seiner langen Spitzel- und Geheimpolizeigeschichte von der Met-ternich-Zeit bis zur DDR-Diktatur. Der Erzähler dieses Vergangenheit und Gegenwart ineinanderfügenden Romans (»Vergegen-kunft«) versteckt sich hinter einem »Wir vom [Fontäne-]Archiv«, und was dort »Blatt um Blatt« entsteht, ist ein Musterbeispiel manieristischer Intertextualität, eine Montage und Anverwand-lung von literarischen und historischen Zitaten, die wiederum transparent gemacht werden auf die Gegenwart. Fontanes Leben und Werk, Herkunft, persönliche Beziehungen, Reisen, Ansichten - unerschöpfliche Quelle für Zitate sind die Briefe - dienen so in artistischer und durchaus auch humoristischer Weise als Folie, vor der sich die neue und ebenso falsche Gründerzeit abhebt. Daß dabei die Kritik an der Art der Wiedervereinigung und insbesondere an der Rolle der Treuhand so deutlich ausfällt (und zudem genau mit den Ansichten des politischen Essayisten G. übereinstimmt), erklärt die vielfach politisch motivierte Polemik gegen den Roman. Seine Protagonisten jedenfalls sehen keine Hoffnung mehr; der »Tagundnachtschatten« Hoftaller verschwindet nach Kuba oder Miami (»Auf welcher Seite wird er wohl tätig werden, in Havanna oder von Miami aus?«), Fonty in die Cevennen, die Landschaft der hugenottischen Vorfahren Fontanes. Die mehrfache Spiegeltechnik stößt freilich auf gewisse Schwierigkeiten. Zum einen ist G. gezwungen, da Fontäne wohl kaum noch gegenwärtig ist, die Voraussetzungen für den modernen Fonty durch entsprechende Materialpräsentationen ausdrücklich zu schaffen und gleichsam Literaturunterricht zu erteilen, zu anderen geht das Überblenden von Fontaneschem Lebenslauf und dem seines Doppelgängers, von 19. und 20. Jh. nicht ohne Verzerrungen und Verharmlosungen ab. Daß sich Fontanezitate, Fontanemimikry und G.scher Personalstil kaum unterscheidbar durchdringen, gehört zum Konzept des Romans und seiner Montagetechnik. |
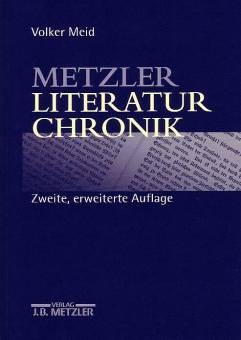
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen