|
|
|
Umschlagtext
Rund 600 Autorinnen und Autoren im Porträt. Das Lexikon informiert über die wichtigsten deutschsprachigen Autorenpersönlichkeiten und ihre Werke vom Mittelalter bis in die unmittelbare Gegenwart. Die essayistisch geschriebenen Artikel beleuchten Leben und Gesamtwerk im Kontext der jeweiligen Epoche und liefern gleichzeitig alle notwendigen Daten und Fakten sowie die wichtigste Sekundärliteratur. Die vierte Auflage wurde aktualisiert und um ca. 20 Artikel vor allem zu Schriftstellern der Gegenwartsliteratur erweitert.
Rezension
In 4., aktualisierter und erweiterter Auflage bietet dieses Standardwerk ca. 20 neue Artikel vor allem zu Schriftstellern der Gegenwartsliteratur wie Wilhelm Genazino, Daniel Kehlmann, Martin Mosebach, Bernhard Schlink, Kathrin Schmidt, Ingo Schulze u. a. Außerdem wurde es aktualisiert um Literaturangaben, Literaturpreise etc. Dieses Standardwerk sollte neben jeder Deutschen Literaturgeschichte seinen Platz finden. Konnte man dem Werk bis zur 2. Aufl. 1994 noch eine in gewisser Weise fehlende Aktualität unterstellen, weil zahlreiche aktuelle zeitgenössische Autoren fehlten, so ist dieser Mangel schon seit der 3., um ca. 100 Autorenportäts erweiterten Auflage überwunden - und jetzt erst recht! Die Essays geben tiefe Einblicke in Leben, Werk und Wirken der wichtigsten deutschsprachigen Autoren - ausführlich, anschaulich, verständlich.
Thomas Bernhard für lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Neue Einträge zu Wilhelm Genazino, Daniel Kehlmann, Martin Mosebach, Bernhard Schlink, Kathrin Schmidt, Ingo Schulze u. a. Aktualisiert um Literaturangaben, Literaturpreise etc. Bernd Lutz leitete einen kulturwissenschaftlichen Fachverlag; bei J.B. Metzler ist u.a. erschienen „Metzler Philosophen Lexikon“, 3. Auflage 2003 (Hg); „Metzler Goethe Lexikon“, 1999 (Mitherausgeber); Benedikt Jeßing ist Professor für Neuere deutsche Literaturwissenschaft an der Ruhr-Universität Bochum; bei J.B. Metzler ist erschienen: „Johann Wolfgang Goethe“, Sammlung Metzler 288, 1995; „Metzler Goethe Lexikon“, 1999 (Mitherausgeber); „Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft“, 2003 (Mitautor). Pressestimmen Dank des Metzler Verlages bekommen Wissenshungrige hier die Möglichkeit, sich einen ersten Einblick über die deutsche Literatur und deren Schöpfer zu verschaffen - und weckt darüber hinaus die Lust weiterzugehen. Eben kein Durchschnittswerk, sondern ein Buch der Superlative... www.literaturmarkt.info Das "Metzler Lexikon deutschsprachiger Dichter und Schriftsteller vom Mittelalter bis zur Gegenwart" liegt nun in der 4., aktualisierten und erweiterten Auflage vor. Gibt es einen größeren Beweis für ein gelungenes und anspruchsvolles Nachschlagewerk? www.literaturkritik.de Gleichwohl bietet dieses Lexikon mit rund 600 Porträts Gelegenheit, sich einen Überblick über gut 1000 Jahre deutschsprachiger Literatur zu verschaffen. www.textem.de Ergänzt um einige Autoren und aktualisiert in den Beiträgen und v.a. bibliografischen Angaben bleibt es damit ein Standardwerk für alle, die am Leben und Werk deutschsprachiger Autoren interessiert sind. Deutschmagazin Inhaltsverzeichnis
Vorwort V
Autoren A–Z 1–861 Weiterführende Bibliographie 862 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 864 Artikelregister 868 Leseprobe: Abraham a Sancta Clara Geb. 2. 7. 1644 in Kreenheinstetten bei Meßkirch; gest. 1. 12. 1709 in Wien Johann Wolfgang Goethe behielt recht, als er Friedrich Schiller einen Band mit Schriften von A. zusandte und dazu bemerkte, sie würden ihn »gewiß gleich zu der Kapuzinerpredigt begeistern« (5. 10. 1798). Denn Schiller fand hier das Material, das er brauchte, um den Auftritt des Kapuziners in Wallensteins Lager mit Leben zu erfüllen, und er übernahm charakteristische Merkmale von A.s volkstümlichem Predigtstil, die Wortspiele, die Reihungen, die lateinisch-deutsche Mischsprache, die Verbindung von drastischem Ton und höherem Anliegen. So setzte er »Pater Abraham«, diesem »prächtige[n] Original«, mit all seiner »Tollheit « und »Gescheidigkeit« ein Denkmal, das nachhaltiger wirkte als das wesentlich komplexere Werk des Predigers. A., eigentlich Hans Ulrich Megerle, Gastwirtssohn, war nach dem Besuch der Lateinschule in Meßkirch, des Jesuitengymnasiums in Ingolstadt und des Benediktinergymnasiums in Salzburg 1662 in den Orden der Reformierten Augustiner- Barfüßer eingetreten. Das Noviziat absolvierte er im Kloster Mariabrunn bei Wien, und von da an stand Wien im Mittelpunkt seines Wirkens, wenn er auch gelegentlich Aufgaben an anderen Orten wahrnehmen musste (so war er von 1670 bis 1672 Wallfahrtsprediger im Kloster Taxa bei Augsburg und von 1686 bis 1689 Prior im Grazer Kloster seines Ordens). Nach der Priesterweihe (1668) und seiner Ernennung zum Kaiserlichen Prediger (1677) – Kaiser Ferdinand II. hatte dem Orden die Seelsorge an der kaiserlichen Hofkirche übertragen – machte er »Karriere« in seinem Orden, dem er in hohen seelsorgerischen und administrativen Funktionen diente, zeitweise auch als Vorsteher der deutsch-böhmischen Ordensprovinz. Vor allem jedoch verstand er sich als Prediger, und sein Werk ist untrennbar mit dieser Funktion verbunden. Das gilt auch für die Schriften, die formal eigene Wege gehen und mit den üblichen literaturwissenschaftlichen Gattungskriterien nur schwer zu erfassen sind. Drucke seiner Predigten erschienen von 1673 an, als er »Vor der gesambten Kayserl. Hoffstatt« eine Lobpredigt auf Markgraf Leopold von Österreich hielt (Astriacus Austriacus Himmelreichischer Oesterreicher). Sein Publikum erreichte und faszinierte er durch eine unwiderstehliche Verbindung von Ernst und Komik, von tiefer Frömmigkeit, gezielter Satire und »barocker« Sprachgewalt; dem intendierten moralischen und geistlichen Nutzen dienten auch die zahlreichen Zitate kirchlicher und antiker Autoren, die Gedichteinlagen und die eingeflochtenen exemplarischen Geschichten und Wundererzählungen (»Predigtmärlein«). Seine bekanntesten Schriften entstanden aus aktuellem Anlass, der Pestepidemie von 1679 und der Belagerung Wiens durch die Türken 1683: Mercks Wienn (1680), eine Verbindung von Pestbericht, Predigt und Totentanz (»Es sey gleich morgen oder heut / Sterben müssen alle Leuth«); Lösch Wienn (1680), eine Aufforderung an die Wiener, die Seelen ihrer durch die Pest hingerafften Angehörigen durch Gebet und Opfer aus dem Fegefeuer zu erlösen; und Auff / auff Ihr Christen, ein Aufruf zum Kampf wider den Türckischen Bluet-Egel (1683). Darüber hinaus belebte A. die traditionelle Ständesatire und die Narrenliteratur (z.B. Wunderlicher Traum Von einem grossen Narren-Nest, 1703), pflegte den Marienkult und sorgte für erbauliche Unterweisung mit Hilfe von Ars moriendi (Sterbekunst) und moralisierender Emblematik (Huy! und Pfuy! Der Welt, 1707). Seine Erfahrungen als Prediger flossen in die großen Handbücher, Exempel- und Predigtsammlungen ein: Reimb dich Oder Ich liß dich (1684), Grammatica Religiosa (1691) und als herausragendstes Beispiel dieser Werkgruppe Judas Der Ertz-Schelm (4 Teile, 1686–95) – kein epischer Versuch, sondern eine Art Predigthandbuch, das die Lebensgeschichte des Judas als formalen Rahmen benutzt und jede Station, jedes Laster zum Anlass einer warnenden Predigt nimmt, die es nicht verfehlt, die »sittliche Lehrs-Puncten« auf anschauliche Weise zu illustrieren. Der Beifall, den man seit Klassik und Romantik A.s »Witz für Gestalten und Wörter, seinem humoristischen Dramatisieren« spendet (Jean Paul), darf freilich nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sich für den Prediger nur um Mittel zum Zweck handelt, um Elemente einer im Dienst der »allzeit florierenden / regierenden / victorisirenden Catholischen Kirchen« zielstrebig eingesetzten Überredungskunst. Literatur: Eybl, Franz M.: Abraham a Sancta Clara. Tübingen 1992; Abraham a Sancta Clara. Ausstellungskatalog. Karlsruhe 1982. Volker Meid Achternbusch, Herbert Geb. 23. 11. 1938 in München Was an A. auffällt, ist seine Verwandtschaft mit Eulenspiegel. In seinem Theaterstück Gust (1984) bittet die sterbende Ehefrau Gust um ein »süßes Wort«, und Gust, der Nebenerwerbsimker, stammelt vor sich hin: »Honig«. Das war auch die Antwort Eulenspiegels auf dieselbe Bitte der an seinem Sterbelager sitzenden Mutter. Es sind aber nun nicht nur die Kalauer, von denen Eulenspiegel und Achternbusch ausgiebig Gebrauch machen, sondern es verbindet sie etwas im Kern ihrer Haltung. Die deutschen Bauern wurden mit dem Beginn der Neuzeit auf ihr Land festgenagelt wie der Grünewaldsche Christus ans Kreuz: die meisten von ihnen gingen bis ins 19. Jahrhundert in die sog. ›zweite Leibeigenschaft‹. Wenn nun einer in einem Volk, das zu 95% aus Bauern besteht, kein Bauer sein will und auch kein Handwerk lernt, dann ist das schwierig. Till ist der bodenlose Bauer, der seinen Acker verlässt, weil man von ihm nicht mehr leben kann. Er zeigt uns, wie ein Neubau einer städtischen, später bürgerlichen Gesellschaft nicht gelingen kann, wenn die Bauernfrage, d. h. das Verhältnis der Menschen zu ihrem Land, das ist also auch die Frage der nationalen Identität, nicht gelöst ist. So erscheint Eulenspiegel den Städtern und den Herren, und man kann sagen, dass das Misslingen der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert Eulenspiegel bestätigt hat. Und nun kehrt in A., der von bayrischen Bauern abstammt, dieselbe Bodenlosigkeit wieder. Was ihn im Kern mit Eulenspiegel verbindet, ist die Absurdität der Haltung: »Du hast zwar keine Chance, aber nutze sie!« (Die Atlantikschwimmer, 1978). Dies ist die Lebenslosung Eulenspiegels und mag auch für A.s Lebens gelten, wenn man manches aus den Ich-Erzählungen für bare Münze nimmt. Bestimmt aber gilt sie für seine Arbeit. »Wenn das schon Dummköpfe sind, denen meine Bücher gefallen, was müssen das erst für Dummköpfe sein, denen sie nicht gefallen« (Revolten, 1982). Rückt man seine Bücher, Filme, Theaterstücke und Bilder in die Tradition der Eulenspiegelstreiche, so versteht man sie richtig. Eulenspiegel hat z.B. auf dem Bremer Marktplatz Milch in einen großen Bottich gießen lassen, also Milchmengen gesammelt, mit denen eine mittelalterliche Bauerngesellschaft oder frühe Stadtbewohner auf keinen Fall sinnvoll umgehen konnten. Die Absurdität dieses Bildes können wir heute, zur Zeit europäischer »Milchseen« und »Butterberge«, kaum noch nachempfinden. Die Dinge sind uns tatsächlich so weit über den Kopf gewachsen, dass für unsere Zeit die dem Eulenspiegelschen entsprechenden Absurditäten andere Bilder erfordern. Man erkennt aber im folgenden Beispiel von A. immer noch das Prinzip des grotesken Milchzubers, in dem absurde Harmonie entsteht: »Ursprünglich war ich ein gelernter Flugzeugmaurer. Für 25 Mark in der Stunde habe ich mit Kelle und Wasserwaage Mauern in Flugzeugen hochgezogen. Wie es keinen Treibstoff mehr gegeben hat, habe ich für Kontergankinder Führungen in Atomkraftwerken gemacht. Wenn ich sie was gefragt habe, dann haben sie hier an der Schulter die Finger gehoben. Ich habe ihnen erklärt, dass die Atomkraft den Menschen die Arme erspart« (Das letzte Loch, 1981). Liest man Artikel und Bücher über A., dann fallen immer wieder dieselben Wörter: assoziativ, Aufbegehren, bayrisch, chaotisch, dilettantisch, eigensinnig, individuell, radikal, subjektiv, ungebärdig, utopisch, verwundet, zornig. Zwei Begriffe sind bisher nicht (oder ganz vereinzelt!) genannt worden. Sie haben auch mit Eulenspiegel zu tun: Realismus und Aufklärung. Man kann sagen, dass die Hauptlinie der »Dialekt der Aufklärung«, die Linie des Verstandes, der instrumentellen Vernunft im 20. Jahrhundert, dem Jahrhundert der Verwüstungen, in ihrem Scheitern zu erkennen ist. Jetzt werden die vergessenen, liegengelassenen Nebenlinien interessant. Es gab eine »Aufklärung vor der Aufklärung« des 17. und 18. Jahrhunderts, der die Verengung auf das gerade Denkvermögen des Menschen fremd war. Rabelais, Cervantes, Boccaccio, Shakespeare, um ein paar berühmte Namen zu nennen, hätten den Ursprungssatz der Vernunftaufklärung »Ich denke, also bin ich« vielleicht nicht verstanden und ihn für wenig realistisch, d. h. der Natur des Menschen gemäß gehalten. Von dieser Aufklärung vor und neben der Aufklärung, die auf breiterer, aber ungeordneterer, unübersichtlicherer Grundlage fußt, geht ein starker komischer Impuls aus, der sich in Menschen wie A. und seinen Lesern und Guckern wieder bemerkbar macht. Ihr Hauptprinzip heißt »Aufklärung durch Vernebelung« (Heiner Müller), d. h. sie würden das Gebot »sapere aude!« nie aussprechen, weil sie der Wirkung direkter, linearer, verständiger Kommunikation misstrauten. Von diesem Prinzip leben auch A.s Arbeiten: »Ich möchte aber Filme, die niemand versteht. Früher hat man einen Bachlauf nicht verstanden, heute wird er begradigt, das versteht ein jeder.« »Es geht nicht mehr darum, dieses bürgerliche Verbrechertum zu beweisen, sondern unverschämte Behauptungen in die Welt zu setzen. Die Literatur soll erfinden … Die Erfahrung soll springen, in Erfindungen springen.« Ist es nicht immer noch überraschend, dass Kant in seinem berühmten Aufsatz »Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?« (1783) als erstes Beispiel von Unmündigkeit die Abhängigkeit vom Buch anführt? »Es ist so bequem, unmündig zu sein. Habe ich ein Buch, das für mich Verstand hat, einen Seelsorger, der für mich Gewissen hat, einen Arzt, der für mich die Diät beurteilt, usw.: so brauche ich mich ja nicht selbst zu bemühen.« Natürlich meint Kant mit dem Buch das damals beherrschende Buch, die Bibel. Aber das Verhältnis der Leser zum Geschriebenen muss sich nicht dadurch ändern, dass an die Stelle der Bibel inzwischen alle möglichen Bücher oder auch Filme, Fernsehen u. a. getreten sind. Auch Bücher wie die von Kant, die in emanzipatorischem Interesse verfasst wurden, können sich gegen die Gewohnheit unmündigen Lesens schlecht wehren. Aus diesem Scheitern zieht A. die Konsequenz, Bücher zu schreiben, die überhaupt keinen Verstand haben und daher auch keinen »für mich« haben können. Das Vertrauen auf den Unsinn (von Erfindung und Erfahrung), Komik, will ein Hemmnis gegen unmündiges Lesen sein, denn unsinnigen Sätzen kann man nicht sklavisch-verständig folgen. »Lachen ist ein guter Ausgangspunkt für Denken.« Wer an dem Begriff der Erfahrung festhält, kann kein Gegenaufklärer sein. Es kann sich dabei im Ursprung und Kern nur immer um die eigene Erfahrung handeln. Auf die Einsicht der Bedrohung der Welt gründet sich Achternbuschs Realismus. »Ich bin der Erfinder der Individuellen Kunst, Erfinden kann man die leicht, aber durchsetzen! « Die seit dem 18. Jahrhundert benutzten künstlerischen Formen, die alten Behälter der Erfahrung, können die lebendige, also zunächst individuelle Erfahrung der Gegenwart auf keinen Fall mehr fassen: »Wer eine spezielle literarische Form pflegt, mag er auch noch so ideologische Fassadenpflege betreiben, dient dem blockhaften politischen System. Jeder Roman ist eine totale politische Institution.« Die Grundform A.s ist der Assoziationsstrom, der aber als Naturform der Phantasie, nicht als Kunst bezeichnet werden muss. Sein Realismus besteht gerade darin, ein kunstloser Künstler zu sein. Dies zieht die Feindschaft der Bürokratie (Das Gespenst, 1983), der Ritter des Kulturbetriebs und der Traditionalisten auf sich. Aber es sichert ihm die Zuneigung der Künstler, und zwar auch solcher, die gar nicht zueinander und zu ihm zu passen scheinen. Sie bemerken, dass hier einer die Wurzeln der Kunst, d. h. nichtentfremdeter Produktivität offen hält, so dass man daran anknüpfen kann. Zusammenhänge sind oft unterirdisch. Man muss nicht bestreiten, dass A. mit den häufig genannten Kameraden im Geiste (Karl Valentin, Oskar Maria Graf, Charlie Chaplin, Buster Keaton, Marx-Brothers, Jean Paul, auch mit Robert Walser und Franz Kafka) offenkundig vieles verbindet, wenn man auf andere, weniger offenkundige Bezüge hinweist. Dazu gehört z.B. eine geheime Verwandtschaft mit Robert Musil. Für ein dekadentes Lebensgefühl, welches seine Zeit bestimmte, fand Musil folgendes Bild: »Sätze wie dieser schmecken so schlecht wie Brot, auf das Parfüm ausgegossen wurde, so daß man jahrzehntelang mit alledem nichts mehr zu tun haben mag.« In A.s Film Der Depp (1982) wird folgendes Gericht serviert: »Das Sauerkraut mit dem Schokoladenherz «. Beide Bilder zeigen einen Weltekel, dessen deutscher komischer Archetyp Eulenspiegel ist, unterscheiden sich aber städtisch (Wien, bürgerlich, ironisch) und ländlich (bayrischer Wald, bäuerlich, komisch). Mit diesem Abscheu gegen die Außenwelt geht fast immer die Sehnsucht nach einem anderen Menschen einher, der die Welt genauso verabscheut: das ist Agathe für den Mann ohne Eigenschaften und Susn in den Büchern A. s. Um das Soziale, eigentlich Asoziale, das Kriegerische in der Liebe möglichst gering zu halten, verkleidet sie sich als Inzest. Susn ist wie Agathe die Schwester: »Der Vater hat dir die Susn in den Kopf gespuckt, sag ich da. Er hat einen Rausch gehabt, und in seinem Kater tröstete er sich mit einer schönen Erfindung, einer Tochter aus seinem Samen!« (Die Alexanderschlacht, 1978). Der »letzten « ernsthaften »Liebesgeschichte« Musils folgt die letzte komische. So verstecken sich in A.s Werk, der insofern mitnichten der eigensinnige Eigenbrötler ist, als der er erscheint, Chiffren der deutschen Geistesgeschichte. Das Inzestmotiv lässt sich bis zu Wieland zurückverfolgen. Er wiederbelebt historisch vorhandene Protestenergie gegen die Traumata des geschichtlich Gewordenen: »Denn das Individuum ist der Sinn der Geschichte und ihr Ende zugleich.« Die Aufmerksamkeit, die den Filmen und Büchern A.s in den 1960er, 70er und teilweise 80er Jahren zuteil geworden ist, bricht infolge der Kommerzialisierung der Filmlandschaft und des konservativen öffentlichen Klimas in den 90ern ab, obwohl A. unverdrossen weiter Filme produziert (bisher knapp 30), Bücher schreibt und Bilder malt. Allein im Jahr 2003 veröffentlichte A. vier Bücher: Guten Morgen!, Schnekidus, Liebesbrief und Mein Vater heißt Dionysos. 1993 zeigte die ARD eine Retrospektive seiner Filme, 1994 wird er in die Bayrische Akademie der Schönen Künste aufgenommen. Der österreichische Verlag Bibliothek der Provinz hat inzwischen 19 neue Titel sowie vier Bände einer Gesamtausgabe A.s herausgebracht. Werkausgabe: Gesamtausgabe. Bisher 4 Bände. Weitra 2000 ff. Literatur: Gass, Barbara: Herbert Achternbusch. Fotografien aus 25 Jahren. Heidelberg 1999; Jansen, Peter W./ Schütte, Wolfram (Hg.): Herbert Achternbusch. München/ Wien 1984; Drews, Jörg (Hg.): Herbert Achternbusch, Materialienband. Frankfurt a. M. 1982. Rainer Stollmann Aichinger, Ilse Geb. 1. 11. 1921 in Wien Ein »zartes, vielgeliebtes Wunderkind« war – so erinnert sich der Kritiker Joachim Kaiser noch 1980 – A. für die Mitglieder der legendären Gruppe 47, als sie (ab 1951) an deren Tagungen teilzunehmen begann und 1952 für die Spiegelgeschichte ihren Preis erhielt. Einer aus der Gruppe, der Lyriker und Hörspielautor Günter Eich, wurde A.s Mann. Von ihm, sagt sie nach seinem Tod, habe sie ein Engagement gelernt, das über das politische hinausging, »ein Engagement gegen das ganze Dasein überhaupt«. »Ich lasse mir die Welt nicht bieten«, hat sie ein andermal gesagt und ihren Widerstand gegen politische Systeme, Macht und Machtträger (»die Gekaderten«) immer schon verstanden »nur als Teil eines größeren Widerstandes, dem die Natur nicht natürlich erscheint, für den es den Satz ›weil es so ist‹ nicht gibt«. Der so umfassend und grundsätzlich definierte Widerstand (A.s »biologische Revolte, Anarchie «) schließt ein Schreiben aus, das von einer vorgegebenen Welt und Wirklichkeit ausgeht und einem Programm oder einer Ideologie verpflichtet ist. Und zu keiner Zeit kommt für A. eines in Frage, das nicht den Widerstand in Sprache umsetzt und in ihr aufzeigt: »Sie ist, wenn sie da ist, das Engagement selbst«. »Ich gebrauche jetzt die besseren Wörter nicht mehr«, beginnt die Titelerzählung des Bandes Schlechte Wörter (1976), die eine grimmig-melancholische Demonstration der poetischen Autonomie, ein Plädoyer für die definierende Sprache ist (»Definieren« grenzt an »Unterhöhlen«), für eine, die den »ausreichenden Devisen« und allen Konventionen apodiktisch entrissen wird. A. hat mehrere poetologische Texte geschrieben. Einer davon, Meine Sprache und ich (1978), hat den Titel abgegeben für die Taschenbuchausgabe der gesammelten Erzählungen, 1978; darin findet sich auch Der Querbalken, von Wolfgang Hildesheimer als Schlüsseltext der Literatur der Moderne interpretiert. Diese Texte berichten alle erzählerisch, keineswegs theoretisierend, vom schwierigen Umgang mit der Sprache und mit der Welt, die sich in ihr spiegelt. Ihr erstes Buch, den Roman Die größere Hoffnung (1948), begann A. zu schreiben, um darüber zu berichten, »wie es war«. Sie hatte die Jahre des Kriegs und der Naziherrschaft in Wien verlebt und musste als Halbjüdin (vor allem aber ihre jüdische Mutter) ständig mit der Deportation rechnen. Diese dokumentarische, historische, autobiographische Realität wird verwandelt in eine poetische. Einmal dadurch, dass A. weder den Schauplatz noch die Verfolger und die Opfer benennt. Vor allem aber durch eine kühne, expressive Bildersprache, die nicht nur mit der damals zur Wahrheitsfindung für unverzichtbar gehaltenen »Kahlschlag «-Sprache nichts gemein hat, sondern auch innerhalb von A.s übrigem Werk einzig dasteht. Die Verwandlung überhöht oder schließt den realen Schrecken keineswegs aus, aber sie konfrontiert ihn radikal mit einer durch ihn nicht einzuholenden poetischen Gegenwelt. In dieser Gegenwelt lebt eine Gruppe verfolgter Kinder und Halbwüchsiger spielerisch und – buchstäblich! – spielend den Widerstand und die Verweigerung: Im Kapitel »Das große Spiel« führen sie ein Theaterstück auf; sie spielen es so intensiv, dass ein »Häscher « von der »Geheimen Polizei«, der die Kinder abholen soll, seinen Auftrag vergisst und sich in das Spiel einbeziehen lässt. Die fünfzehnjährige Ellen, die sich der Gruppe angeschlossen hat, obwohl sie »zwei falsche Großeltern zu wenig« habe, kommt dabei zu der Erkenntnis, dass die »große Hoffnung« – auf ein Ausreisevisum nämlich – zu wenig ist. »Nur wer sich selbst das Visum gibt…, (wird) frei«. Die »größere Hoffnung« aber richtet sie – während sie von einer explodierenden Granate zerrissen wird – auf eine neue Welt des Friedens und der Menschlichkeit. A.s einziger Roman, obwohl früh in seiner Bedeutung erkannt (»die einzige Antwort von Rang, die unsere Literatur der jüngsten Vergangenheit gegeben hat« – Walter Jens), sei trotzdem bis heute »ein Buch, das geduldig auf uns wartet«, meint Peter Härtling; der Erfolg von A.s frühen Erzählungen habe einer breiten Publikumsresonanz im Wege gestanden. Von Rezeption und Umfang her bilden die Erzählungen tatsächlich das Zentrum ihres Werks. Und manche davon sind Lesebuchklassiker geworden; von den früheren neben der Spiegelgeschichte vor allem Der Gefesselte, Die geöffnete Order, Das Fenstertheater, von den späteren Mein grüner Esel,Wo ich wohne oder Mein Vater aus Stroh. Hingegen sind A.s Hörspiele (vier davon gesammelt im Band Auckland, 1969) und die Dialoge und Szenen (Zu keiner Stunde, 1980) kaum zur Kenntnis genommen worden; in diesen Textgattungen ist A.s Poetik des Schweigens (»Vielleicht schreibe ich, weil ich keine bessere Möglichkeit zu schweigen sehe«), der Leerräume und der ständigen Verlegung der Grenzen der Realität von Zeit und Raum besonders weit getrieben. In A.s literarischer Entwicklung seit Die größere Hoffnung ist eine sprachliche und gedankliche Radikalisierung zwar unverkennbar, aber sie lässt zu keiner Zeit Teile ihres früheren Werks überholt erscheinen. Zu Recht verrät in dem 1978 erschienenen Gedichtband Verschenkter Rat keine chronologische Anordnung die bis zu fünfundzwanzig Jahre auseinanderliegende Entstehungszeit der Gedichte. Der andere, der nicht durch Überlieferung und Übereinkunft verstellte Blick auf die Realität ist für die frühe wie die späte Lyrik kennzeichnend. Nachruf ist aus diesem freien Blick heraus entstanden. Die Raum- und Zeitlosigkeit, in der die vier lakonischen Imperative gesprochen sind, vermag eine von allen Seiten (religiös, historisch, sozial und politisch) abgesicherte Weltordnung auf den Kopf zu stellen und zu zertrümmern: »Gib mir den Mantel, Martin, / aber geh erst vom Sattel / und laß dein Schwert, wo es ist, / gib mir den ganzen«. Und der Prosatext Schnee (aus Kleist, Moos, Fasane, 1987) lässt in seinen letzten Zeilen und mittels eines verbindlichen Irrealis’ die ganze Schöpfungsgeschichte neu (und humaner) beginnen: »Wenn es zur Zeit der Sintflut geschneit und nicht geregnet hätte, hätte Noah seine selbstsüchtige Arche nichts geholfen. Und das ist nur ein Beispiel«. Kleist, Moos, Fasane enthält Texte aus vier Jahrzehnten. An ihnen, vor allem aber an der zu A.s siebzigstem Geburtstag 1991 erschienenen (mustergültig edierten) Taschenbuch-Ausgabe der Werke in acht Bänden ist es nochmals zu überprüfen, wie die zu einer Klassikerin der deutschen Gegenwartsliteratur gewordene Autorin zugleich immer eine Avantgardistin geblieben ist, für die die Zeitlosigkeit, in der ihr Schreiben angesiedelt sein will, jedenfalls nicht die geringste Gemeinsamkeit aufweist mit Zeitferne. Darum war es zwar eine Überraschung, hat aber durchaus seine Logik, dass A. Jahre später als Kolumnistin für die Wiener Tageszeitung Der Standard tätig wurde. Seit Oktober 2000 erscheint von ihr jeden Freitag eine Kolumne: eine erste Serie unter dem Titel Journal des Verschwindens, die anschließenden Folgen mit den Titeln Unglaubwürdige Reisen und Schattenspiele. – Die Kolumnen des ersten halben Jahres bilden den Schwerpunkt des Bandes Film und Verhängnis. Blitzlichter auf ein Leben (2001). Zusammen mit anderen, weniger an die cineastische Aktualität gebundenen Gelegenheitsarbeiten (im ersten Teil des neuen Buches) offenbaren die Film-Kolumnen eine Autorin mit dem genauen Bewusstsein dafür, dass sie für ein anderes Medium arbeitet und sich nicht ausschließlich an ihre bisherigen Leser wendet, sondern beispielsweise auch an solche, die wie sie selber passionierte und kenntnisreiche Kinogänger sind. Wie A. die Gratwanderung zwischen einer neuen Zugänglichkeit und der unverwechselbar A.schen sprachlichen und gedanklichen Radikalität meistert, das ist in den einzelnen Texten des Bandes Film und Verhängnis ebenso wie in den seither wöchentlich publizierten Kolumnen jedesmal von neuem staunens- und bewundernswert. Ebenfalls als Journal-Kolumne für eine Tageszeitung (Die Presse) entstanden die Subtexte (2006), geschrieben im Wiener Café Jelinek und anlässlich der Lektüre der Schriften von E.M. Cioran. Die kurzen Texte A.s hinterfragen sprachlich meisterhaft das scheinbar Selbstverständliche, ein Gestus, der auch in der anarchischen Neuerzählung eines Grimmschen Märchens sichtbar wird (Der Wolf und die sieben jungen Geißlein, 2004). Der Erzählband Unglaubwürdige Reisen (2005) ersetzt die Bewegung in der geographischen Welt durch imaginäre Reisen an Orte der Kindheit, traumatisch erfahrene Urszenen als Fragmente der eigenen Identität. Werkausgaben: Kurzschlüsse (Prosa). Wien 2001 (mit CD); Werke. Taschenbuchausgabe in acht Bänden. Hg. von Richard Reichensperger. Frankfurt a. M. 1991. Literatur: Samuel 32003; Herrmann/Thums 2001; Lindemann 1988; Moser, Samuel (Hg.): Ilse Aichinger, Materialien zu Leben und Werk. Frankfurt a. M. 32003; Herrmann, Britta/Thums, Barbara (Hg.): »Was wir einsetzen können, ist Nüchternheit«. Zum Werk Ilse Aichingers. Würzburg 2001; Lindemann, Gisela: Ilse Aichinger. München 1988. Heinz F. Schafroth/Red. Alexis, Willibald (d. i. Georg Wilhelm Heinrich Häring) Geb. 29. 6. 1798 in Breslau; gest. 16. 12. 1871 in Arnstadt So wie A. die Mark Brandenburg in seinen historischen Romanen dargestellt habe, sei er »eine ganz große Nummer«, schreibt Theodor Fontane 1895 an Heinrich Jacobi. 1872 hatte Fontane den »märkischen Klassiker« A. und seine »vaterländischen Romane« in einem großen Essay zwar ausführlich gewürdigt, aber letztlich resümiert, der Autor – sein Stil sei oft schwerfällig und kaum flüssig lesbar – würde wohl nur wenige Leser ansprechen: Er »konnte nicht populär werden und wird es nicht werden«. Urteile wie das Fontanes führten zu dem recht einseitigen Bild eines mittelmäßigen Autors, das sich immer mehr verfestigte: A. als der patriotische Fanatiker, der Preußen und die Hohenzollern-Dynastie verklärt und überschätzt; das umfangreiche Gesamtwerk wurde auf seine acht historischen Romane reduziert, in denen A. die Geschichte Brandenburg-Preußens bearbeitete, womit gleichzeitig andere Teile seines Gesamtwerks fast vollständig aus dem Gedächtnis des Leserpublikums verschwanden. In der Bundesrepublik galt der weitgehend in Vergessenheit geratene A. lange nur noch als Verherrlicher Preußens, in der DDR wurde ihm – begünstigt durch die marxistische Literaturkritik – eine etwas größere Aufmerksamkeit zuteil. Von einzelnen Studien abgesehen, wird A.’ umfangreiches, vielschichtiges Werk erst seit einigen Jahren differenzierter betrachtet, neu analysiert, bewertet und der Autor sogar als ein »Bahnbrecher des deutschen Romans« (Anni Carlsson) angesehen. Die sehr schlechte Editionslage von A.’ teils weit verstreut erschienenen Werken (u. a. Romane, Novellen, Dramen, Lyrik, autobiographische Schilderungen, Reisebeschreibungen, publizistische und literaturkritische Arbeiten) und Briefen, die noch unzureichend erforschten Lebensumstände und kaum untersuchte Stellung im Literaturbetrieb des 19. Jahrhunderts erschweren weiterhin eine Beschäftigung mit A. Mit dem 1824 erschienenen Roman Walladmor, den A. – wie auch seinen zweiten Roman Schloß Avalon (1827) – als die freie Übersetzung eines Werks des berühmten Walter Scott ausgab, gelang ihm sein erster literarischer Erfolg. Der studierte Jurist gab die Beamtenlaufbahn am Berliner Kammergericht auf und widmete sich fortan dem Schreiben. A. verfasste eine kaum zu überblickende Menge an Beiträgen für die bekanntesten Zeitungen und Zeitschriften der VormärzÄra und die Zeit der 1848er Revolution (u. a. Vossische Zeitung, Jahrbücher der Gegenwart und Der Freimüthige, oder: Berliner Conversations- Blatt). Als einflussreicher literarischer ›Großkritiker‹ (u. a. in den Blättern für literarische Unterhaltung und im Morgenblatt für gebildete Leser) und zeitkritischer Publizist, der für Pressefreiheit eintrat und die Zensur kritisierte, war er eine Macht. Mit beinahe allen Autoren seiner Zeit »hatte er persönlichen oder literarisch vermittelten, freundlichen oder feindlichen Kontakt« (Beutin); A. unterstützte die in- und ausländische Literaturproduktion und förderte die zeitgenössische Literatur, unter anderem Heinrich Heine. Über seine Reisen durch Frankreich, Skandinavien, Süddeutschland, Österreich und Ostpreußen veröffentlichte A. Reiseberichte und Feuilletons (Herbstreise durch Scandinavien, 2 Bde., 1828; Wanderungen im Süden, 1828; Wiener Bilder, 1833). Während A.’ Dramen (etwa Die Sonette, um 1827; Aennchen von Tharau, um 1829; Der Salzdirektor, um 1851) – zu ihrer Zeit zwar nicht völlig erfolglos – schon im 19. Jahrhundert in Vergessenheit gerieten und heute unbekannt und unerforscht sind, erfreute sich ein Gedicht einer größeren Popularität: seine Ballade Fridericus Rex, die, so Fontane, schon »ganz und gar zum Volkslied« geworden sei. Großes Interesse brachte A. Kriminalfällen entgegen, die er sammelte, beschrieb und zusammen mit dem Juristen Julius Eduard Hitzig unter dem Titel Der neue Pitaval. Eine Sammlung der interessantesten Criminalgeschichten aller Län- der aus älterer und neuerer Zeit von 1842 an herausgab (60 Bände, von denen A. 28 verfasste). Er konnte seine juristischen Erfahrungen, psychologischen Kenntnisse und epischen Fähigkeiten einbringen, um Geschichten zu schreiben, die als Grenzform zwischen literarischer Erzählung und quasi-authentischem Fallbericht bzw. Reportage angesiedelt sind. Die kaum erforschte Novellistik A.’ (u. a. Gesammelte Novellen, 4 Bde., 1830/31; Neue Novellen, 2 Bde., 1836) und vor allem historische Romane stellen den wichtigsten und umfangreichsten Teil seines OEuvres dar. Von Walter Scott beeinflusst, erwarb er sich zwar seinen Ruf als »vaterländischer « Autor mit den acht – mehrbändigen – historischen Romanen über Themen der brandenburgisch- preußischen Geschichte (Cabanis, 6 Bde., 1832; Der Roland von Berlin, 3 Bde., 1840; Der falsche Woldemar, 3 Bde., 1842; Die Hosen des Herrn von Bredow, 2 Bde., 1846–1848; Der Wärwolf, 3 Bde., 1848; Ruhe ist die erste Bürgerpflicht, oder Vor fünfzig Jahren, 5 Bde., 1852; Isegrimm, 3 Bde., 1854; Dorothe, 3 Bde., 1856), verarbeitete aber auch Themen der französischen Geschichte, wie in Urban Grandier oder die Besessenen von Loudun (2 Bde., 1843) einen berühmten französischen Kriminalfall aus dem 17. Jahrhundert. Mit seinen Zeitromanen Das Haus Düsterweg. Eine Geschichte aus der Gegenwart (2 Bde., 1835) und Zwölf Nächte (3 Bde., 1838) trug er – wie die Jungdeutschen – zur Kritik der Zeit bei. A. gilt heute nicht nur als der neben Tieck wichtigste Autor historischer Romane im Vormärz, sondern auch als der bedeutendste Theoretiker des Genres in dieser Zeit; er hinterließ zwar keine komplexe Theorie, doch die Anmerkungen und Exkurse zum Geschichtsroman, die sich in Vorworten und Zwischenbemerkungen seiner Romane finden, bilden die Bausteine zu A.’ Theorie des historischen Romans. Die neuere Forschung spricht A. vom Vorwurf der ›Borussomanie‹ frei, denn der Wahrheitsanspruch, den er an den historischen Roman und an sein eigenes Erzählen stellte, schloss die glorifizierende Darstellung aus. In den frühen 1850er Jahren verließ A. das Berlin der Reaktionszeit und zog in die kleinstaatliche Provinz nach Arnstadt in Thüringen, wo er 1856 und 1860 zwei schwere Schlaganfälle erlitt, die bis zu seinem Tod 1871 ein langes Siechtum zur Folge hatten. Werkausgaben: Romane und Erzählungen. Gesamtausgabe. 23 Bde. Hg. von Norbert Miller/Markus Bernauer. Hildesheim 1996 ff.; Vaterländische Romane. Hg. von Ludwig Lorenz und Adolf Bartels. 10 Bde. Leipzig 1921–25; Gesammelte Werke. 20 Bde. in 7 Bänden. Berlin 1874. Literatur: Dittrich, Janny: Willibald Alexis in Arnstadt. Geschichts- und literaturwissenschaftliche Untersuchungen über ein Dichterleben in der zweiten Hälfte des 19. Jh.s. Frankfurt a. M. u. a. 2001; Beutin, Wolfgang/ Stein, Peter (Hg.): Willibald Alexis (1798–1871). Ein Autor des Vor- und Nachmärz. Bielefeld 2000; Thomas, Lionel H.C.: Willibald Alexis. A German Writer of the Nineteenth Century. Oxford 1964. Alexander Reck Altenberg, Peter (d. i. Richard Engländer) Geb. 9. 3. 1859 in Wien; gest. 8. 1. 1919 in Wien A. war der Inbegriff des Wiener Kaffeehausliteraten und Bohemien. Seine Prosaskizzen, seine kulturkritischen Aphorismen und Bilder aus dem Wiener Großstadtalltag nannte er »Extrakte des Lebens« (Wie ich es sehe, 1896; Was der Tag mir zuträgt, 1900; Bilderbögen des kleinen Lebens, 1909). Nach einem abgebrochenen Jura- und Medizinstudium versuchte er sich u. a. als Buchhändler, bis er sich – von Karl Kraus gefördert – als freier Schriftsteller in den Kaffeehäusern einrichtete, dort residierte, arbeitete und lebte. Außer Karl Kraus waren Egon Friedell und der Architekt Adolf Loos seine Mentoren; mit den Literaten des Jungwiener Kreises stand er im engen Kontakt. A. gilt als Meister der kleinen Form: der Skizze, des Feuilletons, des Aphorismus, der Anekdote. Er komprimierte einen Eindruck in knappster sprachlicher Gestalt, hinter der jedoch stets das erlebende Ich greifbar bleibt: das solipsistische Ich eines sensitiven, nervösen Augenmenschen. Die Sammlung Wie ich es sehe (die Betonung liegt auf »sehe«) kann für A.s literarisches Verfahren exemplarisch stehen. Den Augenblick, den flüchtigen Eindruck, die plötzliche Begegnung, die dissoziierte Wirklichkeit holt er mit seiner Ein-Wort- und Ein-Satz-Kunst in die Sprache. Am besten hat er dieses in seiner Selbstbiographie (1918) charakterisiert: »Ja, ich liebe das ›abgekürzte Verfahren‹, den Telegrammstil der Seele! Ich möchte einen Menschen in einem Satze schildern, ein Erlebnis der Seele auf einer Seite, eine Landschaft in einem Worte! Lege an, Künstler, ziele, triff ins Schwarze! Basta.« Dort hat er auch seine Optik, seinen Kult des Sehens beschrieben: »Mein Leben war der unerhörten Begeisterung für Gottes Kunstwerk ›Frauenleib‹ gewidmet! Mein armseliges Zimmerchen ist fast austapeziert mit Aktstudien von vollendeter Form. … Wenn P. A. erwacht, fällt sein Blick auf die heilige Pracht, und er nimmt die Not und die Bedrängnis des Daseins ergeben hin, da er zwei Augen mitbekommen hat, die heiligste Schönheit der Welt in sich hineinzutrinken! Auge, Auge, Rothschild-Besitz des Menschen! … Ich möchte auf meinem Grabsteine die Worte haben: ›Er liebte und sah!‹« A. war der unschuldigen Huldigungen und Verehrung für das Schöne voll; vor allem den aufblühenden Jungmädchenleib beschrieb er. Bei aller Egozentrik war er fähig, sich ohne Begehren der Frau zu nähern, ein Freund, kein Verführer. Er ging als ästhetischer Solipsist ganz im interesselosen Anschauen seiner schönen Objekte auf. Er bedauerte, dass die freien erotischen Beziehungen durch Konventionen und durch das Machtstreben vereitelt werden. A. machte das Café Central berühmt, so wie diese Lokalität seine Lebensweise förderte und prägte. Er schrieb zumeist auf Veranlassung, eilig für ein kleines Honorar, das oft schon durch den Vorschuss aufgebraucht war. Zornig konnte er in seinen Aphorismen werden: »Mein Gehirn hat Wichtigeres zu leisten, als darüber nachzudenken, was Bernard Shaw mir zu verbergen wünscht, indem er mir es mitteilt!« Zuweilen zielte er tiefer: »Musik ist: wie wenn die Seele plötzlich in einer fremden Sprache ihre eigene spräche!« Sein Erscheinen ließ immer etwas Besonderes erwarten; seine berühmte allnächtliche Odyssee, die Suche nach seiner Wohnung, war polizeinotorisch. Allein dies reichte Egon Friedell schon aus für eine ganze Anthologie von Altenberg-Anekdoten, in denen er seine erinnerbare Gestalt gefunden hat. Literarisch liegt A.s Bedeutung in seinem »Impressionismus « oder »Pointillismus«, besser: in den spontan wirkenden Skizzen, und in seinem Beitrag zur Geschichte des Wiener Feuilletons. Der Ich-Kult war ihm wie den meisten Kaffeehausliteraten Selbstverständlichkeit. »Mich interessiert an einer Frau meine Beziehung zu ihr, nicht ihre Beziehung zu mir! … Der Blick, mit dem sie einen anderen liebenswürdig anschaut, macht mich, mich allein unglücklich! Daher gehört dieser Blick mir, mir und nicht ihm, dem eitlen Laffen! Mir, mir allein gehört alles, was von ihr kommt, Böses und Gutes, denn ich, ich allein empfinde es!« A. war der klassische Schmarotzer, der in Häusern der Aristokratie ebenso verkehrte wie im Bordell, wenn er nicht gerade im Kaffeehaus war. Als Bohemien und radikaler, doch sanftmütiger Individualist verfolgte er, verfolgten ihn verschiedene Reformideen (natürliche Kleidung, Gesundheitsschuhe). Mit seinem Reformwahn reagierte er auf den Verlust der Wertordnung, auf das, was bei Hermann Broch als »Verlust des Zentralwertes« in der zu Ende gehenden Donaumonarchie diagnostiziert worden war. Seine Exzesse (Alkohol, Schlafmittel) verursachten wiederholt Nervenkrisen und bedurften der klinischen Behandlung. Oder er erholte sich als Nachtschwärmer bei Gelagen von seinen strapaziösen Reformen an Leib und Gliedern. Kaum verwunderlich, dass für ihn Stoffwechselstörungen die einzige Erklärung für die Taten der Bösewichter der Weltliteratur waren. In den späteren Jahren wird das Erlebnis, der einzigartige Eindruck derart stilisiert, dass die Empfindung zum Fetisch wird oder zum beliebigen Reiz verkümmert. Seine Texte wurden nach seinem Tode von Alfred Polgar (Nachlaß), von Karl Kraus (Auswahl) und von Egon Friedell herausgegeben (Das Altenberg-Buch, 1922). Werkausgabe: Ausgewählte Werke in 2 Bänden. München 1979. Literatur: Barker, Andrew: Telegrammstil der Seele. Peter Altenberg – eine Biographie. Wien u. a. 1998; Kosler, Hans Christian (Hg.): Altenberg, Peter: Leben und Werk in Text und Bildern. Frankfurt a. M. u. a. 1997; Schaefer, Camillo: Peter Altenberg oder die Geburt der modernen Seele. Wien/München 1992. Helmut Bachmaier |
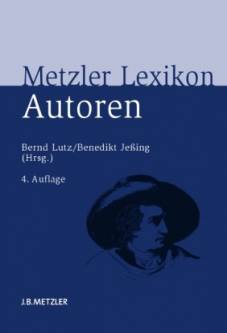
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen