|
|
|
Umschlagtext
Das Metzler Autoren Lexikon liegt jetzt in zweiter, überarbeiteter und erweiterter Auflage vor. Insbesondere den Autoren des 20. Jahrhunderts wird verstärkt Rechnung getragen, die Artikelzahl von 330 auf 440 erhöht. Seit seinem Erscheinen 1986 hat es sich als bevorzugtes Nachschlagewerk durchgesetzt. Für seinen Wert spricht, daß die vorhandenen Literaturgeschichten das Biographische kaum einmal gelten lassen. Das Metzler Autoren Lexikon, an dem nahezu 150 Fachwissenschaftler mitgearbeitet haben, soll das Verstehen von Literatur bereichern und vertiefen. Es hebt sich von den vorhandenen Nachschlagewerken zu biographischen und werkgeschichtlichen Aspekten der deutschen Literatur durch die Lebendigkeit und Eindringlichkeit der Darstellung und die Konzentration auf die wesentlichen Autoren der deutschen Literaturgeschichte und der literarischen Gegenwart ab. Die Artikel sind angemessen breit angelegt und enthalten die Daten und Fakten zu Leben, Werk und Wirkung, die einen weitergehenden Eindruck der Autorenpersönlichkeit vermitteln. Dabei wurde auf einen originellen erzählerischen Zugang besonderer Wert gelegt. Jeder Artikel ist mit einer Abbildung des Autors versehen, die Nennung wichtiger und allgemein zugänglicher Sekundärliteratur vervollständigt den Überblick. Die Artikel sind alphabetisch angeordnet, eine Auswahlbibliographie wichtiger Auskunftsmittel zur literarischen Biographie und ein Namensregister, das sich unter den Aspekten der Traditionsbildung, der bestehenden Freundschaften oder der Gruppenbildung als sinnvoll erwiesen hat, ergänzen den Band.
Rezension
Wie die ausgewählte Leseprobe zeigt, sind die Artikel lebendig und eindringlich verfaßt. Sie enthalten genügend Daten, Fakten und Hinweise auf Quellen und Sekundärliteratur, so dass eine Weiterarbeit möglich wird. Die wesentlichen Autoren in Geschichte und Gegenwart sind ausgewählt, eine Aktualisierung auf die neueste Zeit wäre wünschenswert. Gleichwohl: ein Standardwerk, das neben jeder Deutschen Literaturgeschichte seinen Platz finden sollte. - Autorinnen werden übrigens in einem extra Lexikon des Verlags behandelt.
Buschmann, Lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
440 Biographien deutschsprachiger Autorinnen und Autoren vom Mittelalter bis heute - lebendig und anschaulich werden die zentralen Gestalten der deutschen Literaturgeschichte in ihren Lebensschicksalen, den Zeitumständen und durch ihr Werk vorgestellt. Autoreninformation: Bernd Lutz, Leiter eines geisteswissenschaftlichen Fachverlages, Stuttgart Inhaltsverzeichnis
Leseprobe:
Hoddis, Jakob van (d.i. Hans Davidsohn): Geb. 16.5.1887 in Berlin; 30. April 1942 Deportation, Todesdatum und -ort unbekannt Als Zangengeburt in die Welt gesetzt, der kräftigere Zwillingsbruder tot, der Vater kokainabhängig, Arzt und Materialist, die Mutter schöngeistige Idealistin. Ihr, die er zeitlebens um Geld anging, widmete der 15jährige zum 44. Geburtstag ein Heft mit 28 Gedichten, romantisierende und historisierende Verse aus der Märchen- und Sagenwelt. Ihm schrieb der 18jährige satirische Epigramme, mit denen er auf Autoritäten, bürgerliche Doppelmoral und wilhelminische Ideale witzig eindrosch. Legte sich mit seinem Deutschlehrer an, als der losgiftete: »Sudermann, Hauptmann, Nietzsche und die anderen Schweine«, ging von der Schule ab, machte als »Wilder« das Abitur nach (1906). Ein Architekturstudium und Baupraktikum in München wurde abgebrochen (1906/1907), dafür in Jena und Berlin Griechisch und Philosophie studiert. Mit seinen Freunden Erwin Loewenson und Kurt Hiller gründete H. den »Neuen Club« (1908), einen literarischen Zirkel, gedacht als Kritik am herkömmlichen Kulturbetrieb und als Förderung einer neuen, avantgardistischen Kultur. In seinem »Neopathetischen Cabaret«, dem sich u.a. Ernst Blass und Georg Heym anschlössen, zog der »Neue Club« seine öffentlichen, turbulenten Lesungen und Aktionen ab. H.s Lyrik galt als repräsentativ für den »Neuen Club«, dem »heiter-siedenden Laboratorium des lebendigen Geistes« (Erwin Loewenson), sie entsprachen Hillers Theorie von »Gehirnlyrik« als einer Verschmelzung aus sensualen, sentimentalen und mentalen Elementen. Angeschrieben wurde gegen bildungsbürgerliche Traditionen, die verlächer-licht werden - Johann Wolfgang von Goethe und die deutsche Klassik im Italien-Zyklus etwa - , Erwartungshaltungen wurden zerstört, Wertvorstellungen abgewertet, umgewertet, negiert, parodiert, aufgelöst in schwarzen Humor - weswegen Andre Breton H. so schätzte - und im Groteskstil zerrieben, der zum Markenzeichen von H. wird. Großstadt wurde ästhetisch umgesetzt, ihre neuen Stoffe, doch auch ihre neuen Erfahrungsweisen (Verkehr, Tempo, Technik, Reklame, Kino, Zeitung, Gleichzeitigkeit, Dichte, Intensität). Bekannt wurde H. vor allem als Autor des Variete-Zyklus (zehn Gedichte) und des Weitendes (1911), der »Eröffnung der expressionistischen Lyrik« (Kurt Hiller). »Diese 8 Zeilen entführten uns, keinem sind solche zwei Strophen gelungen« (Johannes R. Becher), die einsetzen: »Dem Bürger fliegt vom spitzen Kopf der Hut«. H. galt als Bürgerschreck: verwahrlost, unrasiert, picklig, ein jähzorniger Maulheld und Einzelgänger, 1.53 m groß (»Krümel« hatten ihn die Mitschüler verspottet). Der Vortrag seiner Gedichte, die er alle stets bei sich trug, muß bestechend gewesen sein. Er schrieb wenig und langsam und verlor viel. Expressionistische Zeitschriften wie Der Sturm, Die Aktion, Die neue Kunst veröffentlichten seine Gedichte, lediglich eine geschlossene Sammlung von sechzehn Gedichten wurde gedruckt (Weltende, 1918). Schon früh zeigten sich Hinweise auf eine beginnende Schizophrenie (ab 1911/12), erste Internierungen in Nervenheilanstalten folgten (ab 1912). Zwei Frauen wurden, neben der Mutter, für sein Leben bestimmend: Emmy Hennings (die spätere Frau von Hugo Ball), durch die er vom jüdischen Glauben zum Katholizismus konvertierte, und Lotte Pritzel, in die er sich erfolglos verliebte, bekannt durch ihre lasziv-frommen Puppenschöpfungen (mit denen sich H., geschminkt und verkleidet, identifizierte). Verstärkt schrieb H. religiös übersteigerte Lyrik, die später immer mehr von Sexualphantasien überwuchert wurde. Am 25. 4.1914 trat H. ein letztes Mal bei einem Autorenabend der Aktion auf, danach verliert sich sein Leben in und um Heilanstalten (Jena, Bad Eglersburg, Frankenhain, Tübingen, Göttingen). H. schrieb, malte, spielte Schach, trieb »Spitzenmathematik«, rauchte und onanierte gleichermaßen exzessiv, zog vor jedem Tier, das ihm in Tübingen begegnete, den Hut. Lebte autistisch und schwerhörig friedlich dahin. Lächelte und lachte oft: »Und kann ich die Welt nicht aushaken, darum gab mir Gott das Lachen«. Nur wenn man ihn waschen wollte, wurde er aufbrausend. Aus der »Israelitischen Heil- und Pflegeanstalt« in Bendorf-Sayn bei Koblenz (ab 1933) wurde er, laut Gestapoliste, als »lfd. Nr. 8« deportiert (wahrscheinlich ins polnische Belzec, Chelmno oder Sobibor) und irgendwann und irgendwo vergast und verscharrt. Werkausgabe: Jakob van Hoddis. Dichtungen und Briefe. Hrsg. von Regina Nörtemann. Zürich 1987. Literatur: Läufer, Bernd: Jakob van Hoddis. Der »Variete-Zyklus«. Ein Beitrag zur Erforschung der frühexpressionistischen Großstadtlyrik. Frankfurt a.M. 1992; Seim, Jürgen (Hrsg.): Tristitia ante. Geahnte Finsternis. 1887-1987. Zu Leben und Werk des Dichters Jakob van Hoddis. Gütersloh 1987; Hornbogen, Helmut: Jakob van Hoddis. Die Odyssee eines Verschollenen. München 1986; Reiter, Udo: Jakob van Hoddis. Leben und lyrisches Werk. Göppingen 1970. Dirk Mende |
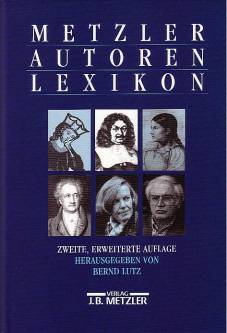
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen