|
|
|
Umschlagtext
Am 3. November 2010 feiert der Kölner Schriftsteller Dieter Wellershoff seinen 85. Geburtstag. Der Autor hatte früh mit dem Schreiben begonnen und war auf dem literarischen Feld zunächst als Lektor bei Kiepenheuer und Witsch in Köln tätig und rasch bekannt, rückt seit Ende der 60er Jahre die eigene literarische Produktion – insbesondere als Erzähler – in den Vordergrund. Wellershoffs ausdifferenzierte poetologische Position, die er in einer Vielzahl von Essays, Vorträgen und Vorlesungen im Blick auf die eigene Literatur, aber auch auf stupende Weise in der Beschäftigung mit literarischen Traditionen beschrieben hat, kreist um ein anthropologisches Literatur- und Kunstverständnis, bewegt sich um Begriffe und Stichworte wie Realismus, Literatur als Simulationsraum und Probebühne. Insbesondere seit den 90er Jahren ist es Wellershoff mit einem beeindruckenden Spätwerk – Romanen und Erzählsammlungen wie „Der Liebeswunsch“, „Das normale Leben“ und „Der Himmel ist kein Ort“ – gelungen, auch ein großes Publikum zu erreichen. Grund genug, um diesen Schriftsteller, Erzähler, Medienautoren und Essayisten, mit Essays, Aufsätzen, Vorträgen, Laudationes und persönlichen Stellungnahmen unter Berücksichtigung vor allem des Spätwerks zu würdigen und nicht zuletzt dabei seinen Ort in der literarischen Landschaft der Bundesrepublik zu erkunden. Hinzu kommen eine umfassende Bibliographie der letzten zehn Jahre, die die vorhandenen Bibliographien ergänzt und fortschreibt, ein Interview, das auf den Kern und Schreibimpuls dringt, und eine Auswahl von Briefen Dieter Wellershoffs aus den letzten fünf Jahren, die den unbekannten Epistolographen zeigen.
Rezension
„Literatur, die etwas taugt, ist gefährlich“ (Dieter Wellershoff) - für den Leser wie für den Autor; sie konfrontiert mit der menschlichen Existenz. Literatur existiert nur als gefährliche; denn sonst ist sie trivial und un-bedeutend. Literatur, darauf hat Dieter Wellershoff schon früh in poetologischen Reflexionen hingewiesen und mit Nachdruck insistiert, stellt so etwas wie einen ,Simulationsraum‘ oder eine ‚Probebühne‘ dar, auf der lebenswichtige, noch radikaler: überlebensnotwendige Probleme und Konstellationen verhandelt werden. Diese Festschrift ehrt den Kölner Schriftsteller und früheren Kiepenheuer & Witsch-Lektor Dieter Wellershoff (*3. November 1925 in Neuss), der dem "neuen Realismus" und der "Kölner Schule" zugeordnet wird, zum 85. Geburtstag mit Essays, Aufsätzen, Vorträgen, Laudationes und persönlichen Stellungnahmen.
Jens Walter, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Werner Jung, geb. 1955, Privatdozent an der Gerhard-Mercator-Universität Duisburg, im akademischen Jahr 1999/2000 visiting full Professor am German Department und im Literature Program der Duke University, NC. Lehr- und Forschungsgebiete: Literatur des 18. bis 20. Jahrhunderts, Literaturtheorie, Ästhetik, Poetik. Inhaltsverzeichnis
Werner Jung
Geglücktes Unglück 7 Literatur als Erfahrung. Heinrich Deserno im Gespräch mit Dieter Wellershoff 17 Olaf Petersenn Unterwegs im hermeneutischen Zirkel. Vom Leben und Schreiben Dieter Wellershoffs 27 Albert von Schirnding Ein Meister des unaufgeregten Stils. Persönliche Anmerkungen zu Dieter Wellershoff 37 Walter Delabar Simulation und Sozialisation. Dieter Wellerhoffs Plädoyer für eine nützliche Literatur und seine Aktualisierung durch Roger Silverstone 43 James H. Reid Dieter Wellershoff, Heinrich Böll und der Kriminalroman 65 Thomas Stölzel Den Tiefengehalt einer Situation erkunden. Dieter Wellershoffs autobiographische Prosa als eine „Arbeit des Lebens“ 77 Wilhelm Amann Der Verführer, das „Geständnistier“. Don Juan in Dieter Wellershoffs Erzählung „Die Körper und die Träume“ 97 Hajo Steinert Der Seelenforscher. Über Dieter Wellershoffs Romane „Der Liebeswunsch“ und „Der Himmel ist kein Ort“ 113 Oliver Sill Wahlverwandtschaftsarithmetik. Zur Bedeutung von Goethes „Wahlverwandtschaften“ für Dieter Wellershoffs Roman „Der Liebeswunsch“ 119 Karl Prümm Kinostücke. Filmorientierungen und Filmresonanzen bei Dieter Wellershoff – mit einer Analyse der Romanverfilmung „Der Liebeswunsch“ 139 Georgeta Vancea Die Poesie des Herzens und die Prosa der Verhältnisse. Dieter Wellershoff und die Literatur des Begehrens 157 Manfred Durzak Erzählerische Recherchen im „normalen Leben“. Zu den Erzählungen Dieter Wellershoffs in seiner Sammlung „Das normale Leben“ 177 Dieter Wellershoff Briefe 2005-2010 191 Gabriele Ewenz Bibliographie Dieter Wellershoff 2000-2010 241 Leseprobe: Werner Jung Geglücktes Unglück Dieter Wellershoffs gefährliche Literatur Literatur ist entweder gefährlich oder trivial. Man könnte auch sagen, daß sie nur als gefährliche existiert. Im anderen Falle bleibt sie bloße Konfektionsware, die sich zwar gut verkaufen und konsumieren läßt, aber restlos dann auch verschwindet – im besten Fall im und als Altpapier. „Literatur, die etwas taugt, ist gefährlich“, schreibt Dieter Wellershoff an einer Stelle seines Buches „Der verstörte Eros. Zur Literatur des Begehrens“, „denn sie rührt an die Sprengsätze der menschlichen Existenz. Sie kann gefährlich sein für den Leser, weil sie ihn mit Erfahrungen konfrontiert, die er in den Routinen und Begrenzungen seines alltäglichen Lebens gewöhnlich zu vermeiden versucht. Und sie ist vor allem gefährlich für den Autor, der sich […] in ihrem Dienst auf eine Höllenfahrt begibt, dabei allerdings in ihr einen mächtigen Schutz genießt. Denn in ihr verwandelt er auch die Irrtümer, Niederlagen und Verletzungen seines Lebens in eine Erfahrung der Kompetenz.“ Und eben darauf kommt er auch im Gespräch mit Heinrich Deserno (in diesem Band) immer wieder zurück. Literatur ist für alle, die sie betrifft, gefährlich – wenn auch auf unterschiedliche Weise, wenn auch in verschiedenen Intensitäten. Es geht schließlich um die Existenz. Der Autor schreibt um sein Leben, und dem Leser geht dabei möglicherweise ein Licht auf: Ach, so ist das – so könnte man die Dinge auch betrachten. Literatur, darauf hat Dieter Wellershoff schon früh in poetologischen Reflexionen hingewiesen und mit Nachdruck insistiert, stellt so etwas wie einen ,Simulationsraum‘ oder eine ‚Probebühne‘ dar, auf der lebenswichtige, noch radikaler: überlebensnotwendige Probleme und Konstellationen verhandelt werden. Literatur ist nicht das Leben, sondern – um eine Formulierung Georg Simmels hier zu verwenden – immer ,Mehr-Leben‘ und ,Mehr-als-Leben‘. Denn in ihr wird das Leben verschärft, werden krisenhafte Momente und Situationen aufgezeigt, werden Fallgeschichten und Geschichtsfälle demonstriert. In anderen Worten und recht verstanden: Literatur im Sinne Dieter Wellershoffs vermittelt Aufklärung über das Leben, Aufhellungen über jenes „Dunkel des gelebten Augenblicks“, in dem ich im Blick auf eine bekannte Formulierung des jungen Ernst Bloch auch die Texte des Kölner Schriftstellers verorten möchte. 8 Der Erzähler, Medienautor und Essayist Dieter Wellershoff nimmt sich, so könnte man den Grundimpuls für sein Schreiben bezeichnen, des Lebens gerade dort an, wo es penetrant aufdringlich, nämlich zu nahe ist, wo die Gegenwart zum schädlichen Raum (Georg Lukács) wird und Alltäglichkeit zur Last fällt. In der Sprache der Medizin: Wellershoffs Texte – und man könnte die frühen Hörspiele daraufhin ebenso durchmustern wie die späteren Fernsehspiele, die Erzählungen und Novellen, schließlich alle Romane, nicht zuletzt das sog. ‚Spätwerk‘ – diagnostizieren Lebenskrisen; die Protagonisten – und ich scheue mich hier, von Figuren zu sprechen, weil sie aufklärerischen wie realistischen Eingedenkens Menschen nachgebildet, also nicht bloß ausgedacht sind – haben massive Probleme: mit sich selbst und/ oder ihren Partnern, mit der Umwelt oder der ganzen Gesellschaft. Daher täte man gut daran, sich einer traditionellen ästhetischen Kategorie wiederzubesinnen: nämlich der des Typus, womit bekanntlich keine Typen oder Stereotypen gemeint sind, sondern vielmehr jene Art von Helden, deren besondere Probleme zugleich etwas über den Stand und Zustand gesellschaftlicher Befindlichkeiten auszusagen in der Lage sind. Wir brauchen hier nur an Wellershoffs Romane seit den sechziger Jahren zu denken, um die Idee bzw. Kategorie des Typus mit dem Fleisch gesellschaftsgesättigter Erfahrung zu füllen: Es beginnt mit „Ein schöner Tag“ (1966) und der minutiösen Beschreibung einer Dreierkonstellation, einer Rumpffamilie, in der sich Vater, Sohn und Tochter unter Vorspiegelung falscher Tatsachen und konventioneller Höflichkeiten tatsächlich bis zur völligen Entfremdung auseinandergelebt haben; der Protagonist aus der „Schattengrenze“ (1969) hat sich in dunkle Machenschaften und Geschäfte verstricken lassen und bewegt sich jetzt wirklich wie – einer beginnenden Schizophrenie zufolge – auch im Imaginären in einem Grenzbereich; Kommissar Bernhard in „Einladung an alle“ (1972), in seiner Lebensmitte angekommen, beruflich zwar erfolgreich und familiär gesichert, spürt doch dunkel, daß er auf der Stelle tritt, daß sein geplantes Buch nicht vorankommen will und daß einzig noch in der Jagd auf den Kleinkriminellen Findeisen die Chancen für sein weiteres Voranleben liegen; Klaus Jung dagegen in „Die Schönheit des Schimpansen“ (1977) leidet an einer tiefen Kränkung und Schmach, die – weil nicht verarbeitet – eruptiv aufbricht und ihn zum Mörder einer Unbekannten und schließlich zum Selbstmörder werden läßt; Ulrich Vogtmann aus „Der Sieger nimmt alles“ (1983) wiederum sieht jahrzehntelang wie der ewig strahlende Siegertyp aus, der sich alles nimmt und dabei noch vergoldet, bis ihn windige Partner und riskante Geschäfte um Werner Jung 9 alles bringen, um sein Firmenimperium, die Familie und das eigene Leben; das Quartett aus „Der Liebeswunsch“ (2000), diese beiden so ungleichen Paare, können tun und lassen, was sie wollen, sie stecken doch in den falschen Beziehungen, wobei es müßig ist, darüber zu sinnieren, ob und wie es für sie anders, besser oder richtig gelaufen wäre. Es ist, wie es ist, wie das Leben halt so spielt und einem mitspielt. Dieter Wellershoff spitzt die Dinge zu, verschärft die Konflikte zu Existenzkrisen, in denen plötzlich etwas aufscheinen kann: eine intuitive Erkenntnis, die Einsicht, daß da etwas völlig verfahren ist, daß ein Lebensentwurf sich als Illusion herausstellt, daß die romantische Liebesvorstellung (Du oder keine) eine schmerzliche Täuschung und die auf Prosperität abzweckende Biographieplanung vielmehr ein einziges grandioses Desaster gewesen ist. Für die Helden kommt diese Einsicht als Erfahrung jedoch meist zu spät. Nur wir – Autor wie Leser – haben das Glück, diese (oder noch andere) Erfahrungen zu machen und dann bereichert wieder aus dem Text ins wirkliche Leben zurückzukehren. Hat so nicht auch das begonnen, was wir uns seit dem mittleren 18. Jahrhundert angewöhnt haben, Aufklärung zu nennen? Erinnern wir uns nur daran, daß es auch da – etwa bei Lessing – keine strahlenden Helden, keine blanken „Kopiervorlagen“ (Luhmann) für richtige Verhaltensweisen gegeben hat. Nein, es handelte sich auch seinerzeit schon um „problematische Helden“ (Lukács), um vertrackte Beziehungen und schwierige Verhältnisse. Und es ging weiter auch darum, die Rezipienten, Zuschauer wie Leser, mitzubeteiligen, sie durch Empathie mitempfinden und -leiden zu lassen. Dem ästhetischen Wirkungspostulat gebürte der erste Rang. Zeitgenössische Quellen wissen davon zu berichten, daß bei der Aufführung etwa von „Miß Sara Sampson“ die Tränen in Strömen geflossen sind. Doch Lessing wollte zweifellos noch weit mehr; er wollte sein Publikum zur Reflexion anstiften, zum Nachdenken darüber, was warum und wie schiefgelaufen war – in diesem Stück, im Leben. Das Mitleiden bildete sozusagen erst die innere Voraussetzung für nachträgliche Gedankenarbeit. Ohne Empathie, ohne dasjenige, was man in moderner Terminologie auch ruhig existentielle Betroffenheit nennen darf, ist Reflexion nicht möglich, Kommunikation unmöglich. Denken wir daran, daß Aufklärung auch als ein Kommunikationsprozeß verstanden werden muß. Mit einem großen Sprung über die Jahrhunderte hinweg ließe sich sagen, daß, auch wenn sich das naive Wirkungspostulat der Aufklärung heute verloren hat bzw. verwässert worden ist, zum Grundbestand ästhetisch- Geglücktes Unglück 10 poetologischer Überzeugungen im Prozeß der Moderne weiterhin gehört, daß Literatur ihre Leser betreffen und betroffen machen muß, daß jegliches Nachdenken und jede Diskussion um jenen Punkt gravitiert, der da heißt: Es geht auch um dein Leben! Jean-Paul Sartre hat – vielfach mißverstanden – diesbezüglich vom Engagement der Literatur gesprochen; darunter sollte man, wie Lothar Baier in seinem Essay „Was wird Literatur?“ (2001) formuliert hat, eine Art Vermittlung verstehen. Schreiben meint, so Baier weiter, ein „veränderndes Enthüllen“, das in Richtung auf einen in der Zukunft zu schaffenden Zustand zielt; hierzu bildet Lektüre, wo sie zur kritischen Reflexion aufgespannt wird, das Scharnier. Am Ende stehen wieder – so oder so – das Leben und die Praxis. Noch einmal Lothar Baier: Literatur ist eine „durch anderes nicht ersetzbare Form von Welterkenntnis und Reflexion“. Von hier ist der Weg zum Werk und Denken Dieter Wellershoffs nicht weit. Denn die Überlegungen von Sartre wie von Baier berühren sich an vielen Punkten auch mit denen des Kölner Schriftstellers, den der Rezensent und Kritiker Baier seit frühen Tagen überaus geschätzt und gewürdigt hat. Ich verweise an dieser Stelle nur auf die beiden großen Bücher „Der Roman und die Erfahrbarkeit der Welt“ (1988) und „Der verstörte Eros“ (2001). Sie liefern nicht nur in systematischer Hinsicht eine Poetik des modernen Romans seit Cervantes, sondern auch noch eine in ihrer Fülle und Reichhaltigkeit an Einzelinterpretationen beeindruckende Geschichte der Gattung, ja bieten darüber hinaus eine bündige Motivgeschichte an. Der moderne Roman kann und muß zum einen gelesen werden als Roman der Krise, als Darstellung und Inszenierung fortschreitender Entgrenzungen unserer Wahrnehmung, also: als Schule des Sehens, allgemeiner noch: als Schule unseres gesamten menschlichen Empfindungsapparats; zum anderen und oftmals zugleich entfaltet dieser moderne Roman auf dem thematischen Feld von Liebe und Liebesverrat, in der Region sexuell bestimmter zwischenmenschlicher Beziehungen, sein besonderes Profil. Vor allem in dem Essayband „Der verstörte Eros“, der so etwas wie Wellershoffs eigene private Lektüre-Hitliste vorstellt, plausibilisiert er in einer Vielzahl luzider Interpretationen die These, wonach sich, nachdem die aufklärerische Idee einer partnerschaftlichen Beziehung der Geschlechter samt nachfolgendem romantischem Liebescode verabschiedet worden ist zugunsten überaus hypertropher ldeologeme, das Themenbündel Liebe, Sexualität, Ehe und Ehebruch mäandernd durch die europäische Literatur zieht. Am Ende, nämlich dieser Tage, stehen wir mit Autoren wie Houellebecq oder Werner Jung 11 Bret Easton Ellis vor einem einzigen Scherbenhaufen, ist dasjenige, was als Desillusionsromantik im 19. Jahrhundert mit Stendhal, Balzac oder Flaubert begonnen hat, schließlich verabschiedet worden: „Das Glücks- und Erfolgsprogramm der herrschenden Kultur“, so Wellershoff im Blick auf die Romane des Franzosen Houellebecq, „das sich mit einem letzten Schub in den sechziger und siebziger Jahren auf breiter Front gegen die traditionelle bürgerliche Verzichtsmoral des 19. Jahrhunderts durchgesetzt hat“, werde „zu einer inhumanen Ideologie erklärt, die einen dunklen Untergrund erzeugt und es zugleich durch den Talmiglanz einer umfassenden Selbstwerbung verbirgt.“ (Vgl. dazu auch den Essay von Georgeta Vancea.) Mir scheint, daß hierin nicht allein der Leser und Interpret, ein – im übrigen glänzender – Essayist, spricht, sondern zugleich auch wieder der Schriftsteller Wellershoff, dessen literarisches OEuvre, allem anderen voran die Romane, im Sinne einer ‚Negativen Dialektik‘ darum kreist, Geschichten aus dem wirklichen Leben zu erzählen: Geschichten über den Beziehungswahn und Alltagsirrsinn, über „Glücksucher“ und andere „Flüchtige Bekanntschaften“, über „Die Körper und die Träume“ (alles Titel Wellershoffscher Bücher), über alles in allem – und hier ist der Roman selbigen Titels Stichwortgeber, Höhepunkt und Zusammenfassung zugleich – den unstillbaren „Liebeswunsch“. Wer ist diese junge Frau Anja, die sich am Ende des Romans rücklings über eine Balkonbrüstung im 14. Stock stürzt? Sie will Schluß machen, für immer. „Schluß mit den Täuschungen, den Demütigungen, der Angst und der eigenen Schwäche“, wie es heißt. Was hat sie in diese ausweglose Lage gebracht? – „Manchmal denke ich, daß ich nicht sie erklären muß, sondern mich, mein Interesse an ihr, das so spät, fast sechs Jahre nach ihrem Tod, wieder in mir erwacht ist.“ Das ist der erste Satz des Romans „Der Liebeswunsch“. Wer spricht hier, und welches Geheimnis verbirgt sich dahinter? Sogleich wird der Leser in einen Sog gezogen, für den die Wellershoffschen Texte bekannt und nachgerade berüchtigt sind, ein Sog, aus dem man sich nur schwer befreien kann – selbst am Ende nicht, als die Geschichte vermeintlich aufgelöst ist und sich die Strukturen geklärt haben. Köln in den neunziger Jahren, genauer noch: das Köln des gehobenen Bürgertums, der Ärzte und Anwälte, Akademiker und Kulturschickeria. Der diskrete Charme der Bourgeoisie halt. Hier spielt sich das Leben der vier Protagonisten ab: des Richters Leonhard, der nach einer gescheiterten Ehe mit der Ärztin Marlene eine neue Verbindung mit der wesentlich jüngeren Anja eingegangen ist, und des ebenso erfolgreichen Chirurgen Paul, der nun mit Geglücktes Unglück 12 Marlene zusammenlebt. Doch nicht nur die Freundschaft der beiden Paare steht auf schwankendem Boden, stellt, in den Worten Pauls, eine immer brüchiger werdende Konstruktion vor, nachdem er, Paul, sich Anja zeitweise zur Geliebten genommen hat, nein, mit fortschreitender Geschichte erweist sich einmal mehr, daß die Erwartungen und Hoffnungen aller Figuren, ihre auf Liebe und Partnerschaft setzenden Lebensplanungen, zum Scheitern verurteilt sind, weil sie zufällig an die falschen Personen geraten. Die längste Zeit macht man sich daher etwas vor, sich selbst und dem oder den anderen – vergeblich, denn mit Macht widersetzt sich die Realität mit ihren Forderungen und Ansprüchen dem schönen (tatsächlich aber bloß: häßlichen) Schein, zerstört die Idiosynkrasien und durchlöchert die Lebenslügen. Nicht bloß Anja, die ohnehin von Anfang an wie ein Fremdkörper in dieser besseren – soll man gar sagen: in der feinen? – Gesellschaft gewirkt hat, büßt ihr Leben ein, auch die anderen bleiben mehr oder weniger auf der Strecke: als Gefühlskrüppel, hart und gepanzert wie Marlene, die sich auf ein Singledasein eingerichtet hat, oder auf der anderen Seite infantil-flatterhaft wie Paul mit seinen kurzfristigen Affären; endlich noch Leonhard, der, tief gekränkt, von der Ehe als einem gescheiterten Projekt spricht und sich zurückzieht. Es existieren wohl diese Punkte im Leben, an denen es, wie es Paul einmal dämmert, „nichts Richtiges mehr gibt“ und alles, was man sagt oder tut, einfach falsch ist. Und mit Sicherheit ist es weiterhin so, wie sich Marlene einmal äußert, daß „Gewohnheit und Praxis“ eine „Schutzschicht“ ausbilden, die im Alltag zwar Bedrohliches abwehrt, um dahinter oder darunter aber noch weit gefährlichere Bezirke aufklaffen zu lassen. Ob das Glück eben immer bloß anderswo weilt? No way out – wie weiter? Welcher Leser und welche Leserin finden darauf die Antwort? Die Erzählsammlung „Das normale Leben“ (2005) steht wieder ganz auf der Linie seines Lebenswerks; im Vordergrund rangiert jenes normale Leben, das sich zwischen den Pendelausschlägen von Alltäglichkeit und Ausbruch, von Gewohnheit und Gewöhnlichkeit einerseits, dem Wunsch und Begehren nach der Alternative und den Wonnen des Augenblicks andererseits abspielt. Es geht darum, diese Balance zu finden zwischen Norm und Abweichung. Zwischen einem Alltag, der ebenso Stagnation wie auch ein ‚pièce de resistence‘ darstellt, und der unstillbaren Sehnsucht nach dem ganz anderen – dem glücklichen Augenblick, einem Moment des Ausbruchs aus dem Gehäuse der Hörigkeit. Die meisten der zehn Erzählungen – darunter drei umfangreichere mit 50 bis 70 Seiten – handeln von älteren und alternden Menschen, Männern Werner Jung 13 und Frauen, die sich an Stationen ihres Lebens- und Liebesgeschicks erinnern, die versuchen, die komplizierten privaten Dramaturgien und Beziehungskonstellationen zu ordnen oder auch verstehen zu wollen, und die sich nicht zuletzt daran abarbeiten, die bekannt-unbekannte „Dunkelheit des gelebten Augenblicks“ aufzuhellen. Oder, wie Wellershoff in „Das Sommerfest“, der längsten Erzählung, an einer Stelle selbst schreibt: „Wie es zu Hause war, wußte man nicht. Das Private war eine Dunkelkammer. Nicht immer nur für die anderen. Die Dunkelkammer der Sprachlosigkeit.“ Ja, dieses normale Leben steht auf dem Prüfstand, wird, wie z.B. in der Titelgeschichte, bilanziert: da finden sich die verschiedenen Beziehungen zu Frauen, Krankheiten und Tod, da ist ferner von der Konfrontation mit einem 26jährigen Selbstmörder die Rede, dessen Tagebuchaufzeichnungen der alternde Protagonist zur Durchsicht erhält und nach deren Lektüre er wieder einmal bestätigt wird in seiner lebensphilosophisch-existenzialistischen Sicht der Dinge: „Leben ist der Wert schlechthin. Alle anderen Werte sind davon abgeleitet.“ Sollte man das Ende dieser Geschichte schließlich nicht gar als Lebensmaxime, als Quintessenz auch aller anderen Wellershoffschen Geschichten lesen? Nämlich aus Einsicht in die Begrenztheit des Lebens überhaupt, und des eigenen allzumal, nichtsdestotrotz unbeirrt gerade deshalb an ihm festzuhalten: „Er stand, umgeben von Stille, in diesem Gedankenwirbel, der ihn aufwühlte, aber sich allmählich von selbst ordnete. Er war ein alter Mann, der auf Abruf lebte, versehen mit der Weisung, noch einmal und solange es ging in sein normales Leben zurückzukehren. Wie auch immer es lief: Er hatte Grund, das zu feiern.“ Dieter Wellershoffs letzter Roman „Der Himmel ist kein Ort“ (2009) erzählt von einem jungen evangelischen Pfarrer, Ralf Henrichsen, der nachts zu einem Verkehrsunfall mit tragischem Ausgang gerufen wird, um seelsorgerisch den überlebenden Fahrer eines Unfallwagens zu betreuen. Der Wagen ist unter ungeklärten Umständen von der Straße abgekommen und in einen Baggersee gefahren: Die Frau des Fahrers ist ums Leben gekommen, ihr gemeinsames Kind überlebt – mit schwersten Schäden. Völlig apathisch reagiert der Ehemann und Vater. Auf diesem Hintergrundtableau entwickelt Wellershoff einen Erzähltext, dessen Dramaturgie neben den äußeren Geschehnissen und den in der Gemeinde fortan grassierenden Diskussionen wie Verdächtigungen – hat dieser Karbe möglicherweise seine Frau aus Eifersucht oder anderen Motiven umgebracht? – vor allem um die Entwicklung des jungen Pfarrers kreist. Durch das dramatische Ereignis muß er sich Geglücktes Unglück 14 einmal mehr fragen, wie es um seinen eigenen Glauben bestellt ist, ja, um Glaubensfragen insgesamt und auch die Trostfunktion, die ein Priester und Seelsorger überhaupt zu leisten imstande ist. Hart packen ihn grundsätzliche Zweifel an, plagen ihn Ängste und Nöte, die er in Gesprächen mit Freunden und Kollegen, intensiv dann auf einer Tagung diskutiert: Plötzlich, so gesteht er einem Kollegen, habe er denken müssen, daß alles, was in der Bibel steht und woran er immer geglaubt hat, nicht mehr gelte. „Weder die Erschaffung von Himmel und Erde durch Gott noch seine eigene Existenz. Und auch nicht die Auferstehung Christi, seine Himmelfahrt und seine Wiederkehr beim Jüngsten Gericht. Nichts war mehr da.“ Mit dem Resultat, daß er folglich alles für Fiktionen hält, was er den Menschen erzählt. Gerade die seiner Meinung nach krampfhaften, zuweilen geradezu grotesk-lächerlichen Versuche der Amtskirche, den Glauben durch populäre Aktionen den Menschen wieder näherzubringen und schmackhaft zu machen, bestärken ihn weiter in seinem Zweifel, der darin gipfelt, daß er seinem Freund einbekennt: „Uns fehlen die Worte und die Wahrheiten und der Glaube. Wir simulieren nur.“ Dennoch – es gibt daneben auch noch eine andere Geschichte. Im Subtext des Romans scheint noch eine Nebenhandlung auf; sie erzählt von einer gekränkten und enttäuschten 50-jährigen Frau, die ihre Faszination von dem jungen Priester durch Briefe an ihn ausdrückt und endlich die Aufforderung zu einem Kennlern-Besuch ausspricht. Henrichsen, dem die Frau ebenfalls aufgefallen ist in einem Moment seiner Predigt, „der sie beide, so fremd wie sie einander waren, für Sekunden zu einer Einheit verschmolzen hatte“, läßt sich auf das Angebot ein, reist zu der Fremden, riskiert das Abenteuer und wird mit der Lebensgeschichte einer Frau konfrontiert, die das Leben im goldenen Käfig aufgegeben hat und nun nach neuer Orientierung sucht – jedoch tief in ihren Zwängen verfangen ist, wie Henrichsen am Ende einer langen Nacht glaubt festgestellt zu haben. Darin ähnelt sie ihm, und das, so motiviert er seine wortlos-überstürzte Verabschiedung von der noch schlafenden Frau, ist ihm einfach zu viel. Er kehrt zurück in seinen Alltag, erfährt, daß sich Karbe das Leben genommen hat, und fühlt sich nun endgültig „vollkommen leer“. „Alles war, wie es war. Zu ändern war nichts.“ Scheinbar resigniert macht er weiter, kompensiert die innere Leere durch äußere Betriebsamkeit und Hektik im Amt. Bisweilen „hatte er das Gefühl, dass er mit allem, was er tat, einen Schutzwall gegen eine ständig drohende Formlosigkeit und einen schleichenden Verfall zu errichten versuchte.“ Werner Jung 15 In der andauernden Suche nach Antworten könnte vielleicht beschlossen liegen, was Wellershoff verschiedentlich als Wahrheit der Literatur bezeichnet hat. Wahr nämlich ist sie dann, wenn der Leser „durchgerüttelt“ wird, wenn seine „ganze Person“ in Bewegung gerät, wobei er durchaus, so Wellershoff im Gespräch mit Michael Fabian 1978, „ruhig einmal untergehen“ mag. Die Wahrheit der Literatur – das ist ihre Referenz. Literatur, noch einmal, ist gewiß nicht das Leben, sondern vielmehr ebenso immer ,Mehr- Leben‘ wie ,Mehr-als-Leben‘. Sie ist Lebensdeutung, insofern sie an der Erschließung verborgener Möglichkeiten mitarbeitet. Und etwas anderes als das Leben, als unser je eigenes Leben haben wir nicht. Nach uns die Sintflut. Wellershoff am Ende seiner Frankfurter Poetikvorlesungen aus dem Jahre 1996, die unter dem Titel „Das Schimmern der Schlangenhaut“ erschienen sind: Es gebe keinen Grund, sich vom Leben „abzuwenden und den Anblick seiner dschungelhaften Dichte, seiner Widersprüche und Unberechenbarkeiten gegen den Schematismus konstruierter Weltmodelle oder die Illusionen künstlicher Paradiese einzutauschen“. Dieter Wellershoffs Literaturverständnis ist ebenso produzenten- wie rezipientenorientiert; die Vorwürfe fürs Schreiben folgen seinen „Gegenständen des Interesses“, wie eine kleine Szenenfolge von Notaten, Aphorismen, Gedankensplittern und kurzen Erzählungen von 1985 heißt. Immer bildet das Leben dabei den dunklen Untergrund, ist es dasjenige, was Wellershoff eine Erfahrung nennt, das im Schreibprozeß dann verarbeitet, verdichtet und konzentriert wird. Das Leben, Welt und Gesellschaft, dies bringt Wellershoff als zentrale biographische Erfahrung nach Faschismus und Weltkrieg (vgl. dazu den autobiographischen Text „Der Ernstfall“ [1995]) als Hypothek in die neue demokratische Nachkriegsgesellschaft des Westens mit, müssen als offene dynamische Systeme begriffen werden. Es gibt keine Steuerungszentren, keine Teleologie, auch keine verbindliche transzendentale Heimat mehr für den einzelnen. Statt dessen existiert ein unübersehbares Beziehungsgeflecht aus Interaktionen, ein großer Wechselwirkungszusammenhang – mit Georg Simmel und der modernen Soziologie zu sprechen. Und das Leben, das wir tatsächlich führen – jeder einzelne von uns –, „stellt nur eine besondere und in mancher Hinsicht zufällige Auswahl aus einem weiten Horizont unaktualisierter Möglichkeiten dar“. Um so wichtiger, ja notwendiger erscheint deshalb die Literatur, das ‚literarische Feld‘ (Pierre Bourdieu), da auf ihm – insbesondere in der komplexesten Form des Romans – alternative Möglichkeiten und Spielräume vorgeführt, also: simuliert werden können. Der Autor erzählt Geschichten, in Geglücktes Unglück 16 denen Fragehorizonte, blinde Stellen und offene Probleme aufscheinen, die beim Leser für produktive Verunsicherungen sorgen. Keine letzten Worte, wohl aber möglicherweise eine prägnante Verdichtung für seine Ansichten über die Literatur und das Leben, die Welt und den einzelnen in ihr hat Dieter Wellershoff an einer Stelle seiner Böll-Preisrede aus dem Jahre 1988 geliefert. Da heißt es: „Ich stelle mir manchmal die Aufgabe, in einer vom Zufall durchmischten Welt zu leben, im Bild eines Kartenspiels vor. Man zieht gute und schlechte Karten, Vor- und Nachteile, Glücksund Unglücksfälle, Gaben und Handikaps in einer zufälligen Mischung und Reihenfolge und muß nun versuchen, damit sein Spiel zu machen. Allmählich kann man vielleicht Ordnung in das Chaos bringen und seinem Spiel eine Richtung, eine eigene Logik geben. Doch das entstandene Muster kann stets durch neue Herausforderungen durchkreuzt werden, die die Zukunft offen halten als ein Feld unterschiedlicher Möglichkeiten.“ In diesem Sinne möchte man dem Autoren zurufen, daß er dem vorliegenden Werk noch weitere Bücher hinzufügen soll, daß er seinen Lesern noch viele dieser unterschiedlichen Möglichkeiten zeigen, daß er sie mit weiteren „krisenhaften Situationen“, die uns ja, wie es im Essay „Double, Alter ego und Schatten-Ich“ (1991) heißt, nicht nur herausfordern, sondern, wo sie uns existentiell betroffen reagieren lassen, mit einem „Horizont verschiedener Möglichkeiten“ konfrontieren und damit endlich mit „eine[r] Erfahrung, die beängstigend und befreiend sein kann“. Werner Jung Literatur als Erfahrung Heinrich Deserno im Gespräch mit Dieter Wellershoff Deserno: Herr Wellershoff, beim Lesen Ihrer Texte empfinde ich oft einen Sog, der mich antreibt schneller zu lesen, wahrscheinlich, weil ich wissen will, worauf das Geschehen hinausläuft. Gleichzeitig aber fühle ich mich genötigt innezuhalten, um zu verstehen, was da im Inneren oder in der Tiefe der Figuren gerade geschieht. Die dargestellten Personen reagieren oft zwiespältig und keineswegs immer situationsgerecht. Sie machen Erfahrungen mit sich selbst, scheinen sich aber gegen Erkenntnisse zu sträuben. Wellershoff: Nicht alle verhalten sich gleich. Manche reagieren im Schema ihrer sozialen Rolle. Andere sind aufgewühlt, irritiert, stehen unter emotionalem Zwang. Ihre Wahrnehmung der Situation ist perspektivisch verzerrt. Vielleicht machen sie etwas Entscheidendes falsch, vielleicht sogar, obwohl und während sie das begreifen. Das glaubhaft und intensiv darzustellen, kann nicht damit verbunden werden, dem Leser eine komfortable Position der Überlegenheit einzuräumen. Ich glaube, darauf spielten Sie an, als Sie vom Sog der Texte sprachen. Nach meiner Vorstellung vom Erkenntnispotenzial der Literatur müssen die Leser in die Situation der handelnden Personen verstrickt werden und mit ihnen in die Bedrängnis und das Dunkel des gelebten Augenblicks hineingeraten. Denn das ist die Ausgangsituation, um neue Erfahrungen zu machen. Aber die sind nicht vorprogammiert. Der Autor entfaltet die Widersprüche und die Probleme, aber er resümiert nicht. Deserno: Das erinnert mich an den Roman „Der Sieger nimmt alles“. Er endet mit dem Tod der Hauptfigur und mit dem Satz „Was wir jetzt erleben, sind nur die Vorspiele.“ Wellershoff: Ja, ein gescheitertes Leben bricht ab und das Ganze geht weiter. Ich denke, das war 1983, als der Roman erschienen ist, ein vorausschauender Satz, denn die 18 wirtschaftlichen Probleme, an denen Ulrich Vogtmann, die Hauptfigur des Romans, gescheitert ist, haben sich inzwischen vervielfacht und gesteigert. Deserno: Der offene Romanschluss – Ihre bevorzugte Dramaturgie – definiert die Zukunft als den Raum der noch ungewissen Möglichkeiten. Wellershoff: Ja, und das versteht den Menschen als ein Wesen, das träumt und plant und sein Leben als sein persönliches Projekt versteht. In der Literatur führt er sich das vor Augen und spielt es mit allen möglichen Konsequenzen durch. Deserno: Sie sprechen aber jetzt nicht von der Sonderform des Zukunftsromans? Wellershoff: Nein, die interessiert mich nicht. Sie ist mir zu abstrakt. Deserno: In der Psychoanalyse gibt es das Konzept und Modell einer psychischen Realität. Sie wird oft auch innere Realität genannt. Freud hat sie und ihre unbewusste Wirkung an den Träumen, den Symptombildungen und den Fehlleistungen kenntlich gemacht. Auch im Inneren Ihrer Personen sind Motive am Werk, die ihr Verhältnis zu den anderen Menschen und zu sich selbst bestimmen und beeinträchtigen. Die Personen erkennen das manchmal oder ahnen es, sträuben sich aber gegen solche sie irritierenden und bedrängenden Erfahrungen. Wellershoff: Das ist ein Ausdruck von Unsicherheit und Scham angesichts gefühlter eigener Defizite und verbotener Tendenzen und der damit verbundenen Angst vor abschätzigen Blicken. Deserno: Das ist etwas Alltägliches, dass wir uns in schwierigen Situationen zu stabilisieren versuchen, indem wir Unsicherheit, Scham und Ängste abwehren bzw. verdrängen. Heinrich Deserno im Gespräch mit Dieter Wellershoff 19 Wellershoff: Abwehr bzw. Verdrängung ist allerdings ein Konzept, das seine Klarheit und Härte verloren hat, weil es überlagert worden ist von einem allgegenwärtigen psychologischen Diskurs in den Massenmedien, der unter den Vorzeichen von Aufklärung und Toleranz die Strenge und Härte der traditionellen Morallehren in eine flirrende Vielfalt von Nuancen und Alternativen aufgelöst hat. An die Stelle traditioneller, machtgestützter Autorität ist eine chronische, nervöse Ichbewusstheit getreten, die ständig nach neuen, aktuellen Orientierungen sucht. Deserno: Was bedeutet diese Subjektivierung des Weltbildes für die Literatur? Wellershoff: Schriftsteller müssen sich hüten, irgendeines der kursierenden Theoriekonzepte als Universalschlüssel zur Interpretation von Menschen zu benutzen. Das wäre literarisch genauso abstrakt wie eine vorpsychologische moralisierende Menschendarstellung. Auch die Psychoanalyse, die in ihrer Gründungszeit ein umwälzender Erkenntnisschock war, ist durch ihren Erfolg zu einem verbreiteten Allerweltswissen geworden, das für den durchschnittlichen Patienten wohl kaum noch die erschütternde Potenz einer existentiellen Offenbarung hat. Deserno: Im therapeutischen Gespräch stehen auch nicht die theoretischen Gerüste im Vordergrund, sondern die individuellen Nuancen und Besonderheiten der erzählten Erfahrung. Wellershoff: Das würde ich „das Literarische“ nennen. Die Nuance ist der Fingerabdruck der Literatur. Nichts, was individuell gesehen und erkannt wird, ist belanglos. Das gilt eben auch für das analytische Gespräch. Die Literatur scheut nicht das Alltägliche. Sie verwirklicht es durch eine Neubeschreibung und im Umweg über Krisen und Phasen der Fremdheit. Im existenzialistischen Denken ist das radikalisiert als Annäherung an das Nichts und an die Unumgänglichkeit des Todes. Der Wert des Lebens wird bewusst aus der Möglichkeit seiner Vereitelung. Literatur als Erfahrung 20 Deserno: So haben Sie Ihre Kriegserfahrung in Ihrem Buch „Der Ernstfall“ beschrieben. Sie waren an der Front, haben das tägliche Sterben erlebt, auch den Massentod in einem militärischen Desaster, bei dem Sie selbst verwundet wurden. Sie haben die Lazarette, die Massenflucht der Endphase, die Gefangenschaft erlebt. Und immer haben Sie sich gesagt: „Schau dir das an! Das ist der Krieg! Du bist in einem Krieg!“ Und als es vorbei war und Ihnen klar wurde, dass Sie nur durch eine Reihe unwahrscheinlicher Zufälle überlebt hatten und nun, Ihren Neigungen folgend, studieren konnten, haben Sie eine lang anhaltende Euphorie erlebt. Wellershoff: Mir war bewusst, dass ich ein kostbares Geschenk bekommen hatte, das ich auf keinen Fall vertun wollte. Deserno: Dazu fällt mir eine andere Geschichte ein. Ich will sie kurz zusammenfassen, obgleich ich noch nicht weiß, wie sie zu dem vorher Gesagten passt. Sie haben vor Jahren einmal unter dem Titel „Die Frage nach dem Sinn“ eine Rede vor Abiturienten gehalten und dabei eine denkwürdige Episode erzählt. Ein junger Mann hatte Sie unter dem Vorwand, Sie für eine Studentenzeitung interviewen zu wollen, besucht und nach einer Reihe von Fragen, die Frage gestellt, wegen der er wohl gekommen war. „Wie kann man denn leben, wenn man wie Sie an nichts glaubt?“ Er meinte damit die religiösen Heilsversprechungen: Gott, Himmelreich und Ewiges Leben. Sie haben geantwortet „Der Sinn des Lebens ist das Leben selbst.“ Er hat gesagt, das sehe er auch so und sich verabschiedet. Ein Jahr später haben Sie durch seinen Bruder erfahren, dass er sich umgebracht hat. Sie bekamen seine Tagebucheintragungen zu lesen, aus denen hervorging, dass es sich um einen sehr intelligenten Menschen handelte, dem nichts im Leben gelungen war, weder intellektuell, noch beruflich, noch sexuell. So schlimm es klingt: sein sorgfältig geplanter, symbolhafter Selbstmord war vielleicht das erste und zugleich letzte persönliche Projekt, das ihm gelang. Er hatte sich im Winter in einen verschneiten Wald gelegt, um zu erfrieren. Wellershoff: Irgendwo hatte er gelesen, dass man dabei in angenehme Träume versinkt. Heinrich Deserno im Gespräch mit Dieter Wellershoff 21 Deserno: Was glauben Sie? Waren vielleicht Ihre Bücher und Ihre Antwort Auslöser für seinen Selbstmord? Wellershoff: Auslöser vielleicht. Aber nicht die Ursache. Er hatte eine schwere, lebenshemmende Persönlichkeitsstörung. Aus seinen Tagebüchern ging hervor, dass er meine Bücher immer wieder in der Absicht gelesen hatte, sich so von seinen Ängsten und inneren Lähmungen zu befreien. Er hatte sich das zum Teil wie einen Trainingsplan vorgenommen. Deserno: Das aber funktionierte nicht. Wellershoff: Er war wohl ein bipolarer Mensch. In der Phase der Hochgefühle faszinierten ihn die dargestellten Konflikte und dramatischen Situationen. Wenn er depressiv war, wurde alles grau und er konnte nicht weiter lesen. Er hätte zu Ihnen gemusst, Herr Deserno. Allerdings hatte er schon eine abgebrochene Therapie hinter sich. Deserno: Am Ende Ihre Poetik-Vorlesungen „Das Schimmern der Schlangenhaut“ kommen Sie auch auf diesen jungen Mann zurück. Sie schreiben: „Freilich hätte ich nicht so kompakt auf seine Fragen antworten sollen … Vermutlich hätte ich nichts ändern können, aber es wäre besser gewesen zu sagen: Erzähle mir dein Leben!“ Wellershoff: Das stimmt. Deserno: Worin besteht Ihrer Meinung nach die Wirkung der Literatur auf den heutigen Leser? Wenn man von der Masse der bloßen Unterhaltungsbücher einmal absieht. Literatur als Erfahrung 22 Wellershoff: Die Menschen von heute wollen kein starres, autoritär verordnetes Weltbild vorgesetzt bekommen, sondern im Austausch mit anderen Menschen fortschreitende Erfahrungen mit sich und der Welt machen. Das psychoanalytische Gespräch ist ein solcher Erfahrungsprozess. Und das Lesen eines literarischen Textes auch. In meinem Verständnis ist die Literatur ein Medium zur Erneuerung und Vertiefung unserer Wahrnehmung des Lebens. Sie ist eine imaginäre Probebühne, auf der wir uns alle Möglichkeiten unseres Daseins vor Augen führen können: Glück und Unglück, Gelingen und Scheitern. Und die begrenzte Einmaligkeit unserer Existenz. Leben heißt sterben lernen und umgekehrt. Dass die literarischen Szenen fiktionale, imaginäre Geschehnisse sind, in denen – im Unterschied zu den antiken Arenen – kein wirkliches Blut fließt, vermindert die Angst und erleichtert die Einübung eines angstfreien Blicks für die Totalität des Lebens. Und dass das Leben, im Unterschied zu deterministischen Weltbildern, ein offenes System mit vielen verschiedenen möglichen Zukünften ist, fördert die Kreativität der Menschen und entspricht ihrem Wunsch nach einem selbst bestimmten Leben. Deserno: Nicht alle Menschen sehen und empfinden das so. Viele wollen auch an die Hand genommen und umsorgt werden. Unbestimmtheit, Unvorhersagbarkeit macht ihnen Angst. Oder anders gesagt: Lassen sich die Menschen überhaupt in solche aufteilen, die eher angstfrei aufs Leben zugehen und andere, die an die Hand genommen werden wollen? Hat nicht jeder von uns beide Tendenzen in sich? Wellershoff: Das bestreite ich nicht. Im Gegenteil – Angst ist ein wichtiger Bestandteil der menschlichen Realitätserfahrung, denn wir werden nackt und hilflos geboren und bleiben dauerhaft auf gegenseitige Hilfe angewiesen. Aber das Besondere am Menschen ist, dass er sich künstliche Risiken schafft. Es sind offenbar unverzichtbare, belebende Reize, auch wenn er nur die Rolle des Zuschauers hat. Deserno: Das gilt auch für die Szenarien der Literatur und ihre Leser? Heinrich Deserno im Gespräch mit Dieter Wellershoff 23 Wellershoff: Natürlich. Aber in ungeheurer Vielfalt mit großen Unterschieden. Deserno: Wie drückt sich das Verlangen nach neuen und verschärften Reizen im Text aus? Wellershoff: Durch inszenierte Krisen der Seh- und Denkgewohnheiten. Die Öffnung des Blicks für die zweite und dritte Möglichkeit. Und für schwierige, unerwartete Wendungen und Entwicklungen. Für den Zufall, der unsere Erwartungen und Pläne durchkreuzt. Das schärft auch die Aufmerksamkeit für das Unscheinbare, Unbestimmte, die noch im Werden befindliche Wirklichkeit. Deserno: Sind das bewusst eingesetzte, Spannung erzeugende Manipulationen des Textes? Wellershoff: Ja, es sind Textdramaturgien, die Mehrdeutigkeit und Unabsehbarkeit und dadurch vermehrte Aufmerksamkeit erzeugen. Aber sie sind nicht bloße Willkür, sondern Ausdruck einer sich erweiternden Erfahrung und zunehmender Komplexität. Ich kann nicht ohne Faszination schreiben. Oder um es genauer auszudrücken: Ich lasse mich leiten von dem Gefühl, ins Zentrum meiner Vorstellungsmöglichkeiten zu gelangen und etwas scheinbar Bekanntes neu zu sehen. Deserno: Das kann ich mir nicht ohne entsprechende Lebenserfahrung vorstellen. Wellershoff: Nein. Aber ich schreibe die Erfahrungen nicht einfach ab. Ich führe sie zusammen und setze sie neuen Umständen aus. Deserno: Sie haben vorhin schon einmal angedeutet, dass alle Ihre Bücher Variationen eines Grundthemas sind. Wie könnte man das beschreiben? Literatur als Erfahrung 24 Wellershoff: Am besten wohl mit einer Formulierung von Georg Lukacs aus seiner „Theorie des Romans“. Dort hat er die Grundproblematik der neuzeitlichen Romane auf die Formel gebracht, sie handelten alle von problematischen Individuen in einer komplexer werdenden Welt. Das ist eine Formulierung, welche die fortschreitende Individualisierung des Bewusstseins als krisenhafte Entfremdungserfahrung beschreibt und mit gleicher Triftigkeit und Aktualität auf Romane von Flaubert, Balzac, Tolstoi, Dostojewski, Conrad, Hamsun, Proust, Faulkner und viele andere anwendbar ist. Unter anderem auch auf meine Romane und Erzählungen. Ulrich Vogtmann aus „Der Sieger nimmt alles“, „Anja“ aus dem „Liebeswunsch“ und der Pfarrer Henrichsen aus „Der Himmel ist kein Ort“ sind solche „problematischen Individuen“, die an sich selbst und an der Wirklichkeit scheitern, in den beiden erstgenannten Fällen tödlich. Alle drei sind aber ganz verschiedene Menschen in extrem unterschiedlichen Milieus und nur auf der Ebene des zitierten Grundthemas miteinander verwandt. Deserno: Wie kommen Sie zu den vielen Geschichten Ihrer Erzählungen und Romane? Sind es Einfälle oder Erfahrungen? Sind es Geschehnisse, von denen Sie gehört haben? Wellershoff: Es gibt die verschiedensten Möglichkeiten. Man liest etwas, hört etwas, beobachtet etwas, erlebt etwas, erinnert sich an etwas. Das alles gehört zum Stimmengeräusch des Lebens, von dem man umgeben ist. Entscheidend ist das plötzliche Aufleuchten eines sich vertiefenden Interesses. Die Themen müssen sich einstellen – als eine noch unerschlossene Faszination. Ich will Ihnen erzählen, wie ich das Motiv meiner Novelle „Zikadengeschrei“ gefunden habe. Vor ungefähr zwei Jahrzehnten, als ich mit meiner Frau Urlaub am Spanischen Mittelmeer machte, zog im Nachbarbungalow ein seltsames Schweizer Ehepaar ein. Die Frau sahen wir nie. Sie verließ das Grundstück nur im Dunkeln. Ihr Mann, der immer allein zum Strand kam, erzählte uns nach ein paar Tagen den Grund. Seiner Frau, einer bekannten Schauspielerin, war bei einer Ohrenoperation der Trigeminusnerv durchtrennt worden. Das hatte ihr Gesicht in eine Zähne bleckende Fratze mit einem nach hinten gekippten Auge verwandelt. Wir haben sie nie zu sehen bekommen. Zehn Jahre danach musste ich plötzlich denken: wie wäre es, wenn ein Mann, der, Heinrich Deserno im Gespräch mit Dieter Wellershoff 25 wie ich damals, mit seiner Frau im Nachbarbungalow wohnte, sich von dieser entstellten Frau angezogen gefühlt hätte. Meine erste Reaktion war, dass das ein abwegiger Gedanke sei. Aber ich ermahnte mich, noch einmal über diesen Einfall nachzudenken und allmählich wurde er immer interessanter für mich. Ich sagte mir, dass das eine mögliche Ausnahmeerfahrung sei, die darauf beruhte, dass dieser Mann ein innerlich verletzter Mensch war. Und so erschloss sich mir Schritt für Schritt eine völlig neue unerwartete Perspektive, die ins Mythische hinab reichte und ein völlig anderes Licht auf die ganze Szenerie warf. Deserno: Das ist ein anschauliches Beispiel für die schrittweise Erschließung eines verborgenen Lebenstextes und durchaus vergleichbar mit dem psychoanalytischen Prozess. Aber wie verfahren Sie bei der Entstehung größerer Texte? Zum Beispiel beim Schreiben eines Romans. Machen Sie sich Übersichtspläne über den Handlungsverlauf und die Personen und ihre Beziehungen zueinander? Wellershoff: Einige Autoren tun das. Ich weiß es zum Beispiel von Heinrich Böll, von dem es große farbig angelegte Übersichtspläne über einige Romane, ihre Personen und Motive und den Handlungsverlauf gibt. Ich mache das nicht so. Denn ich möchte mich nicht in ein fertiges Konzept einsperren, sondern beim Schreiben offen für neue Erfahrungen sein. In der Regel, nicht immer, habe ich eine Vorstellung vom Anfang, ändere ihn aber manchmal nachträglich, indem ich zum Beispiel eine andere Perspektive an den Anfang setze. Ich kenne umrisshaft mein Thema und habe vielleicht den Schluss und die eine oder andere Szene vor Augen. Aber das Schreiben bleibt ein offener, sich selbst organisierender Prozess. Man macht etwas, und dabei zeigen sich neue Möglichkeiten und Aspekte, während sich andere, bisher angedachte Möglichkeiten verschließen. So wächst das Ganze, ständig kontrolliert und vorangetrieben durch eine Kette innerer Evidenzen, in seine endgültige Notwendigkeit hinein. Sie haben am Anfang unseres Gespräches vom Sog des Textes gesprochen. Ich denke, er ist das emotionale Spiegelbild des Sogs, dem der Autor beim Schreiben gefolgt ist. |
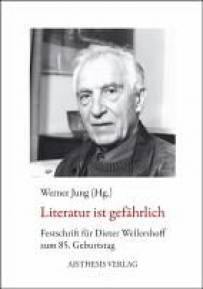
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen