|
|
|
Umschlagtext
Wenn Sie Linux installiert oder Zugriff auf eine UNIX-Version haben, sind Sie vielleicht bereits
vertraut mit der Umgebung und deren Konfiguration. Wenn Sie mit der Programmierung beginnen möchten, lassen die meisten Linux-Bücher Sie jedoch im Regen stehen. Dieses Buch beginnt dort, wo andere aufhören. Sie erfahren, wie Sie aus den von UNIX angebotenen Tools (die standardmäßig in allen Linux-Distributionen vorhanden sind) den größten Nutzen ziehen können, um mit echter UNIX-Programmierung zu beginnen. Die Autoren konzentrieren sich auf die C-Programmierung und untersuchen die CNU-Tools sowie die UNIX-C-Bibliothek. Dabei erlernen Sie in wohldurchdachten Schritten, wie Sie einen zweckmäßigen Applikationscode schreiben, aufbauen und debuggen. Im Verlaufe dieses Buches entwickeln Sie mit den Autoren eine voll funktionsfähige CD-Datenbankanwendung, in der die in der Theorie erläuterten Aspekte praktisch umgesetzt werden. Sie lernen die grundlegenden Dateioperationen, Ein- und Ausgabefunktionen und die Verwaltung von Daten unter UNIX kennen. Darüber hinaus erhalten Sie eine Einführung in tiefergehende Themen. Dazu zählen Interprozesskommunikation, Netzwerkbetrieb und die Verwendung von CGI-Skripten für den Aufbau einer Web-Schnittstelle - sämtliche Elemente für ein die Client/Server-Programmierung. Des Weiteren wird Ihnen das CTK-Tookit vorgestellt, und Sie erfahren, wie Sie mit GNOME grafische Oberflächen für X erstellen können. Schließlich werden Ihnen Einblicke in die Programmierung von Gerätetreibern vermittelt, durch die Sie die Funktionsweise des Linux-Kernels selbst besser verstehen können. Die Programmierung von Shell-Skripten mit der Bash-Shell darf ebenso wenig fehlen wie die Vorstellung zwei weitere, sehr leistungsfähiger Skriptsprachen, Tel und Perl. An wen wendet sich dieses Buch? Sie sollten mit den Grundlagen von Linux vertraut sein und umfassendes, praktisches Wissen über die Konfiguration des Systems besitzen. Darüber hinaus sind grundlegende Programmierkenntnisse von Vorteil. Wenn Sie mit den Basiskonzepten der Programmierung vertraut sind, erhalten Sie durch die praktischen Beispiele schnell das Selbstvertrauen zur eigenständigen Erforschung der Linux-C-Bibliotheken. Die in diesem Buch verwendeten Programmierwerkzeuge sind quasi in jeder Linux-Distribution zu finden. Für Ihren Start als Linux-Programmierer brauchen Sie daher nicht mehr als dieses Buch. Verlagsinfo
Dieses Buch ist eine betont praxisorientierte Schritt-für-Schritt-Anleitung für all diejenigen, die einen Einstieg in die vielfältigen Möglichkeiten der Programmierung unter Linux suchen. Werden zunächst die wichtigsten Programmierwerkzeuge wie der GNU C-Compiler, die Linux-Bibliotheken und Hilfedateien vorgestellt, stehen im weiteren Verlauf Themen wie die Shell- und X Windows-, Socket- und Systemprogrammierung sowie das Debugging im Mittelpunkt. Weitere Schwerpunkte bilden Kapitel über die Verwendung von Tcl/Tk unter Linux sowie über die Linux-Internet-Programmierung mit Hilfe von HTML und CGI. Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis Einleitung 31
Willkommen 31 Für wen ist dieses Buch? 31 Was steht in diesem Buch? 32 Was Sie wissen sollten 33 Quellcode 34 Konventionen 34 Wir legen Wert auf Ihre Meinung 35 Download-Möglichkeit bei www. mitp. de 35 Kapitel 1: Einführung 37 Was ist UNIX? 37 Was ist Linux? 38 Distributionen 38 Das GNU-Projekt und die Free Software Foundation 38 Linux-Programmierung 39 UNIX-Programme 40 Der C-Compiler 41 So erhalten Sie Hilfe 42 Organisationsplan des Entwicklungssystems 44 Programme 44 Header-Dateien 45 Bibliotheksdateien 46 Statische Bibliotheken 46 Gemeinsam genutzte Bibliotheken 49 Die UNIX-Philosophie 50 Einfachheit 50 Fokus 50 Wiederverwendbare Komponenten 50 Filter 50 Offene Dateiformate 51 Flexibilität 51 Zusammenfassung 51 Kapitel 2: Shell-Programmierung 53 Was ist eine Shell? 54 Pipes und Umleitungen 56 Die Ausgabe umleiten 56 Die Eingabe umleiten 57 Pipes 57 Die Shell als Programmiersprache 57 Interaktive Programme 58 Ein Skript erstellen 59 So wird ein Skript ausführbar 60 Shell-Syntax 61 Variablen 61 Anführungszeichen 62 Umgebungsvariablen 63 Parametervariablen 63 Bedingungen 65 Der Befehl test oder 65 Kontrollstrukturen 67 if 68 elif 68 Ein Problem mit Variablen 69 for 70 while 71 until 73 case 73 Listen 76 Blöcke von Statements 78 Funktionen 78 Befehle 81 break 82 Der Befehl : 82 continue 83 Der Befehl . 84 echo 85 eval 85 exec 86 exit n 86 export 87 expr 87 printf 88 return 89 set 89 shift 90 trap 90 unset 92 Befehlsausführung 93 Arithmetische Expandierung 93 Parameterexpandierung 94 Here-Dokumente 96 Skripte debuggen 98 Alle Aspekte verbinden 98 Anforderungen 99 Entwurf 99 Zusammenfassung 108 Kapitel 3: Mit Dateien arbeiten 109 Die UNIX-Dateistruktur 110 Verzeichnisse 110 Dateien und Geräte 111 /dev/console 111 /dev/tty 111 /dev/null 112 Systemaufrufe und Gerätetreiber 112 Bibliotheksfunktionen 113 Low-Level-Dateizugriff 114 write 114 read 115 open 116 Anfängliche Berechtigungen 117 umask 118 close 119 ioctl 119 Weitere Systemaufrufe für die Dateiverwaltung 121 lseek 121 fstat, stat and lstat 121 dup and dup2 123 Die Standard-I/O-Bibliothek 123 fopen 123 fread 124 fwrite 124 fclose 125 fflush 125 fseek 125 fgetc, getc, getchar 125 fputc, putc, putchar 126 fgets, gets 126 Formatierte Ein- und Ausgabe 126 printf, fprintf and sprintf 126 scanf, fscanf and sscanf 128 Weitere Stream-Funktionen 130 Stream-Fehler 131 Streams und Dateideskriptoren 132 Datei- und Verzeichnispflege 132 chmod 132 chown 132 unlink, link, symlink 133 mkdir, rmdir 133 chdir, getcwd 134 Verzeichnisse durchsuchen 134 opendir 134 readdir 135 telldir 135 seekdir 135 closedir 135 Fehler 138 Fortgeschrittene Themen 139 fcntl 139 mmap 140 Zusammenfassung 142 Kapitel 4: Die UNIX-Umgebung 143 Programmargumente 143 getopt 145 Umgebungsvariablen 147 Umgebungsvariablen verwenden 149 Die Variable environ 150 Uhrzeit und Datum 151 Temporäre Dateien 158 Benutzerinformationen 159 Weitere Benutzerinformationsfunktionen 162 Host-Informationen 162 Lizenzierung 164 Protokollierung 164 Konfigurieren von Protokollen 166 Ressourcen und Beschränkungen 168 Zusammenfassung 173 Kapitel 5: Terminals 175 Lesen vom und Schreiben auf das Terminal 176 Handhabung umgeleiteter Ausgaben 178 Mit dem Terminal sprechen 180 Der Terminal-Treiber und das General Terminal Interface 182 Überblick 182 Hardware-Modell 183 Die Struktur termios 184 Eingabemodi 185 Ausgabemodi 186 Steuermodi 186 Lokale Modi 187 Spezielle Steuerzeichen 187 Zeichen 188 Die Werte TIME und MIN 189 Von der Shell auf die Terminal-Modi zugreifen 189 Von der Kommandozeile Terminal-Modi einrichten 190 Terminal-Geschwindigkeit 191 Zusätzliche Funktionen 191 Terminal-Ausgabe 194 Terminal-Typ 195 Den Terminal-Typ identifizieren 195 Die terminfo-Eigenschaften verwenden 198 Steuerzeichenketten auf das Terminal ausgeben 200 Tastatureingaben erkennen 202 Pseudo-Terminals 205 Zusammenfassung 205 Kapitel 6: Curses 207 Mit curses kompilieren 208 Konzepte 209 Initialisierung und Terminierung 211 Ausgabe auf den Bildschirm 212 Vom Bildschirm lesen 212 Den Bildschirm löschen 213 Den Cursor bewegen 213 Zeichenattribute 214 Die Tastatur 216 Tastaturmodi 216 Tastatureingabe 217 Fenster 218 Die Struktur WINDOW 219 Generalisierte Funktionen 219 Ein Fenster verschieben und aktualisieren 220 Bildschirmaktualisierungen optimieren 224 Unterfenster 224 Keypad 227 Farben 229 Farben neu definieren 231 Pads 231 Die CD-Sammlungs-Anwendung 233 Zusammenfassung 247 Kapitel 7: Datenverwaltung 249 Die Speicherverwaltung 249 Einfache Speicherzuordnung 250 Große Speichermengen zuordnen 251 Speichermissbrauch 254 Der Nullzeiger 255 Den Speicher freigeben 256 Weitere Speicherzuordnungsfunktionen 257 Dateisperrung 258 Sperrdateien erstellen 258 Bereiche sperren 261 Der Befehl F_GETLK 262 Der Befehl F_SETLK 263 Der Befehl F_SETLKW 263 read und write beim Sperren verwenden 263 Konkurrierende Sperrungen 269 Weitere Sperrbefehle 272 Deadlocks 272 Datenbanken 273 Die dbm-Datenbank 273 Die dbm-Routinen 274 dbm-Konzepte 274 dbm-Zugriffsfunktionen 275 dbm_open 275 dbm_store 276 dbm_fetch 276 dbm_close 276 Zusätzliche dbm-Funktionen 279 dbm-delete 279 dbm-error 279 dbm-cleaerr 279 dbm_firstkey und dbm_nextkey 279 Die CD-Anwendung 281 Die CD-Anwendung nutzt dbm 282 Zusammenfassung 299 Kapitel 8: Entwicklungswerkzeuge 301 Probleme bei mehreren Quelldateien 301 Der Befehl make und Makefiles 302 Die Syntax von Makefiles 302 Optionen und Parameter für make 303 Abhängigkeiten 303 Regeln 304 Kommentare in einem Makefile 306 Makros in einem Makefile 306 Mehrere Zielobjekte 308 Integrierte Regeln 310 Suffixregeln 311 Verwalten von Bibliotheken mit make 312 Fortgeschrittenes Thema: Makefiles und Unterverzeichnisse 313 GNU-make und -gcc 314 Quellcodekontrolle 315 RCS 315 Der Befehl rcs 316 Der Befehl ci 316 Der Befehl co 317 Der Befehl rlog 318 Der Befehl rcsdiff 318 Revisionen identifizieren 319 Der Befehl ident 320 SCSS 321 Vergleich RCS und SCCS 321 CVS 322 CVS - Einführung 322 Manual Pages schreiben 326 Software-Distribution 329 Das Programm patch 329 Weitere Distributionswerkzeuge 331 Beschreibung des Befehls tar 333 Zusammenfassung 333 Kapitel 9: Debugging 335 Fehlertypen 335 Spezifikationsfehler 335 Entwurfsfehler 335 Kodierungsfehler 336 Allgemeine Debugging-Techniken 336 Ein Programm mit Bugs 336 Code-Untersuchung 339 Instrumentalisierung 340 Debugging ohne Rekompilierung 341 Kontrollierte Ausführung 342 Debugging mit gdb 343 gdb starten 343 Ein Programm ausführen 344 Stack-Verfolgung 344 Variablen untersuchen 345 Das Programm auflisten 346 Breakpoints einrichten 346 Patching mit dem Debugger 349 Weitere Informationen zu gdb 350 Weitere Debugging-Werkzeuge 351 Lint: Entstauben Ihrer Programme 351 Funktionsaufrufwerkzeuge 352 ctags 352 cxref 352 Cflow 353 Ausführungsprofile 354 prof/gprof 354 Zugesicherte Wertebereiche für ein Programm (Assertions) 355 Probleme mit assert 355 Speicher-Debugging 356 ElectricFence 357 Checker 358 Ressourcen 360 Zusammenfassung 360 Kapitel 10: Prozesse und Signale 361 Was ist ein Prozess? 361 Prozessstruktur 362 Die Prozesstabelle 363 Prozesse anzeigen 363 Systemprozesse 364 Scheduling von Prozessen 365 Neue Prozesse starten 366 Ein Prozess-Image ersetzen 368 Ein Prozess-Image duplizieren 370 Auf einen Prozess warten 372 Zombieprozesse 374 Ein- und Ausgabeumleitung 375 Threads 377 Signale 377 Signale senden 381 Eine robuste Signalschnittstelle 383 Signal-Sets 385 sigaction-Flags 387 Referenz für übliche Signale 388 Zusammenfassung 389 Kapitel 11: Posix-Threads 391 Was ist ein Thread? 391 Vor- und Nachteile von Threads 392 Ist die Unterstützung für Threads gewährleistet? 393 Ein erstes Programm mit Threads 394 Simultane Ausführung 397 Synchronisierung 399 Synchronisierung mit Semaphoren 399 Synchronisierung mit Mutexes 404 Attribute von Threads 407 detachedstate 409 schedpolicy 409 schedparam 409 inheritsched 409 scope 409 stacksize 409 Thread-Attribute - Scheduling 411 Abbrechen eines Threads 412 Threads im Überfluss 415 Zusammenfassung 418 Kapitel 12: Prozesskommunikation: Pipes 419 Was ist eine Pipe? 419 Prozess-Pipes 420 popen 420 pclose 421 Ausgaben an popen senden 422 Größere Datenmengen übergeben 422 Wie popen implementiert ist 424 Der Pipe-Aufruf 425 Über- und untergeordnete Prozesse 428 Aus geschlossenen Pipes lesen 430 Pipes als Standard-I/O verwenden 430 Wie sich die Dateideskriptoren mit close und dup verändern 431 Benannte Pipes: FIFOs 433 Auf FIFOs zugreifen 434 Eine FIFO-Datei mit open öffnen 435 FIFOs schreiben und lesen 438 Für Fortgeschrittene: Client und Server mit FIFOs 441 Die CD-Anwendung 445 Ziele 446 Implementierung 446 Funktionen der Client-Schnittstelle 450 Suchen in der Datenbank 454 Die Server-Schnittstelle 456 Die Pipe 460 Server-Funktionen 461 Client-Funktionen 463 Die Anwendung - Zusammenfassung 466 Zusammenfassung 466 Kapitel 13: Semaphore, Nachrichtenwarteschlangen und gemeinsam genutzter Arbeitsspeicher 467 Semaphore 467 Definition 468 Ein theoretisches Beispiel 468 Semaphore unter UNIX 469 semget 470 semop 470 semctl 471 Semaphore einsetzen 472 Semaphore - Zusammenfassung 475 Gemeinsam genutzter Arbeitsspeicher 476 Überblick 476 Funktionen für gemeinsam genutzten Arbeitsspeicher 477 shmget 477 shmat 477 shmdt 478 shmctl 478 Gemeinsam genutzter Arbeitsspeicher - Zusammenfassung 482 Nachrichtenwarteschlangen 482 Überblick 483 Funktionen für Nachrichtenwarteschlangen 483 msgget 483 msgsnd 483 msgrcv 484 msgctl 485 Nachrichtenwarteschlangen - Zusammenfassung 488 Die Anwendung 488 IPC-Statusbefehle 492 Semaphore 492 Gemeinsam genutzter Arbeitsspeicher 492 Nachrichtenwarteschlangen 493 Zusammenfassung 493 Kapitel 14: Sockets 495 Was ist ein Socket? 496 Socket-Verbindungen 496 Socket-Attribute 499 Socket-Domänen 500 Socket-Typen 500 Socket-Protokolle 501 Ein Socket einrichten 501 Socket-Adressen 502 Socket-Benennung 503 Eine Socket-Warteschlange einrichten 503 Verbindungen akzeptieren 504 Verbindungen anfordern 504 Sockets schließen 505 Kommunikation über Sockets 505 Die Byte-Reihenfolge für Host und Netzwerk 508 Netzwerkinformationen 509 Der Internet-Dämon 514 Socket-Optionen 515 Mehrere Clients 515 select 518 Mehrere Clients 521 Zusammenfassung 524 Kapitel 15: Tcl: Tool Command Language 525 Ein Überblick über Tcl 525 Unser erstes Tcl-Programm 525 Tcl-Befehle 526 Variablen und Werte 527 Quotierung und Ersetzungen 528 Variablen 528 Befehle 528 Schrägstrich 528 Zeichenfolgen 529 Geschweifte Klammern 529 Ersetzungen durch den Tcl-Interpreter 529 Kommentare 531 Berechnungen 531 Kontrollstrukturen 533 if 533 switch 533 for 534 while 534 Fehlerbehandlung 535 error 535 catch 535 Operationen mit Zeichenfolgen 535 string 535 first, last, compare 535 index 536 length 536 match 536 range 536 tolower, toupper 536 trim, trimleft, trimright 537 wordstart, wordend 537 Glob-Vergleich 537 regexp und regsub-Vergleich 537 append 538 regexp 538 regsub 539 Arrays 540 array 540 exists 541 get 541 names 541 set 541 Size 541 Listen 541 list 542 Split 542 join 542 concat 543 lappend 543 lindex 543 linsert 543 llength 544 lrange 544 lreplace 544 lsearch 544 lsort 545 foreach 545 Prozeduren 546 upvar 547 Ein- und Ausgabe 548 open 548 close 548 read 548 gets 549 Puts 549 format 549 scan 549 file 550 atime, mtime 550 dirname 550 exists, executable 550 extension, rootname 550 isdirectory, isfile 550 owned 550 readable, writeable 551 size 551 Ein Tcl-Programm 551 Netzwerkunterstützung 553 Tcl neu erschaffen 554 Tcl-Erweiterungen 554 expect 554 [incr Tcl] 555 TclX 555 Grafik 555 Tk 555 Zusammenfassung 555 Kapitel 16: X-Programmierung 557 Was ist X? 557 X.Server 558 X.Pr0t0k0ll 558 Xlib 558 X.Cl1e11ts 558 X.T00lk1ts 558 X.W111d0w.Ma11ager 559 Das X-Programmiermodell 560 Programmbeginn 560 Hauptschleife 561 Bereinigung 562 Schnellkurs X-Programmierung 562 Das Tk-Toolkit 562 Programmierung mit Fenstern 564 Konfigurationsdateien 565 Weitere Befehle 566 Tk-Widgets 566 Rahmen 567 Toplevel 568 Labels 568 Schaltflächen 568 Meldungen 570 Eingabefelder 571 Listenfelder 572 Rollbalken 573 Skalen 574 Text 574 Bildflächen 578 Bilder 581 Menüs 583 Menüschaltflächen 588 Popup-Menüs 590 Optionsmenüs 592 Dialoge 593 Integrierte Tk-Dialoge 594 Farbschemata 597 Schriftarten 597 Bindungen 598 BindTags 600 Geometrie-Manager 601 pack 601 place 602 Grid 603 Fokus und Navigation 604 Optionsdatenbank 605 Kommunikation zwischen den Anwendungen 606 Markieren 606 Clipboard 607 Window-Manager 608 Dynamisches und statisches Laden 609 Sicheres Tk: Safe-Tcl 610 Ein Mega-Widget 612 Eine Anwendung mit dem Baum-Widget 622 Tk-Prozessprotokollanzeige 625 Internationale Anpassung 636 Wie geht's weiter? 636 Zusammenfassung 638 Kapitel 17: GNOME-Programmierung mit GTK+ 639 GNOME - Einführung 639 Die GNOME-Architektur 640 Der GNOME-Desktop 642 GNOME-Programmierung mit GTK+ 643 Datentypen 643 Widget-Hierarchie 643 Umgang mit Signalen und Callbacks 647 Container 647 Schaltflächen 648 Eine GNOME-Anwendung 658 Voraussetzungen 658 Was muss kodiert werden? 658 Die CD-Anwendung mit GNOME 666 Zusammenfassung 666 Kapitel 18: Die Programmiersprache Perl 667 Einführung 667 Hello, Perl 668 Perl-Variablen 669 Skalare 669 Arrays 669 Hashes 670 Anführungszeichen und Ersetzungen 671 Besondere Variablen 671 Operatoren und Funktionen 672 Logische und Bitoperatoren 674 Array-Operationen 675 Hash-Operationen 676 Reguläre Ausdrücke 676 Mustervergleich 676 Ersetzung 678 Kontrollstrukturen und Unterroutinen 679 Tests 679 Schleifen 679 Bedingte Anweisungen 680 Unterroutinen 681 Dateiein- und -ausgabe 682 system()/" 683 Ein vollständiges Beispiel 683 Perl in der Befehlszeile 690 Module 691 CPAN 691 Modulinstallation 691 Dokumentation (perldoc) 692 Netzwerk 692 LWP 692 IO::Socket 692 Netzwerkmodule 693 Datenbanken 693 Die überarbeitete CD-Datenbank 694 Zusammenfassung 698 Kapitel 19: Für das Internet programmieren: HTML 699 Was ist das World Wide Web? 699 Terminologie 700 HTTP (HyperText Transfer-Protokoll) 700 MIME (Multimedia Internet Mail Extensions) 700 SGML (Standard Generalized Markup Language) 700 DTD (Document Type Definition) 700 HTML (HyperText Markup Language) 701 XML (Extensible Markup Language) 701 CSS (Cascading Style Sheets) 701 XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) 701 URL (Uniform Resource Locator) 701 URI (Uniform Resource Identifier) 702 HTML-Programmierung 702 HTML formal betrachtet 703 HTML-Tags 705 Titel 705 Kommentare 705 Überschriften 705 Textformatierung 705 Textstile 706 Sonderzeichen 709 Listen 709 Bilder 711 Tabellen 713 Anker oder Hyperlinks 718 Kombination von Ankern und Bildern 720 Nicht HTML-basierte URLs 721 Anker zu anderen Sites 721 Wozu Bilder noch dienen können 723 HTML-Texte erstellen 724 HTML-Seiten bereitstellen 724 Ein Überblick über HTML im Netzwerk 725 Einen Server einrichten 725 Anklickbare Übersichten 726 Server-seitige Übersichten 726 Client-seitige Übersichten 727 Server-side Includes 728 Tipps für die Einrichtung von WWW-Seiten 731 Zusammenfassung 732 Kapitel 20: Für das Internet programmieren 2: CGI 733 FORM-Elemente 734 Das FORM-Tag 734 Das INPUT-Tag 734 TEXT 735 PASSWORD 735 HIDDEN 735 CHECKBOX 735 RADIO 736 IMAGE 736 SUBMIT 736 RESET 736 Das SELECT-Tag 736 Das TEXTAREA-Tag 737 Eine einfache Seite 737 Informationen an den WWW-Server senden 740 Informationskodierung 740 Serverprogramme 741 Sicherheit 741 Ein CGI-Programm für den Server programmieren 742 Umgebungsvariablen 742 Praktische Anwendung 743 CGI-Programme mit erweiterten URLs 747 Formulardaten dekodieren 749 HTML-Text an den Client zurückgeben 756 Tipps und Tricks 759 CGI-Programme richtig beenden 759 Clients umlenken 760 Dynamische Bilder 760 Kontextinformationen verbergen 760 Eine Anwendung 761 Perl 767 Zusammenfassung 772 Kapitel 21: Gerätetreiber 773 Geräte 774 Geräteklassen 774 Benutzer- und Kernel-Bereich 775 Was gehört wohin? 776 Module aufbauen 776 Datentypen 778 Zeichenorientierte Geräte 780 Dateioperationen 781 Ein Beispiel für einen Treiber: Schar 783 Das MSG-Makro 784 Das Gerät registrieren 784 Modulnutzungszähler 785 Öffnen und wieder freigeben 785 Von dem Gerät lesen 787 Die aktuelle Task 788 Warteschlangen 788 Auf Geräte schreiben 789 Nicht blockierendes Lesen 790 Suchen 791 ioctl 791 Benutzerrechte überprüfen 793 poll 794 Modulparameter 796 Die Dateisystemschnittstelle proc 797 Wie sich schar verhält 800 Zusammenfassung 800 Zeit und Zeittakt 801 Kurze Verzögerungen 802 Zeitgeber 803 Den Prozessor freigeben 805 Task-Warteschlangen 806 Die vordefinierten Task-Warteschlangen 807 Zusammenfassung 808 Arbeitsspeicherverwaltung 808 Virtuelle Speicherbereiche 809 Adressraum 810 Speicherzuweisungen 810 Speicherzuweisungen mit Gerätetreibern 811 kmalloc 812 vmalloc 812 Daten zwischen dem Benutzer- und Kernel-Bereich austauschen 813 Weitere Daten verschieben 814 Einfache Speicherzuweisung 814 I/O-Speicher 816 Portierbarkeit 817 Gerätezuweisung mit Iomap 818 I/O-Speicher mit mmap 818 I/O-Ports 820 Portierbarkeit 821 Interrupt-Behandlung 821 Einen Interrupt zuweisen 822 Einen passenden IRQ erhalten 823 Der IRQ-Handler 824 Bottom Halves 825 Rückverzweigungen 826 Einzelne Interrupts deaktivieren 827 Unterbrechungsfreie Operationen 827 Kritische Bereiche schützen 828 Spin Locks 828 Schreib- und Lesesperren 829 Automatische Sperren 829 Blockgeräte 829 Radimo - ein einfaches RAM-Disk-Modul 830 Sektorengröße 831 Ein Blockgerät registrieren 831 Datenträgerwechsel 832 Ioctl für Blockgeräte 833 Die request-Funktion 833 Der Pufferzwischenspeicher 835 Weitere Informationen 837 Debugging 837 Oops 837 Modul-Debugging 839 Die magische Taste 840 Der Kernel-Debugger KDB 840 Remote-Debugging 841 Allgemeine Anmerkungen zum Debugging 841 Portierbarkeit 842 Datentypen 842 Byte-Vertauschung 842 Ausrichtung 843 Wie es weitergeht 843 Anatomie des Kernel-Codes 844 Stichwortverzeichnis 845 |
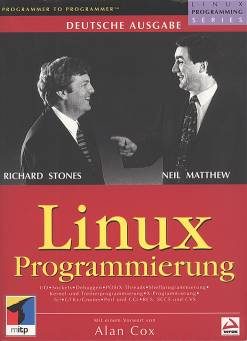
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen