|
|
|
Umschlagtext
Ingeborg Bachmann (1926-1973) zählt zu den bedeutendsten deutschsprachigen Autorinnen der Nachkriegszeit, im Mittelpunkt ihres künstlerischen Schaffens steht die Suche nach einer Sprache für die Liebe. Doch wie kann man von der Liebe sprechen, wenn man immer wieder mit der »abscheulichen« Wirklichkeit des menschlichen Alltags konfrontiert wird? Ingeborg Bachmann findet eine ganz eigene poetische Sprache, um der Geheimnis-haftigkeit der Liebe Ausdruck zu verleihen.
Bergit Peters formuliert ein theologisches Interesse an den literarischen Texten Ingeborg Bachmanns, indem sie ein Gespräch mit der Schriftstellerin über die »Kunst des Liebens« führt. Dabei zeigt sich, dass Theologie und Literatur immer wieder neu herausgefordert sind, die Liebeserfahrung als eine menschliche Grunderfahrung in ihrer Ambivalenz und Dialektik zu deuten. Autorin Bergit Peters, Dr. theol., geboren 1965, studierte Katholische Theologie in Münster und Tübingen. Derzeit arbeitet sie als Referentin für theologische Grundsatzfragen im Institut für Religionspädagogik und Medienarbeit im Erzbistum Paderborn. Rezension
Alle Kolleg/inn/en mit der Fächerkombination Deutsch / Religion seien verwiesen auf diesen Band und diese Reihe; denn fächerverbindender Unterricht bietet sich auch insofern an, als Literatur vielfältig Anspielungen an die Bibel enthält: Die Reihe "Bibel und Literatur", in der auch der hier anzuzeigende Band erschienen ist, sowie deren Herausgeber Karl-Josef Kuschel und Georg Langenhorst mögen dafür exemplarisch stehen. Wer also im Lehramt Deutsch und Theologie studiert hat, der / die möge mit dieser fächerübergreifenden Perspektive im Unterricht arbeiten! - Die österreichische Schriftstellerin Ingeborg Bachmann (*1926 in Klagenfurt; † 1973 in Rom) gilt als eine der bedeutendsten deutschsprachigen Lyrikerinnen und Prosaschriftstellerinnen des 20. Jahrhunderts.
Oliver Neumann, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Herausgegeben von Karl-Josef Kuschel und Georg Langenhorst Theologie und Literatur – Band 21 Ingeborg Bachmann (1926–1973) zählt zu den bedeutendsten deutschsprachigen Autorinnen der Nachkriegszeit. im Mittelpunkt ihres künstlerischen Schaffens steht die Suche nach einer Sprache für die Liebe. Doch wie kann man von der Liebe sprechen, wenn man immer wieder mit der »abscheulichen« Wirklichkeit des menschlichen Alltags konfrontiert wird? Ingeborg Bachmann findet eine ganz eigene poetische Sprache, um der Geheimnishaftigkeit der Liebe Ausdruck zu verleihen. Bergit Peters formuliert ein theologisches Interesse an den literarischen Texten Ingeborg Bachmanns, indem sie ein Gespräch mit der Schriftstellerin über die »Kunst des Liebens« führt. Dabei zeigt sich, dass Theologie und Literatur immer wieder neu herausgefordert sind, die Liebeserfahrung als eine menschliche Grunderfahrung in ihrer Ambivalenz und Dialektik zu deuten. Inhaltsverzeichnis
9 VORWORT
11 DIE LEITFRAGE: WIE REDEN VON DER LIEBE, WENN MAN STÄNDIG KONFRONTIERT WIRD MIT DER »ABSCHEULICHKEIT DIESES ALLTAGS«? 20 I. ZUM STAND DER FORSCHUNG 20 1. Forschungsüberblick zur wissenschaftlichen Rezeption des Werkes von Ingeborg Bachmann 26 2. Literaturwissenschaftliche Arbeiten zur Liebesthematik im Werk Ingeborg Bachmanns 27 3. Theologische Rezeption des Werkes von Ingeborg Bachmann 42 4. Methodik und Zielbestimmung dieser Arbeit 47 II. DIE LIEBE ALS DICHTUNGSKONZEPT 47 1. Hinführung: »Die Liebe ist ein Kunstwerk« 49 2. Das Gedicht: »Dunkles zu sagen« (1952) 49 Ingeborg Bachmanns Debüt in Niendorf/Ostsee 50 Schönheit und »dunkle Rede« 53 Orpheus: Liebe, Tod und Kunst 55 Der geschichtliche Bezug: Liebesmetaphern wandeln sich in Todesbilder 57 Und dennoch: Der Sehnsuchtston der Liebe 59 3. Zum »Konzept der Grenze« im Werk Ingeborg Bachmanns 59 An der Grenze der Sprache: Die Philosophien Martin Heideggers und Ludwig Wittgensteins 61 Das Finden einer literarischen Sprache: Die Schriftstellerin Ingeborg Bachmann 62 4. Der Prosatext: »Das Gedicht an den Leser« (vermutlich um 1959) 63 Ein verlorenes Liebesverhältnis 65 Eine »unstillbare Liebe« 66 Die »neue Gangart der Sprache« 67 Ingeborg Bachmanns Abkehr von der Lyrik hin zur Prosa 69 Datierung des Textes 69 Liebessprache: Zwischen Versteinerung und Neuerfindung 69 5. Die Erzählung »Undine geht« (19 61) 69 Der Undine-Mythos: Weiblichkeit, Natur und Kunst 71 Ihr Menschen! Ihr Ungeheuer! 75 Mit dem Anfang beginnen 78 »Die Kunst, ach die Kunst« 79 Wenn Texte lieben: Ingeborg Bachmanns Dialog mit Paul Celan 81 Die Literatur ist ein »nach vorn geöffnetes Reich von unbekannten Grenzen« 83 »Es gibt für mich keine Zitate« 85 Sprachmagie 88 Der Ruf der Wahrheit: »Komm. Nur einmal. Komm« 90 6. Die Rede: »Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar« (1959) 91 Wo einem »die Augen aufgehen« 92 Das »Widerspiel des Unmöglichen mit dem Möglichen« 93 Der »große, geheime Schmerz« 94 7. Zusammenfassung 96 III. DIE LIEBESTHEMATIK IM ROMAN »MALINA« (1971) 96 Das Ende der Publikationspause 97 »Malina« - eine Autobiografie? 98 Die »wirklichen Schauplätze sind die inwendigen« 99 »Ich werde siegen in diesem Zeichen« 101 Der »Virus Liebe« 102 »Telefonsätze« werden zu Liebeserfahrungen 103 Der abwesend anwesende Geliebte 106 IV. GESCHWISTERLIEBE 106 1. Das Gedicht: »Das Spiel ist aus« (1954) 108 Ein Kindertraum: »Den Himmel hinunterfahren« 109 Eine Heilserfahrung: »Jeder, der fällt, hat Flügel« 110 Eine Schulderfahrung: »Die Fracht geht unter« 111 2. Die Erzählung »Drei Wege zum See« (1971/1972) 111 Der letzte Text Ingeborg Bachmanns 111 Eigene Lebenswege und die Hoch zeit des Bruders 114 Die Sehnsucht nach dem Verlorenen 115 »Der Ursprung liegt im Topographischen« 116 »Eine Pazifistin der Liebe« 117 3. Das Romanfragment: »Der Fall Franza« (bis 1966) 117 Ingeborg Bachmanns Lesereise durch Deutschland 118 Der »Inhalt« des Romans, der »nicht der Inhalt ist« 118 Eine »Reise durch eine Krankheit« und ein »Buch über ein Verbrechen« 119 Der Bruder als Erzähler? 120 »Viele Menschen sterben nicht, sondern werden ermordet« 122 Heimfahrt nach Galicien 125 Der »schönste Frühling« 126 4. Zusammenfassung 127 VI. GESCHLECHTERLIEBE 127 1. Das Hörspiel: »Der gute Gott von Manhattan« (1958) 127 Die Liebe sucht eine Sprache 127 Ingeborg Bachmann an der Harvard University 127 Der »Grenzfall der Liebe« 129 Die »himmlische Erde« 131 Der »Grenzübertritt« der Liebe 135 Die »Liebe führt in die tiefste Einsamkeit« 136 Ein »Tag wird kommen«, an dem wir die »Liebe wieder entdecken« 137 VI. ZUR BEGRÜNDBARKEIT DER LIEBE 137 1. Das Gedicht: »Erklär mir, Liebe« (1956) 137 Das Finden einer eigenen Schreibweise: »Als hätte ich die Schwimmweste verloren und ginge doch nicht unter« 139 Eine Liebeserklärung 144 Die Leidenschaft der Liebe: Das »Glühendleben« 146 VII. IM THEOLOGISCHEN GESPRÄCH MIT INGEBORG BACHMANN ÜBER »DIE KUNST DES LIEBENS« 146 Anmerkungen zur Hermeneutik des Gesprächs: »Damit nichts geschieden wird« 149 1. Ingeborg Bachmanns ästhetische Verdichtung der Menschenliebe 149 Die Polarität und Ambivalenz menschlicher Liebeserfahrung 151 Zur Religiosität Ingeborg Bachmanns 154 Der intellektuelle Horizont Ingeborg Bachmanns 156 Eine unerfüllte Sehnsucht: »Erlöse mich! Ich kann nicht länger sterben« 156 Das Erleben von Zeit in der Liebeserfahrung: »Die Gegenzeit beginnt« 158 Eine Hermeneutik des Begehrens: Die Gegenwart des abwesend Anwesenden 160 Das Erfahren von Schmerz in der Liebe: Verwundete und ermordete Liebe 161 Das Ringen um eine angemessene Sprache der Liebe: Sprachspiele der Liebe 162 Das Finden der eigenen Leiblichkeit in der Liebeserfahrung: »Endlich gehe ich auch in meinem Fleisch herum« 164 Das Wirken der schöpferischen Kraft der Liebe: »EXSULTATE JUBILATE« 165 Zusammenfassung 166 2. Wie liebt Gott? - Ein Beitrag des biblischen Gottesglaubens 167 Der geheimnisvolle Grund der Liebe 168 Der geschichtlich erfahrene Jahwe-Glaube des Volkes Israel: »Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt« (Jer 31,3b) 172 Die erneute Bestätigung des Liebesbundes Gottes mit den Menschen in Jesus Christus: »Du bist mein geliebter Sohn« (Mk 1,11) 175 Das Hohelied der Liebe (1 Kor 13) 185 Der Gott für alle Menschen 188 Zusammenfassung 189 3. Menschenliebe und Gottesliebe - Ein perspektivierendes Resümee 189 »Und wer nicht liebt [...], ist für mich kein Mensch« 192 Leben mit der Zukunft im Rücken 194 Der gute Anfang und der ungute Ausgang? 195 »Die Liebe hört niemals auf« (1 Kor 13,8) 197 Den Ruf der Liebe hören 199 LITERATURVERZEICHNIS 199 Primärliteratur 200 Sekundärliteratur 207 Textnachweis Weitere Titel aus der Reihe Theologie und Literatur |
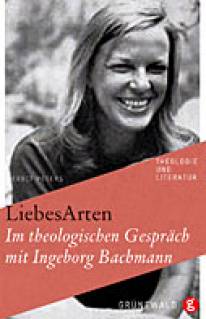
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen