|
|
|
Umschlagtext
Die Klinische Psychologie ist ein Teilgebiet der wissenschaftlichen Psychologie, das Entwicklung, Erforschung und Anwendung psychologischer Behandlungsverfahren bei psychisch auffälligen beziehungsweise gestörten Menschen zum Gegenstand hat. Das Buch bietet einen Überblick über die Schwerpunkte der Klinischen Psychologie des Kindes- und Jugendalters in einer auf das Wesentliche konzentrierten systematischen Einführung. Die einzelnen Kapitel widmen sich der begrifflichen Klärung, dem Platz der Klinischen Psychologie in der gesamten Psychologie, ihrer Geschichte, den Methoden, der Neurosenlehre, der Psychotherapie sowie ausgewählten Störungsbildern. Ein Anhang samt Glossar und Literaturangaben komplettiert den Band, der sich vor allem an Studierende und Praktiker der Sozialpädagogik, Heilpädagogik und Heilerziehungspflege wendet, aber auch an angehende Pädagogen, Mediziner, Soziologen und Psychologen.
Rezension
Das Buch bietet eine umfassende Einführung in ein wichtiges Thema: die klinische Psychologie des Kindes- und Jugendalters. Grundkenntnisse in diesem Bereich werden zunehmend wichtiger nicht nur für Berufsgruppen im psycho-sozialen Bereich. Auch für pädagogisch tätige Menschen (Eltern, Erzieher, Lehrer, Jugendarbeiter) bietet dieser interessante Band mit seiner kompakten systematischen Einführung eine Menge Information, die manche Erlebnisse und Begegnungen mit Kindern und Jugendlichen verständlicher macht.
Arthur Thömmes, lehrerbibliothek.de Inhaltsverzeichnis
Vorwort 19
1. Zur Einordnung der Klinischen Psychologie 21 1.1 Persönlichkeit 22 1.1.1 Prinzip des Geschehens 23 1.1.2 Prinzip des Lebens oder des Organischen 23 1.1.3 Prinzip der Subjektivität 24 1.1.4 Prinzip der gesetzmäßigen Verknüpfung 25 1.2 Exkurs: Das psycho-physische Problem (Leib-Seele-Problem) 26 1.2.1 Dualistische Theorien 26 1.2.1.1 Theorie der (äußeren) Wechselwirkung26 1.2.1.2 Theorie des psychophysischen Parallelismus27 1.2.2 Monistische oder Identitätstheorien 27 1.2.2.1 Theorie des (einfachen) psychophysischen Materialismus 27 1.2.2.2 Theorie des Spiritualismus oderpsychophysischen Idealismus... 29 1.2.2.3 Identitätstheorie 29 1.2.3 Gegenwärtige Lösungspräferenzen30 1.3 Gegenstand und Definitionen der Psychologie 32 1.4 Exkurs: Was ist eine Definition? 33 1.5 Definitionen der Klinischen Psychologie34 1.6 Normalität 36 1.6.1 Statistische Norm 36 1.6.2 Ideale Norm 37 1.6.3 Funktionale Norm 37 1.7 Krankheitsmodelle 37 1.7.1 Biomedizinisches Modell 37 1.7.2 Psychosoziales Modell 38 1.7.3 Biopsychosoziales Modell 38 1.8 Gesundheitsmodelle 40 1.9 Nachbargebiete 46 1.9.1 Psychiatrie 46 1.9.2 Verhaltensmedizin 46 1.9.3 Gesundheitspsychologie 46 1.9.4 Rehabilitationspsychologie 47 1.9.5 Medizinische Psychologie 47 1.10 Die klinisch-psychologische Tätigkeit 48 1.10.1 Grundschema (Schema 1) 48 1.10.2 ... plus Hypothesenbildung und Untersuchungsplanung (Schema 2) 49 1.10.3 ... plus verschiedene Wissensspeicher (Schema 3) 52 1.10.4 Exkurs: Klinisch-psychologisches Änderungsoder Therapiewissen.. 54 1.10.5 ... plus Bestimmung des Ziel- oder Soll-Zustandes (Schema 4) 54 1.10.6 ... plus Gewissen (Schema 5) 57 1.10.7 Kritische Anmerkungen 58 1.11 Kompetenzdifferenzierende Symptome 59 2. Geschichte der Psychopathologie und Klinischen Psychologie .. 62 2.1 Geschichte der Psychopathologie 62 2.1.1 Frühe Dämonologie 62 2.1.2 Somatogenese 62 2.1.3 (Früh-)Mittelalter 63 2.1.4 Neuzeit 63 2.1.5 Entwicklung der Asyle 63 2.1.6 Humanitäre Behandlung 63 2.1.7 Anfänge gegenwärtiger Auffassungen 64 2.2 Geschichte der Klinischen Psychologie65 2.2.1 Witmer, Kraepelin und Freud65 2.2.2 Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg66 2.2.3 Kongress der Sektion „Klinische Psychologie" 198067 2.2.4 Psychotherapeutengesetz (PsychThG) von 1999 67 3. PSYCHODIAGNOSTIK 68 3.1 Gegenstand der Diagnostik 70 3.1.1 Ordnungsgesichtspunkte zur Diagnoseorientierung70 3.1.2 Allgemeines Verlaufsschema der Diagnostik72 3.1.3 Diagnostische Entscheidungen 73 3.1.4 Stichprobenproblem in der Diagnostik76 3.1.5 Definition und Gütekriterien psychologischer Tests76 3.2 Testverfahren 78 3.2.1 Anfänge der Intelligenzdiagnose78 3.2.2 Intelligenztests 80 3.2.3 Persönlichkeitsfragebogen 84 3.2.4 Projektive Tests 87 3.2.5 Anmerkungen zur Diagnostik88 3.3 Psychodiagnose und Hintergrundwissen 89 3.4 Klassifikationssysteme 90 3-4.1 DSM-IV: Diagnostic and statistical manual of mental disorders 91 3.4.2 1CD-10: International classification of diseases 93 3.4.3 Unterschiede von ICD-10 und DSM-IV 94 3.5 Das Psychodiagnostische Gespräch 95 3.5.1 Definition 95 3.5.2 Systematik 95 3.5.2.1 Anamnese 95 3.5.2.2 Exploration 96 3.5.2.3 Klinisches Interview 96 3.5.3 Determinanten des Gesprächs 96 3.5.4 Reliabilität und Validität 97 3.6 Untersuchungsverlauf und Gutachtenmodell 97 3.7 Beratungsgespräch 101 3.7.1 Voraussetzungen 101 3.7.2 Gesprächstechnik 101 4. Neurosenlehre 103 4.1 Kennzeichnung von Neurosen 103 4.2 Neurotische Verhaltensmuster 105 4.2.1 Angstzustände 105 4.2.2 Phobische Reaktionen 105 4.2.3 Zwangsreaktionen 106 4.2.4 Hysterische Reaktionen 107 4.2.4.1 Konversionsreaktionen 107 4.2.4.2 Bewusstseinsspaltende Reaktionen 107 4.2.5 (Neurotisch) Depressive Reaktionen 109 4.3 Erklärung des Fehl Verhaltens 110 4.3.1 Psychodynamische Theorien am Beispiel der Psychoanalyse: Die Persönlichkeitstheorie nach Sigmund Freud 111 4.3.1.1 Hypothesen zur Motivation 112 4.3.1.2 Exkurs: Eisberg-Modell der „topischen" Bewusstheitszustände.... 113 4.3.1.3 Exkurs: Modell der psychischen Instanzen 114 4.3.1.4 Exkurs: Entstehung des Gewissens 115 4.3.1.5 Hypothesen zur psychosexuellen Entwicklung 116 4.3.1.6 Exkurs: Das psychoanalytische Entwicklungsmodell .... 117 4.3.1.7 Hypothesen über Fehlhaltungen der Psyche 121 4.3.1.8 Anmerkungen 123 4.3.1.9 Exkurs: Die Abwehrmechanismen - Bewältigungsversuche der Angst.... 124 4.3.1.10 Exkurs: Ich-Schwächen 127 4.3.2 Tiefenpsychologische Theorien am Beispiel der Individualpsychologie: Die Persönlichkeitstheorie nach Alfred Adler 128 4.3.2.1 Konzept „Lebensstil" 128 4.3.2.2 Zentrale Lebensaufgaben und Gemeinschaftsgefühl 129 4.3.2.3 Selbsterhaltungstrieb und Machtstreben 130 4.3.2.4 Beratung und Therapie 131 4.3.2.5 Adler aus Sicht der Psychoanalyse 132 4.3.3 Lerntheorien am Beispiel der klassischen Verhaltensanalyse: Die Persönlichkeitstheorie nach Hans-Jürgen Eysenck 132 4.3.3.1 Erlernen von Fehlverhalten 133 4.3.3.2 Exkurs: Die Verhaltensformel nach Frederic H. Kanfer und George Saslow 139 4.3.3.3 Beschreibende Aspekte der Theorie Eysencks: Das Würfelmodell 140 4.3.3.4 Erklärende Aspekte der Theorie Eysencks 144 4.3.3.5 Zusammenfassung 150 4.3.4 Lerntheorien am Beispiel der kognitiven Verhaltenstherapie: Die Rational-emotive Therapie nach Albert Ellis 151 4.3.4.1 ABC-Modell der Persönlichkeit 153 4.3.4.2 Das „Belief System" 154 4.3.4.3 Rationale Psychotherapie 155 4.3.5 Vergleich: Psychoanalyse - Verhaltenstherapie 157 4.3.5.1 Exkurs: Vergleich des psychodynamischen und lerntheoretischen Ansatzes am Behandlungsfall des kleinen Hans (Kindertherapie von Sigmund Freud) 158 4.4 Neurosentheorien 160 4.4.1 Neurosentheorie nach Sigmund Freud 160 4.4.1.1 Konfliktmodell der Entstehung von Psychoneurosen .... 161 4.4.1.2 Exkurs: Verdrängung und Abwehr von Triebregungen . . 164 4.4.2 Neurosentheorie nach Hans-Jürgen Eysenck 165 4.4.2.1 Lernstörungen erster und zweiter Art 165 4.4.2.2 Exkurs: Lerntheoretisches Modell abweichenden Verhaltens 166 5. Psychotherapie 168 5.1 Kurzer Überblick 168 5.1.1 Tiefenpsychologische Verfahren 169 5.1.2 Verhaltenstherapeutische Verfahren 169 5.1.3 Humanistisch-existentialistische Verfahren 169 5.1.4 Körperorientierte Verfahren 170 5.1.5 Familientherapeutische (systemische) Verfahren 170 5.2 Psychoanalyse (PA) 171 5.2.1 Klientenvariablen 171 5.2.2 Therapeutenvariablen 172 5.2.2.1 Exkurs: Übertragung und Gegenübertragung 173 5.2.3 Ziel der Analyse 175 5.2.4 Anmerkungen 175 5.3 Verhaltenstherapie (VT) 177 5.3.1 Historisches 177 5.3.2 Techniken der klassischen Verhaltenstherapie 178 5.3.2.1 Beseitigungstechniken 179 5.3.2.2 Aneignungstechniken 181 5.3.3 Techniken der kognitiven Verhaltenstherapie 182 5.3.3.1 Verdeckte SRC-Therapien 182 5.3.3.2 Kognitive Therapien 183 5.3.3.3 Modelllernen 186 5.4 Gesprächspsychotherapie (GT) 187 5.4.1 Konzept 187 5.4.2 Verlauf 188 5.4.3 Klientenmerkmalc 189 5.4.4 Therapeutenmerkmale 190 5.4.5 Indikation 190 5.5 Die Gestalttheoretische Psychotherapie 191 5.5.1 Historisches 191 5.5.1.1 Der Gestaltbegriff 192 5.5.1.2 Der Kritische Realismus als erkenntnistheoretische Grundlage... 192 5.5.1.3 Das Menschenbild der Gestalttheorie 193 5.5.1.4 Die ,,Tendenz zur guten Gestalt" 193 5.5.1.5 Das Lebensraumkonzept von Kurt Lewin 194 5.5.1.6 Zum Gesundheits- und Krankheitsverständnis der Gestalttherapie ...195 5.5.2 Gestalttherapie und Psychoanalyse 196 5.5.2.1 Die Technik der Gestalttherapie 196 5.5.2.2 Die Therapiesituation als „Ort schöpferischer Freiheit" . . 197 5.5.2.3 Kraftfeldanalyse 198 5.6 Die Familientherapie 199 5.6.1 Geschichtlicher Hintergrund 199 5.6.2 Die theoretischen Hintergründe202 5.6.3 Praxis der Familientherapie 203 5.6.4 Familientherapie-Sitzung („Selting") 203 5.6.5 Indikationen 204 5.6.6 Risiken in der Familientherapie 205 5.6.7 Bemerkungen 205 5.7 Systemische Therapie 206 5.7.1 Allgemeines 206 5.7.2 Geschichtliche Entwicklung 206 5.7.3 Therapieziel und Methode 208 5.8 Kinderpsychotherapie 209 5.8.1 Definition 209 5.8.2 Besonderheiten der Kinderpsychotherapie 210 5.8.2.1 Kindheit als Therapiebedingung 210 5.8.2.2 Verhaltensnormen 211 5.8.2.3 Diagnoseerstellung 211 5.8.2.4 Ursachenerkundung 212 5.8.2.5 Altersgebundene Störungshäufungen 212 5.8.3 Kinderpsychotherapeutische Verfahren 213 5.8.3.1 Orientierung am Therapiekonzept 213 5.8.3.2 Orientierung am Therapiemedium 214 5.8.3.3 Orientierung am Interaktionsmuster 214 5.8.3.4 Orientierung am Ursachenmodell 214 5.8.4 Die Persistenz psychischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen 219 5.8.5 Klientenzentrierte Spieltherapie 220 5.8.5.1 Therapeutische Möglichkeiten des kindlichen Spieles ... 220 5.8.5.2 Skalen zur Beobachtung des Spieles 220 5.8.5.3 Exkurs: Das Spiel als Medium in der Psychotherapie ... 221 5.8.5.3.1 Altersabhängige Veränderungen in der Kooperativität beim Spielen.. 223 5.8.5.3.2 Spielformen in Abhängigkeit vom Alter 224 5.8.5.4 Klientenzentrierte Kinderspieltherapie nach Carl Rogers 225 5.8.5.4.1 Sieben Leitgedanken 225 5.8.5.4.2 Geschichtliche Entwicklung 226 5.8.5.4.3 Indikation und Kontraindikation 226 5.8.5.4.4 Effekte und Veränderungen 227 5.8.5.4.5 Setting und therapeutischer Ablauf 228 5.8.5.4.6 Therapeutische Verhaltensregeln nach Virginia Axline 229 5.8.5.4.7 Ablauf einer Therapiestunde 230 5.8.5.4.8 Beendigung der Therapie 230 5.9 Gestaltungstherapien 230 5.9.1 Tanztherapie 231 5.9.2 Musiktherapie 232 5.9.3 Maltherapie 233 6. AUSGEWÄHLTE SYNDROME 236 6.1 Übersicht: Klinisch-psychologische Syndrome (Auswahl) 236 6.2 Autismus 237 6.2.1 Der frühkindliche Autismus (Kanner-Syndrom) 238 6.2.2 Autistische Psychopathie im Kindesalter (Asperger-Syndrom) 240 6.2.3 Psychogener Autismus 241 6.2.4 Somatogener Autismus 241 6.2.5 Differentialdiagnose 242 6.2.6 Erklärungsmodelle 245 6.2.7 Therapie 248 6.3 Dissozialität und Verwahrlosung250 6.3.1 Definitionen 251 6.3.2 Symptomatologie 253 6.3.2.1 Untersuchungen von Sheldon und Eleanor Glueck253 6.3.2.2 Untersuchungen von Klaus Hartmann257 6.3.3 Verwahrlosungsverlauf 260 6.3.4 Prognose der Verwahrlosung 261 6.3.4.1 Prognostisch ungünstige Merkmale („Schlechtpunkte'-)....262 6.3.4.2 Voraussagewert der Prognoseverfahren262 6.3.4.3 Kritik zur Anwendung von Prognoseverfahren263 6.3.5 Ätiologie 263 6.3.6 Modifikation von Dissozialität und Verwahrlosung267 6.4 Suizidales Syndrom 270 6-4.1 Präsuizidales Syndrom nach Erwin Ringel270 6.4.2 Risikoliste der Suizidalität271 6.4.3 Suizidarten 271 6.4.4 Häufigkeit von Suiziden 272 6.4.5 Methodische Schwierigkeiten der Untersuchung von Suizid 272 6.4.6 Suizidmotive 272 6.4.7 Erklärungsmodelle mit heuristischem Wert 274 6.4.7.1 Psychoanalytisches Modell 274 6.4.7.2 Frustrationsmodell 274 6.4.7.3 Drei-Phasen-Modell der seelischen Überforderung 275 6.4.7.4 Physiologisches Stress-Modell nach Hans Selye 275 6.4.8 Prophylaxe 276 6.4.9 Therapie 276 6.5 Psychischer Hospitalismus 277 6.5.1 Wichtige Autoren 278 6.5.2 Experimentelle Befunde 279 6.5.2.1 Notwendigkeit eines Minimums an Reizangeboten für die Entwicklung von Kleinkindern 279 6.5.2.2 Entwicklungsexperimente an Affen 280 6.5.3 Menschlicher Hospitalismus 282 6.5.4 Klinische Befunde 283 6.5.5 Differentialdiagnose 286 6.5.6 Anamnestische Gesichtspunkte 286 6.5.7 Prophylaxe und Therapie 287 6.5.8 Anmerkungen 288 6.6 Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Syndrom (ADHS).. 289 6.6.1 Definition 289 6.6.2 Häufigkeit und Verlauf 290 6.6.3 Ursachen 290 6.6.4 Formen 291 6.6.5 Beobachtungsphänomene 292 6.6.6 Diagnostik 293 6.6.7 Differentialdiagnose 293 6.6.8 Therapie 293 6.7 Lernbehinderung und geistige Behinderung 296 6.7.1 Definition 296 6.7.2 Merkmale 298 6.7.3 Ursachen 300 6.7.4 Abgrenzungen 301 6.7.5 Beschulung und Rehabilitation302 6.7.6 Aufgaben des Psychologen als Beitrag zur Rehabilitation 304 6.7.7 Einteilung der Intelligenzminderungen306 6.8 Legasthenie und Dyskalkulie307 6.8.1 Legasthenie (Lese-Rechtschreib-Schwäche)307 6.8.1.1 Definition 307 6.8.1.2 Differentialdiagnose 309 6.8.1.3 Formen der Legasthenie 309 6.8.1.4 Häufigkeit des Auftretens 310 6.8.1.5 Zeitpunkt und Art des Auftretens 310 6.8.1.6 Fehlerarten 311 6.8.1.7 Ursachen 312 6.8.1.8 Diagnostik 315 6.8.1.9 Training und Therapie 315 6.8.2 Dyskalkulie (Rechenschwäche) 316 6.8.2.1 Definitionen 316 6.8.2.2 Ursachen 317 6.8.2.3 Diagnose und Differentialdiagnose 324 6.8.2.4 Therapie 326 6.8.2.5 Rechenfragebogen nach Sommer 328 6.9 Drogenabhängigkeit 328 6.9.1 Grundbegriffe 328 6.9.1.1 Sucht 328 6.9.1.2 Drogenkarriere 330 6.9.1.3 Typen von Drogenabhängigen 330 6.9.2 Geschichtliche Entwicklung der Drogenabhängigkeit 331 6.9.3 Übersicht über die wichtigsten psychotropen Drogen 333 6.9.4 Verstärkungstheorie der Suchtbildung 338 6.9.5 Bedingungen für die akute Drogenwirkung 338 6.9.6 Effekte bei chronischem Drogenmissbrauch 340 6.9.7 Therapieformen 340 6.9.8 Organische Erkrankungen bei Drogenkonsum 341 6.9.9 Argumente für und gegen die Freigabe von Haschisch .... 342 6.9.10 Ursachen des Drogenkonsums 343 6.9.11 Rehabilitation 346 6.9.12 Exkurs: Erlebnislücken 349 6.9.13 Prognose 350 6.10 Alkoholismus 350 6.10.1 Häufigkeit 350 6.10.2 Definition 351 6.10.3 Pharmakologische und toxische Vorgänge 352 6.10.4 Ursachen 353 6.10.5 Therapieansätze 354 6.11 Enuresis und Enkopresis 356 6.11.1 Enuresis (Einnässen) 356 6.11.1.1 Definition 356 6.11.1.2 Physiologie 356 6.11.1.3 Ursachen 357 6.11.1.4 Diagnose 360 6.11.1.5 Beratung und Therapie 361 6.11.1.6 Prognose 365 6.11.2 Enkopresis (Einkoten) 365 6.11.2.1 Definition 365 6.11.2.2 Häufigkeit des Auftretens 366 6.11.2.3 Merkmale 366 6.11.2.4 Entwicklung 366 6.11.2.5 Diagnose 367 6.11.2.6 Therapie 368 6.11.2.7 Prognose 369 6.12 Stress-Syndrom 369 6.12.1 Phasen der Stressreaktion 370 6.12.2 Psychologische Gesichtspunkte von Stress373 7. Literaturparallelen 374 8. Anhang 376 8.1 Demonstrationsexperiment zum Gegenstand der Psychologie376 8.2 Demonstrationsexperiment zu Ursachenbereichen von Verhalten377 8.3 Anamneseanleitung 379 8.3.1 Anamnese bei Eltern 379 8.3.2 Durchführung der Anamnese (in der Erziehungsberatung)380 8.3.3 Anamnese bzw. Exploration bei Kindern383 8.3.4 Anamnese-Checkliste 385 8.3.4.1 Allgemeine Angaben 385 8.3.4.2 Kindheit 385 8.3.4.3 Schule 386 8.3.4.4 Familie 387 8.4 Beispiel Leistungstest: HAWIK-II387 8.4.1 Konzept 387 8.4.2 Testgliederung 388 8.4.3 Testdurchführung 392 8.4.4 Gutekriterien 393 8.5 Beispiel Persönlichkeitstest: Persönlichkeitsfragebogen ENNR 394 8.5.1 Übertragung auf deutsche Verhältnisse 396 8.5.2 Ergebnisse 396 8.5.3 Persönlichkeitsfragebogen ENNR 397 8.6 Beispiel projektiver Test: Sceno-Test 401 8.7 Zwischengutachten-Schema 403 8.8 Endgutachten-Schema 404 8.9 Conners-Rating-Skala (CRS. Kurzform) 405 8.10 Eltern-. Erzieher- und Lehrertraining beim ADH-Syndrom 406 8.11 Verhaltenstherapeutischer Weckplan zur Therapie von Enuresis Nocturna 408 8.11.1 Gespräch zwischen Eltern und Kind 408 8.11.2 Erstellen des Planes zusammen mit dem Kind 408 8.11.3 Durchführen des Planes 409 9. Glossar 411 10. Abbildungsverzeichnis 427 11.Tabellenverzeichnis 429 12. Literatur 431 Die Autoren 444 |
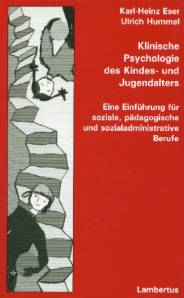
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen