|
|
|
Umschlagtext
Friedrich Hölderlin ist der große Unbekannte unter den Klassikern der deutschen Literatur: ein Genie des Zusammenwirkens von Philosophischer, religiöser und poetischer Kraft. Rüdiger Safranskis Biographie gelingt es auf bewundernste Weise, sich seiner Person und seinem Geheimnis zu nähern.
Rezension
„Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch.“ oder „Was bleibet aber, stiften die Dichter.“ zählen zu den bekanntesten Zitaten den Dichters Friedrich Hölderlin (1770-1843). Der Verfasser des lyrischen Briefromans „Hyperion oder der Eremit in Griechenland“, der Hymne „Dem Genius der Kühnheit“, der Gedichte „An die Natur“ und „Die Eichbäume“, der Reimhymne „Diotima“, der Ode „An die Parzen“, des Trauerspiels „Empedokles“, der Elegie „Der Wanderer“ oder der Dramenfragmente „Die Trauerspiele des Sophokles“ war nicht nur ein klassischer Dichter, sondern er zählt auch zu den Philosophen des Deutschen Idealismus. Von ihm stammen beispielsweise die philosophische Skizze „Urteil und Sein“ sowie die ästhetischen Fragmente „Über den Unterschied der Dichtarten“ und „Über die Verfahrensweise des poetischen Geistes“. Ohne Hölderlins „Vereinigungsphilosophie“, die auf einer Rezeption von Spinozas Pantheismus und Fichtes Dialektik basiert, ist sein Œuvre nicht verständlich.
Den engen Konnex zwischen Hölderlins schulischen Prägungen, philosophischen Reflexionen und literarischem Werk verdeutlicht sehr gut die neueste Biographie Rüdiger Safranskis (*1945) „Hölderlin. Komm! ins Offene, Freund!“. Das aktuelle Buch aus der Feder des vielfach preisgekrönten Autors wurde wieder im Carl Hanser Verlag publiziert, wo auch seine anderen Biographien über Friedrich Schiller, E.T.A. Hoffmann, Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche und Martin Heidegger erschienen. Wie in diesen Büchern gelingt es Safranski in seinem Hölderlin-Werk Leserinnen und Leser sehr gut anhand ausgewählter Originalzitate in den Kosmos eines Denkers einzuführen. Das gut lesbare Buch lädt Lehrkräfte der Fächer Deutsch und Philosophie dazu ein, in ihrem Fachunterricht oder in einem fächerübergreifenden Projekt sich mit den Texten Hölderlins auseinanderzusetzen, beispielsweise mit denen zur Ästhetik und Naturlyrik. Für Lehrerinnen und Lehrer in Tübingen und Umgebung bietet es sich zudem an, dieses mit einem Besuch im Hölderlinturm zu verbinden, in dessen Turmzimmer der Dichter immerhin 36 Jahre wohnte. Fazit: Rüdiger Safranski ist mit „Hölderlin“ wieder ein biographisches Meisterwerk gelungen, durch das alle an Hölderlin oder dem Deutschen Idealismus Interessierte profunde Einblicke in Leben und Werk des philosophischen Dichtergenies erhalten. Dr. Marcel Remme, für lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Komm! ins Offene, Freund! Biographie Erscheinungsdatum: 21.10.2019 336 Seiten Hanser Verlag Fester Einband ISBN 978-3-446-26408-3 Deutschland: 28,00 € Österreich: 28,50 € ePUB-Format E-Book ISBN 978-3-446-26501-1 E-Book Deutschland: 20,99 € Zum 250. Geburtstag Friedrich Hölderlins: Rüdiger Safranskis Biographie über den großen unbekannten Dichter Dies ist die Geschichte eines Einzelgängers, der keinen Halt im Leben fand, obwohl er hingebungsvoll liebte und geliebt wurde: Friedrich Hölderlin. Als Dichter, Übersetzer, Philosoph, Hauslehrer und Revolutionär lebte er in zerreißenden Spannungen, unter denen er schließlich zusammenbrach. Erst das 20. Jahrhundert entdeckte seine tatsächliche Bedeutung, manche verklärten ihn sogar zu einem Mythos. Doch immer noch ist Friedrich Hölderlin der große Unbekannte unter den Klassikern der deutschen Literatur. Der 250. Geburtstag im März 2020 ist eine gute Gelegenheit, sich ihm und seinem Geheimnis zu nähern. Rüdiger Safranskis Biografie gelingt das auf bewundernswerte Weise. Inhaltsverzeichnis
INHALT
Vorwort Erstes Kapitel Herkommen. Ehrbarkeit. Hölderlin hält auf sich. Die Väter sterben, die Mutter bleibt. Götter der Kindheit. Mutterbeziehung. Köstlin. Wunderkind Schelling. 15 Zweites Kapitel Denkendorf. Klösterliches. Brief an Köstlin. Pietistische Seelenprüfung. Selbstbehauptung einer Seele gegen das »Weltliche«. Angst vor Selbstverlust. Das liberale Maulbronn. Erste Liebesgeschichte. Pindars Flug und Klopstocks Größe. Als Dichter zur Welt kommen. 27 Drittes Kapitel Tübinger Stift. Lust zu lernen. Hölderlin studiert Kant und Spinoza. Die Vernunft und die Gründe des Herzens. Religion der Liebe. Der Freundesbund und das »Reich Gottes«. Hegel. Schelling. Revolutionärer Enthusiasmus im Stift. Der »Genius der Kühnheit«. 43 Viertes Kapitel Philosophische Thronerhebung der schöpferischen Einbildungskraft. Selbstermächtigung. Der Dichterbund. Magenau. Neuffer. Stäudlin. Frühe Hymnen, allzu erhaben. Literatur und Leben. Hölderlin kein Romantiker. Die Gräkomanie, Schillers »Die Götter Griechenlands« und Hölderlins Antike. Wiederkehr der Götter? »Hyperions« Beginn. 59 Fünftes Kapitel Die Zeit im Stift geht zu Ende. Politische Unruhen. Renz. Besser ein Hofmeister als ein Prediger. Charlotte von Kalb. Hölderlin bei Schiller in Ludwigsburg. Elise Lebret. Abschied und Aufbruch nach Waltershausen. 75 Sechstes Kapitel Waltershausen. Aus der Ferne die Freundschaften erneuern. Liebesgeschichten ohne Belang. Marianne Kirms. »Hyperion«. Das erste Fragment. Griechenland hat Konjunktur und die Romanform. Hölderlin sucht den Erfolg beim Publikum. Vorrede zu »Hyperion«. Exzentrizität und Sündenfall. Suche nach dem erfüllten Sein. Ekstatische Augenblicke, doch nicht von Dauer. 87 Siebtes Kapitel Schiller veröffentlicht das »Hyperion«-Fragment. Schwierigkeiten mit dem Zögling. Das Onanie-Problem. Trennung vom Hause Kalb. Jena. Schillers »liebster Schwabe«. Misslungene Begegnung mit Goethe. Fichtes »Ich« und Hölderlins Suche nach dem Sein. »Urtheil und Seyn«. Umarbeitungen des »Hyperion« unter philosophischem Einfluss. Achtes Kapitel Plötzliche Abreise aus Jena. Schillers Nähe gesucht und geflohen. In die Philosophie verstrickt. Quälende Widersprüche. Philosophie der Freiheit und der junge Schelling. Philosophie oder Poesie. »Das älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus«. Die Stiftung einer neuen Mythologie und die Schönheit. 123 Neuntes Kapitel »An die Natur« – von Schiller abgelehnt. Die Liebesgeschichte mit Susette beginnt. Idylle von Bad Driburg. Der Erotiker Wilhelm Heinse als Aufsichtsperson. »Ardinghello und die glückseligen Inseln«. Französischer Vormarsch. Politische Enttäuschung und Hoffnung auf die deutsche Kulturnation. Selbstbehauptungsträume. »Die Eichbäume« – von Schiller angenommen. 139 Zehntes Kapitel »Hyperion« – die endgültige Fassung. Was dazugekommen ist. Der politische Kampf, die Enttäuschung. Alabanda und Sinclair. Diotima und Susette. Neues Selbstbewusstsein. Die Schimpfrede gegen die Deutschen. Das Göttliche. Hölderlins Verzückungsspitzen. »Hyperion« als Roman über die Geburt eines Dichters. Goethe und Schiller beraten sich über Hölderlin. Krise im Hause Gontard. Hölderlins Abgang. 155 Elftes Kapitel Mit Sinclair nach Rastatt. Neue Freunde. Revolutionäre Erwartungen. »Empedokles«. Alles auf eine Karte setzen, politisch und persönlich. Vereinigungsmystik und Politik. Die dramatische Form geht verloren, der politische Anlass auch. Das Eigene im »Empedokles«. Zeitschriftenprojekt – gescheitert. Der heimliche Briefwechsel mit Susette. Aussichtslosigkeit. 175 Zwölftes Kapitel Hölderlin bleibt im Verborgenen. Sein Dichten aber öffnet sich gewaltig. Der begnadete Sommer 1800 in Stuttgart bei Landauer. Komm! ins Offene, Freund! Die großen Hymnen und Elegien. »Der Gang aufs Land«. »Menons Klagen um Diotima«. »Der Archipelagus«. »Brod und Wein«. 195 Dreizehntes Kapitel Die Wonnen der Gewöhnlichkeit. »Abendphantasie«. Hauptwil. Vaterländisches. Der revolutionsfromme Hölderlin. Der Friede von Lunéville. Zeitenwende, Eschatologisches. »Friedensfeier«. Die Geburt eines Gedichtes aus einem anderen. »Wie wenn am Feiertage …« und »Hälfte des Lebens«. Heimkunft. Hilferuf an Schiller. »Sie können mich nicht brauchen.« 219 Vierzehntes Kapitel Die Winterreise nach Bordeaux. Der Zauber des Ortes. Rätselhafte Abreise. Spekulationen. Unter den Schlägen des Apoll. Susettes Tod. Ankunft in Stuttgart und Nürtingen, verwirrt, verwahrlost. Raserei. Gegen die Mutter. Mit Sinclair nach Regensburg. Die »Patmos«-Hymne. »Andenken«. Fünfzehntes Kapitel Querfeldein nach Murrhardt, zu Schelling. Hölderlins Sophokles- Übersetzungen. Das Fremde wird fremder. Umsiedlung nach Homburg. Verhängnisvolle Tafelrunden in Stuttgart. Die Denunziation Blankensteins. Sinclairs Verhaftung. Hochverratsprozess. Hölderlin im Fadenkreuz. »Ich will kein Jacobiner seyn!« Hölderlin zerstört das Klavier. Abtransport. 257 Sechzehntes Kapitel In Autenrieths Psychiatrie. Beim Schreinermeister Zimmer. Im Turm, Zimmer mit Aussicht. Lebbarkeit. Immer noch ein schöner Mann. Briefe an die Mutter. Am Klavier, singen. Gedichte aus dem Stegreif. Wie verrückt? Die Hauptquellen: Varnhagen von Ense, Wilhelm Waiblinger und Christoph Schwab. Wenn die Phantasie sich auf Kosten des Verstandes bereichert. Hölderlins sanfter Tod. 269 Siebzehntes Kapitel Romantiker entdecken Hölderlin. Bettine und Achim von Arnim. Brentano, Görres. Die treuen Schwaben, das Junge Deutschland. Die ersten Ausgaben. Der junge Nietzsche liest Hölderlin. Hellingrath und Stefan George entdecken Hölderlin. Der Durchbruch. Der Missbrauch. Heidegger liest Hölderlin. Nach 1945: Unendlicher Deutung voll! 287 Literatur 309 Zeittafel 317 Register 334 |
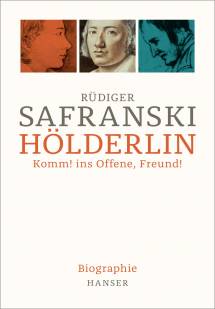
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen