|
|
|
Umschlagtext
Dieser Band enthält 66 Praxisberichte von Lehrerinnen und Lehrern. Entstanden sind ermutigende Beispiele gelungener Praxis, deren gemeinsames Kennzeichen ihre Realitätsnähe ist, durch die - trotz unterschiedlicher Rahmenbedingungen - Anregungen für die eigene Schulentwicklung gegeben werden können.
Erziehung, Unterricht und Lebensweltbezug werden als drei Schwerpunkte der Hauptschulbildung definiert. Dementsprechend zeigt das erste Kapitel, wie der einzelne Schüler gestärkt und zugleich die Schulgemeinschaft gestaltet werden können. Kapitel zwei handelt vom Unterricht.. Möglichkeiten, den Unterricht schülerorientiert, lebendig und erfolgreich zu gestalten, werden gezeigt. Im dritten Kapitel werden Wege skizziert, den "Schonraum Schule" einerseits zu wahren und zugleich den Schüler zum risikobelasteten Handeln als Erwachsener in Beruf, Gesellschaft und Privatleben hinzuführen. Abschließend wird diskutiert, welche Anregungen die Praxisberichte für die Weiterentwicklung des Hauptschulbildungsgangs geben können und von welchen Veränderungen struktureller Rahmenbedingungen (in Schulsystem und Lehrerbildung) positive Impulse für die Weiterentwicklung des Hauptschulbildungsganges ausgehen können. Rezension
Die Hauptschule bildet das differenzierteste und vielleicht schwierigste pädagogische Aufgabenfeld im Sekundar-I-Bereich wegen der unterschiedlichen Lernvoraussetzungen und der sozio-kulturell höchst differenzierten Lebenslagen der Schüler/innen. Auch kann sich die Hauptschule als Pflichtschule ihrer Problemfälle nicht durch Aussonderung entledigen. Die Hauptschule bildet nicht selten ein schulisches Netz, das diejenigen auffängt, die in anderen Bildungsgängen nicht zurecht kommen. Endlich hat die Hauptschule erhebliche Mitverantwortung beim Ausgleich familiärer Erziehungsmängel und sozialer Benachteiligungen. U.a. deswegen ist es wichtig, dem Hauptschulbildungsgang ein eigenes Handbuch zu widmen, wie es hier geschieht.
Der erste Band hatte Grundlegendes thematisiert: Das erste Kapitel leistet eine Bestandsaufnahme der vielfältigen Erscheinungsformen des Hauptschulbildungsganges im wiedervereinigten Deutschland. Das zweite Kapitel wendet sich den Lebenslagen und der Sozialisation der Schüler/innen und den erzieherischen Konsequenzen zu. Das dritte Kapitel formuliert Aufgaben und Grundsätze der Hauptschulbildung unter dem Prinzip der Schülerorientierung. Das vierte Kapitel schließlich thematisiert zentrale Bedingungen der Schulentwicklung. Der hier anzuzeigende zweite Band bietet 66 ermutigende und realitätsnahe Praxisberichte von Lehrerinnen und Lehrern aus den unterschiedlichsten Hauptschulkontexten. Oliver Neumann, lehrerbibliothek.de Inhaltsverzeichnis
Einleitung 11
1 Selbstvertrauen stärken — Gemeinschaft bilden Hein-Jürgen Ipfling Einführung 13 Eva Schmoll Jugendliche und ihre Familien willkommen heißen 16 Claudia Reutier Neuer Start in die Hauptschule 22 Otto Langlois Schulanfang auf neuen Wegen 27 Stephanus Stritzke Förderkonzept für die schulische Eingliederung ausländischer und ausgesiedelter Schüler 31 Gisela van Geisten und Siegfried Arnz Angebote für Schüler mit speziellem Förder- und Integrationsbedarf 36 Anita Krüger und Ilse Ludwig Individualisierendes Lernen von extrem verhaltensauffälligen und 'zerlernten' Schülern 40 Nico/a Derrien 'Auszeit' - Chance zum selbstverantworteten Lernen 46 Dagmar Reimnitz Die Schulstation 50 Petra Adam, Elke Cordeiro und Eva Schmoll Eine Werkstatt wird zur Lern-Werkstatt umfunktioniert 53 Ute Scheunemann Förderung sozialer Kompetenzen in Projekten 58 Käthe Schübel Kampf dem Montagssyndrom 62 Maria Eindner, Manfred Walter und Brigitte Wüllner Die Fäuste bleiben in der Tasche! — Schüler als Schlichter 65 Irmi Euteneuer-Bruna und Franz-Josef Meiser Projekt zur Unterstützung der Identitätsfindung 71 Helmut Stroh Der Klassenrat 77 Eva Schmoll Von dem Versuch das Schulleben zu ordnen 81 Rainer Sturm Schüler gestalten Pausenhöfe 88 Anneli Domnick Schule — Umwelt — Harmonie 92 Mike Beutelmeier Happy Hour in der Schule 94 Regina Schiveder Der Zirkus Wülfrathelli 99 LotharJäcker Zusammenarbeit Schule — Eltern im Förderverein 104 2 Lebendig unterrichten — Lernfreude entwickeln Dietmar J. Bronder Einführung 112 Elke Cordeiro und Eva Schmoll Methodentraining 115 Mona Sommer und Susanne Stünckel Von der Torwand zum Lerntagebuch 121 Stefanie Antoniadis-Wiegel Wir spielen — also lernen wir 127 Eva Schmoll 'Giftblättle' oder vom wirklichen Nutzen der Zeugnisse 133 Heinz Strauf Epochenunterricht 140 Josef Schätz Team-Teaching 145 Klaus Glorian Freinetpädagogik 154 Karin ]aeger, Jeus Großpietsch und Horst Fehmers Binnendifferenzierung und Förderunterricht 159 Reiner Düchting Projekte — Praktika — Lernortverbindungen 165 Hugo-Christian Dietrich Planen — Handeln — Verantworten 171 Werner Hüffer Firmengründungsprojekt im Arbeitslehreunterricht 174 Klaus Forner Schüler bauen für Schüler 180 Renate Eichler und Anne Welp Gesundheit durch Ernährung 187 Alfred Hinz Die Jahresarbeit in der Hauptschulabschlussprüfung 191 Stefanie Antoniadis-Wiegel „Eulenstraße 7" Hauptschülerinnen der Klasse 7 schreiben einen Roman 198 Michael Pietrus Integrativer Deutschunterricht zum Thema „Keine Macht den Drogen" 203 Stefanie Antoniadis-Wiegel Schülerinnen entwickeln ihre Diktate selbst 206 Anne Welp Freiarbeit im Mathematikunterricht der Klassen 5 und 6 209 Victoria Herrmann und Doris Maysay Project-based Teaching 213 Horst Fehmers Tanzen und springen, hören und bestimmen 219 Karl Ernst Christmann Auf dem Weg zur ökologischen Schule 225 Karl Ernst Christmann Bau und Betrieb eines Bienenhauses 229 Klaus Feucht Solarträume werden wahr 232 Josef Schätz Computer- und Internet-Werkstatt 236 Hartmut Malecha Aufbau und Pflege eines virtuellen Marktplatzes 246 Micha Böckler Offene Schule 2001 251 Ulf Neumann „Dürfen wir wieder an den Computer?" 256 3 Ausbildungsfahigkeit fördern — Lebenshilfe geben Karl G. Zenke Einführung 261 Dietmar]. Bronder und Michael Drogand-Strud Jungen zwischen Beruf und Haushalt 264 Ute Scheunemann Das Projekt: Selbstbehauptung für Mädchen 268 Ulrike Flaspöhler, Frank Schlaak und Ingelore Sengstmann-Schaefer Rambo oder Barbie? Wir können auch anders! 272 Gisela Knigge Training sozialer Fähigkeiten im Übergang Schule/Beruf 278 Fritsche MacSchool — Schüler gründen eine eigene Firma 282 Gisela van Geisten und Siegfried Arnz Die Cafeteria: Unterrichtsprojekt im Fach Arbeitslehre 288 Gitta Hacia und Hans Werner Jorda Schülercafe als Ort der Jugendsozialarbeit 292 Dieter Stöcklein Aktionäre und Unternehmer in der Schule 297 Dorothee Wassener „Unsere Eltern? - Die arbeiten und verdienen Geld." 302 Wolfgang Klink Lernortkooperation: Handwerk und Hauptschule 307 Hans Otto Meier Werkstatttag mit sozialem Hintergrund 311 Helmut Merker und Winfried Funk Dienstags im Betrieb: Technikunterricht in Lehrwerkstätten 315 Axel Beilhartz Jahrespraktikum 319 Peter Schmid Projektprüfung im Fach Technik 325 Martin Zielke Freizeitbörse 331 Ulrich Scheufele Alle Tage Theater 334 Bernd Hesse Jung und Alt unter einem Dach 340 Gotthilf Gerhard Hiller „Ich hab überhaupt kein Geld!" 346 Claudia Haug Warum heiraten? 356 Heinz-Jürgen Ipfing und Karl G. Zenke Zur Weiterentwicklung des Hauptschulbildungsgangs 1 Über die Möglichkeiten und Grenzen aus Praxisbeispielen für Schulreform zu lernen 363 1.1 Im Mittelpunkt die Schüler, nicht die Schule! 363 1.2 Aufgabenfelder der Hauptschularbeit 364 1.3 Wesentliche Gegebenheiten für Reformprozesse 365 1.4 Sekundärschule im Konzept eines pädagogischen Klassikers: Wilhelm von Humboldt 369 2 Welche Anstöße geben die Praxisbeispiele für die Schulreform? 371 2.1 Der Erziehungsprozess 371 2.2 Der Unterrichtsprozess 375 2.3 Die Schule als lernende Institution 379 3 Bildungspolitische Orientierungen 383 3.1 Grundlegende Erneuerung 383 3.2 ... statt halbherziger Reformen 383 3.3 Neustrukturierung der Sekundarstufe I 386 3.4 Europäische Perspektiven 388 Anhang Stichwortverzeichnis 391 |
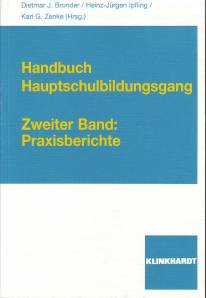
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen