|
|
|
Umschlagtext
Dieser Band gibt eine umfassende Einführung in die Wortgrammatik des Deutschen: Phonetik und Phonologie, Flexions- und Wortbildungslehre sowie Othographie. Mit über 200 Arbeitsaufgaben zum Selbststudium.
Rezension
Peter Eisenbergs Grundriss der deutschen Grammatik ist ein Standardwerk: Es vermittelt die Grundlagen, aber auch die Eckpunkte und problematischen Fälle der deutschen Grammatik. Zielgruppe sind dabei vor allem Studierende der Germanistischen Linguistik und Lehrer, die ihre Kenntnisse aus dem Studium auffrischen wollen. In jedem Fall handelt es sich um eine Grammatik, die gerade Muttersprachler für die Besonderheiten ihrer Sprache sensibilisieren möchte und damit eine Reflexion über die täglich verwendete Sprache und ihre grammatischen Phänomene ermöglicht. Darin ist der Grundriss sehr erfolgreich, erscheint er doch bereits in 3. Auflage.
Der erste Teil der zweibändigen Grammatik widmet sich sich dem Wort, und zwar seiner phonologischen (lautlichen) Zusammmensetzung, seiner Morphologie und Flexion (Wortbildung und -beugung) sowie der (daraus resultierenden) Orthographie (Rechtschreibung). Dies geschieht nicht nur durch übersichtliche und gut verständliche Darstellung unter Einbeziehung der Forschungsliteratur auf dem neuesten Stand, sondern auch durch praktische Beispiele: 200 Übungsaufgaben mit Lösungsvorschlägen folgen dem Darstellungsteil; außerdem helfen Graphiken und schematische Darstellungen bei der Vorstellung des Gelesenen. Ausschlaggebend für eine Neuausgabe war die verbindliche Umstellung auf die reformierte Rechtschreibung im August 2006: So wird im 8. Kapitel gerade Lehrern, die diese ja vermitteln müssen, eine grundlegende Darstellung von Rechtschreibregeln und ihrer Problematik vorgelegt. Melanie Förg, Lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Peter Eisenberg Grundriss der deutschen Grammatik Band 1: Das Wort Standardwerk zur deutschen Grammatik Jetzt in neuer Rechtschreibung In sich abgeschlossene Teilbände Mit jeweils rund 200 Aufgaben und Lösungen Inklusive Benutzerhinweise, Wort- und Affixregister und rückläufigem Wortregister Autor Peter Eisenberg, geb. 1940; Studium der Nachrichtentechnik, Informatik, Musik und Sprachwissenschaft; Professor em. für Deutsche Philologie an der Universität Potsdam; längere Studien- und Arbeitsaufenthalte in den USA, der Volksrepublik China, Frankreich, Iran und Ägypten; 1990-92 Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Sprachwissenschaft; 1996 Deutscher Sprachpreis der Henning-Kaufmann-Stiftung; Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Mitglied des Rates für deutsche Rechtschreibung. Inhalt Wort und Satz gelten als kommunikative Säulen einer Sprache. Der `Grundriss der deutschen Grammatik` greift diese Zweigliederung auf. Die Teilbände `Das Wort` und `Der Satz` ergänzen sich und sind zugleich unabhängig voneinander einsetzbar. Präzise und gut verständlich wird die gesamte Grammatik ausgebreitet. Rund 200 Aufgaben und Lösungen führen differenzierte Analysewege vor. Ein glänzendes Lehrbuch, auch für das Selbststudium geeignet. Der Teilband `Das Wort` fächert die Wortgrammatik des Deutschen in ihre großen Themenfelder auf: Phonetik und Phonologie, Morphologie und Orthografie. (www.metzlerverlag.de) Inhaltsverzeichnis
3-476-02160-2 Eisenberg, 3. A. Bd. 1 Das Wort
© 2006 Verlag J.B. Metzler (www.metzlerverlag.de) Inhaltsverzeichnis Vorwort zur 1. Auflage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII Vorwort zur 3. Auflage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX Hinweise für den Benutzer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X Abkürzungen und Symbole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XII 1. Rahmen, Zielsetzungen, Grundbegriffe . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1.1 Gegenstand und Aufbau von Grammatiken . . . . . . . . . . . . . 1 1.2 Grammatik und Norm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.3 Grammatische Beschreibungsmittel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 1.3.1 Syntaktische Struktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1.3.2 Syntaktische Relationen, Argumente, Diathesen . . . . . . . . . . . 21 1.3.3 Morphologische und phonologische Struktur . . . . . . . . . . . . 28 1.4 Zur Gliederung des Wortschatzes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 2. Die phonetische Basis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 2.1 Phonetik und Sprachsignal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 2.1.1 Übersicht: Phonetische Beschreibung von Lautereignissen . . . . . 40 2.1.2 Töne, Geräusche, Laute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 2.1.3 Artikulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 2.2 Phonetische Kategorisierung der Sprachlaute . . . . . . . . . . . . . 55 2.2.1 Konsonanten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 2.2.2 Vokale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 2.3 Symbolphonetik und Transkriptionssysteme . . . . . . . . . . . . . 72 2.3.1 Verschriftung gesprochener Sprache . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 2.3.2 Das Internationale Phonetische Alphabet . . . . . . . . . . . . . . . 76 3. Segmentale Phonologie: Phoneme . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 3.1 Opposition und Kontrast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 3.2 Phoneminventar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 3.2.1 Das Basissystem der Konsonanten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 3.2.2 Das Basissystem der Vokale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 4. Silben, Fußbildung, Wortakzent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 4.1 Übersicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 4.2 Der Einsilber und das Allgemeine Silbenbaugesetz . . . . . . . . . . 102 4.3 Die Bestandteile der Silbe. Variation und Alternation der Laute . . 115 4.3.1 Anfangsrand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 4.3.2 Kern und Endrand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 4.4 Mehrsilber und Fußbildung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 4.5 Der Wortakzent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 4.5.1 Einfache und affigierte Stämme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 4.5.2 Kompositionsakzent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 5. Flexion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 5.1 Flexion und Paradigmenbildung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 5.2 Nominalflexion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 5.2.1 Das Substantiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 5.2.2 Pronomen und Artikel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 5.2.3 Das Adjektiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 5.3 Verbflexion und verbales Paradigma . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 5.3.1 Übersicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 5.3.2 Das System der Personalformen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 5.3.3 Tempus und Modus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 5.3.4 Gesamtbau des verbalen Paradigmas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 6. Wortbildung I: Allgemeines, Komposition . . . . . . . . . . . . . . 209 6.1 Wortbildung als Teil der Morphologie . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 6.1.1 Wortbildungstypen. Wortbildung und Flexion . . . . . . . . . . . . 209 6.1.2 Morphologische Kategorien, Strukturen, Funktionen . . . . . . . . 217 6.2 Komposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 6.2.1 Das Determinativkompositum und seine Subtypen . . . . . . . . . 226 6.2.2 Die Fuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 6.2.3 Konfixkomposita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 7. Wortbildung II: Affigierung und Konversion . . . . . . . . . . . . . 247 7.1 Präfixe und Partikeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 7.1.1 Nominale Präfixe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 7.1.2 Verbpräfixe und ihre Abgrenzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 7.1.3 Verbpartikeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 7.2 Suffixe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 7.2.1 Native Suffixe: Bestand und Einzelanalysen . . . . . . . . . . . . . 269 7.2.2 Das System der nativen Suffixe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 7.2.3 Fremdsuffixe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 7.3 Konversion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 8. Die Wortschreibung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 8.1 Graphematik und Orthographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 8.2 Buchstabenschreibung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 8.2.1 Phoneme und Grapheme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 8.2.2 Silbische Schreibungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 8.2.3 Morphologische Schreibungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 8.3 Silbentrennung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 8.4 Getrennt- und Zusammenschreibung . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 8.5 Groß- und Kleinschreibung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 8.6 Zur Schreibung der Fremdwörter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 VI | Inhaltsverzeichnis Aufgabenstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 Lösungshinweise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 Siglen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432 Literaturverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434 Sachregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453 Wort- und Affixregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 Rückläufiges Wortregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492 Leseprobe 3-476-02160-2 Eisenberg, 3. A. Bd. 1 Das Wort © 2006 Verlag J.B. Metzler (www.metzlerverlag.de) Vorwort zur 1. Auflage Der ›Grundriss‹ stellt sich zwei Aufgaben. Erstens will er die Kernbereiche der deutschen Grammatik in ihren Hauptlinien und unter Berücksichtigung neuerer Forschungsergebnisse darstellen. Zweitens möchte er den Leser in die Lage versetzen, grammatische Analysen nicht nur nachzuvollziehen, sondern auch selbst durchzuführen und zu bewerten. Die Neuausgabe der Grammatik erscheint in zwei Teilen, die einheitlich konzipiert, aber unabhängig voneinander verwendbar sind. Der vorliegende erste Teil umfasst die Phonologie, Morphologie und Orthographie des Deutschen, also seine Wortgrammatik. Im zweiten Teil mit dem Untertitel ›Der Satz‹, der voraussichtlich im Herbst 1999 erscheint, findet sich die Syntax. Der zweite Teil wird eine stark überarbeitete, in großen Teilen neu geschriebene Fassung der 3. Auflage von 1994 enthalten. Bis zum Abschluss dieses Buches ist mehr Zeit ins Land gegangen als ursprünglich erwartet. Mindestens einer der Gründe dafür liegt in der Sache selbst. Die Wortgrammatik bestand bis in die jüngste Vergangenheit hinein aus getrennten Gärten: Phonologie und Morphologie hatten sich wenig zu sagen, eine Graphematik gab es innerhalb der Sprachwissenschaft kaum. Das hat sich in der Tendenz geändert. Aber es bleibt schwierig, zu einem einheitlichen und handhabbaren Konzept zu gelangen, mit dem die etablierten wie die bisher eher vernachlässigten Bereiche der Wortgrammatik zugänglich werden. Wortakzent und Fremdwortmorphologie, Verbpartikeln und Silbentrennung, Konversion und Adjektivflexion sollen ihren Platz finden. Mein erster Dank geht deshalb an die ehemaligen Studentinnen und Studenten von der Freien Universität Berlin, die in ihren Magisterarbeiten und Dissertationen einzelne Bereiche der Wortgrammatik bearbeitet haben. Matthias Butt, Ursula Enderle, Stefanie Eschenlohr, Nanna Fuhrhop, George Smith, Oliver Teuber und Rolf Thieroff haben Wesentliches beigetragen. Bezugspunkt für die konzeptionelle Arbeit war immer wieder Hans-Heinrich Liebs ›Integrative Sprachwissenschaft‹, vor allem in den Fassungen, die im Literaturverzeichnis als Lieb 1983 und 1992 ausgewiesen sind. Dass ich mich eine Zeit lang ganz auf das Schreiben konzentrieren konnte, ist einem Forschungssemester zu verdanken, das die Deutsche Forschungsgemeinschaft bewilligt hat. Gerade wenn an ein Buch hohe Integrationsanforderungen gestellt sind, bleibt der fremde Blick auf das Manuskript eine unschätzbare Hilfe. Matthias Butt, Ursula Enderle, Helmut Glück, Hartmut Günther, Ewald Lang, Hans- Heinrich Lieb, Bernd Pompino-Marschall, Beatrice Primus und Rolf Thieroff haben Teile des Textes gelesen und kommentiert. Ewald Langs freundschaftliche Unterstützung hat manches bewirkt, sie reichte vom inhaltlichen Rat bis zur Kärrnerarbeit des Korrekturlesens. In der Bad Homburger Studiengruppe ›Geschriebene Sprache‹ ist vor allem die Graphematik diskutiert worden. Kapitel 8 beschreibt die Regularitäten der Wortschreibung einschließlich der wesentlichen Änderungen durch die Neuregelung von 1996. Entstanden ist dieser Teil des Buches während der Zeit meiner Mitgliedschaft in der zwischenstaatlichen Kommission für deutsche Orthographie. Wer weiß, ob sich ohne den Zusammenhalt der Studiengruppe das 8.Kapitel nicht im Zorn über die Neuregelung verloren hätte. Über zwei Jahre hinweg hat Maria Pichottka Stück für Stück das Typoskript erstellt und immer wieder korrigiert, freundlich, umsichtig und hilfsbereit. Zum Schluss musste natürlich alles ganz schnell gehen. In kürzester Zeit haben Katharina Krause und Melody Lacy die technische Seite der Registerherstellung bewältigt. Für George Smith war es kein Problem, während eines halben Tages auch noch das rückläufige Wortregister auf die Beine zu stellen. Allen Genannten sowie vielen Freunden, Kollegen und ganz besonders meiner Familie danke ich herzlich für ihre Geduld und Unterstützung. Potsdam, 16. Juli 1998 Peter Eisenberg Vorwort zur 3. Auflage Für die Neuauflage wurde ›Das Wort‹ insgesamt leicht überarbeitet. Irrtümer wurden korrigiert, außerdem einige Hinweise auf neuere Literatur hinzugefügt. Der Umbruch blieb erhalten, so dass die zweite Auflage problemlos gemeinsam mit der dritten verwendet werden kann. Wichtigste Änderung ist die Umstellung des Textes auf die seit August 2006 verbindliche Neuregelung der Orthographie. Für diesen Schritt gab es viele Gründe. Der wohl wichtigste: Ein Buch, das u.a. viel in der Lehrerbildung verwendet wird, sollte sich auf die Dauer nicht der Schreibweise verweigern, die das tägliche Brot der Lehrer ist. Die Umstellung erfolgt nach bestem Wissen – falls etwas übersehen wurde, bitten wir um Verständnis – und sie erfolgt auch dort, wo die Neuregelung nach Auffassung des Autors noch immer Mängel hat. Einige weitere Bemerkungen dazu finden sich bei den Hinweisen für den Benutzer. Viele Leserinnen und Leser haben auch diesmal mit Anregungen und Hinweisen zur Verbesserung des Textes beigetragen. Allen danke ich herzlich. Berlin, 27. April 2006 Peter Eisenberg | IX Vorwort Hinweise für den Benutzer Das vorliegende Buch soll zum Selbststudium wie als Grundlage von Lehrveranstaltungen zur deutschen Grammatik geeignet sein. Aufbau und interne Organisation des Buches tragen beiden Verwendungsweisen Rechnung. Die eigentliche Wortgrammatik beginnt mit Kap. 3 (Segmentale Phonologie). Ihr gehen ein Einleitungskapitel und eine kurzgefasste Phonetik voraus. Kapitel 1 bringt eine allgemeine Orientierung über die Aufgaben von Grammatiken und führt an einfachen Beispielen vor, wie sie im weiteren angepackt werden. Es macht darüber hinaus Aussagen zum Normproblem sowie zum Umfang und zur Makrostruktur des Wortschatzes. Auch Kap. 2 (Die phonetische Basis) enthält Grundlegendes für die weiteren Kapitel, muss aber nicht unbedingt vor ihnen bearbeitet werden. Man kann die Phonetik auch selektiv lesen, beispielsweise indem ein Seminar zur Orthographie (Kap. 8) mit Transkriptionsübungen (Kap. 2.3) gekoppelt wird. Kapitel 2 soll das bereitstellen, was man insgesamt an Phonetik für die Wortgrammatik braucht. Dem Text sind über 200 Aufgaben (zusammengefasst in 124 Gruppen) beigegeben. Dem Leser wird empfohlen, den Textverweisen auf die Aufgaben unmittelbar zu folgen und diese wenigstens im Ansatz zu lösen. Es gibt keine effektivere Methode zur Aneignung grammatischer Kenntnisse als das Grammatiktreiben selbst. Dabei ist der Grundriss nicht darauf aus, nur ganz einfache und sofort zugängliche Aufgaben zu formulieren. Aber die Lösungshinweise sind so ausführlich, dass zumindest ein Lösungsweg erkennbar wird. Der detaillierten Erschließung des Textes dienen die Register. Das Sachregister enthält nicht Verweise auf jede Nennung des Stichwortes im Text, sondern möchte sich auf sinnvolle Suchergebnisse beschränken. Auch der jeweils gewählte Grad an Differenziertheit von Stichwörtern und Unterstichwörtern ist variabel, und im Register finden sich einige Termini, die sonst in dieser Grammatik kaum verwendet werden. Verweise sind mit einem Pfeil gekennzeichnet, der zu lesen ist als »siehe« oder »siehe auch«. Verweise auf Textstellen, an denen ein Begriff eingeführt wird, sind durch Fettdruck hervorgehoben. Alle Hauptstichwörter sind Substantive. Ein Verweis auf koronale Laute erscheint also beispielsweise unter ›Koronal‹. Im zweiten Register sind Wörter in der Grundform und Wortbildungsaffixe (einschließlich der Halbaffixe, Konfixe usw.) verzeichnet. Zur besseren Orientierung ist der Affixstatus durch morphologische Grenzen (+) gekennzeichnet als Präfix oder Verbpartikel (z. B. ent+ wie in entkernen), als Suffix (+sam wie in strebsam), als Infix (+t+ wie in namentlich) oder Zirkumfix (ge++t wie in gestreckt). Vor allem in den Wortbildungskapiteln enthalten manche Beispiellisten mehr Wörter als das Wortregister. Mit der Beschränkung soll eine Aufblähung des Registers vermieden werden. In das rückläufige Wortregister wurden nur Grundformen von Wörtern, nicht aber Affixe aufgenommen. Im Text finden sich Verweise vom Typ ›Satz, 4.5‹. Damit ist der entsprechende Abschnitt im zweiten Teil der Grammatik (›Der Satz‹) gemeint. Der Hauptverweis auf eine Aufgabe erfolgt in Fettdruck (z. B. Aufgabe 94a), andere Verweise auf dieselbe Aufgabenstellung in Normaldruck. Ins Verzeichnis der Abkürzungen und Symbole wurde das aufgenommen, was nicht zum Inventar des IPA gehört. Die Umstellung auf neue Orthographie wurde im Allgemeinen sowohl im Text als auch in den behandelten Beispielen vorgenommen. Alte neben neuen und mögliche neben ausgeschlossenen Schreibweisen finden sich in einigen Beispielen dort, wo es gerade um die Besprechung von orthographischen Regularitäten geht. Das ist vor allem in Kapitel 8 der Fall, aber nicht nur dort. So werden in Aufgabe 67 einige Wörter mit dem nicht mehr produktiven Suffix at aufgeführt (Heimat, Monat, Zierat). Bei Zierat wird vermerkt, dass seit der Neuregelung von 1996 Zierrat zu schreiben ist. Im Wortregister tauchen beide Formen auf. Die alten Schreibweisen plazieren, Akzentplazierung usw. wurden beibehalten und nicht zu platzieren, Akzentplatzierung geändert. Aus den Abschnitten 7.2.3 und 8.6 zur Fremdwortmorphologie bzw. zur Fremdwortschreibung geht hervor, warum die neue Schreibung mit tz regelwidrig ist. | XI Hinweise für den Benutzer 1. Rahmen, Zielsetzungen, Grundbegriffe 1.1 Gegenstand und Aufbau von Grammatiken Was Grammatiken beschreiben Mit deutschen Grammatiken füllt man leicht ein stattliches Bücherregal, nur wenige Sprachen sind so häufig, so ausführlich und auf so vielfältige Weise beschrieben worden wie das Deutsche. Dabei ist die Verschiedenheit der Grammatiken eigentlich beeindruckender als ihre große Zahl. Sehen wir uns nur einmal die sogenannten wissenschaftlichen Grammatiken an, die wir in der weiteren Darstellung regelmäßig zu Rate ziehen werden. Für eine Grammatik aus dem späten 19. und noch dem frühen 20. Jahrhundert ist es selbstverständlich, die Beschreibung des Deutschen als Beschreibung seiner Geschichte zu verstehen. Damit ist fast zwingend ein besonderes Verhältnis zu den Daten verbunden. Die großen Grammatiken sind nicht nur materialreich (Blatz 1896, 1900), sondern sie machen meist auch genaue Angaben darüber, woher das Material stammt. Sie nennen ihre Quellentexte und lokalisieren die Belege (Wilmanns 1896, 1906; Paul 1917, 1920). Neuere Grammatiken konzentrieren sich in der Regel auf das Gegenwartsdeutsche und überlassen die Sprachgeschichte speziellen Darstellungen. Auch in anderer Hinsicht sind sie weniger umfassend als viele ältere. Als Kerngebiete gelten die Formenlehre (Flexionsmorphologie) und Satzlehre (Syntax), danach die Wortbildungsmorphologie. Nur selten enthalten sie eine Lautlehre (Phonologie), wie sie in der Akademiegrammatik aus der DDR, den ›Grundzügen‹ (Heidolph u.a. 1981) zu finden ist. Noch seltener ist eine Orthographie. In schulischen Lehrplänen spricht man meist von ›Orthographie und Grammatik‹, d. h. erstere wird letzterer gegenübergestellt. Um so wichtiger ist, dass die wohl verbreitetste Grammatik überhaupt auch eine Orthographie enthält (Duden 1984, 2005). Andererseits geht man gelegentlich über den Satz als größte zu beschreibende Einheit hinaus. Die innerhalb der Germanistik viel verwendete Grammatik von Engel (1991) enthält einen Abschnitt zur Textgrammatik, und Weinrich (1993) macht das Funktionieren von Sätzen in Texten zur Grundlage der Beschreibung überhaupt. Seine Textgrammatik interessiert sich an erster Stelle für die Leistung sprachlicher Einheiten im Kontext. Andere Unterschiede betreffen die theoretische Bindung und den Adressatenbezug. Als Akademiegrammatik wollten die ›Grundzüge‹ bei ihrem Erscheinen theoretisch modern sein und den Stand des Wissens bestimmter sprachwissenschaftlicher Schulen auf das Deutsche anwenden. Häufiger, so von Erben (1980), Helbig/Buscha (1998) und in der am Institut für deutsche Sprache (IDS) entstandenen Monumentalgrammatik (Zifonun u.a. 1997, im Folgenden ›IDS-Grammatik‹), wird eine derartige Ausrichtung des Gesamtkonzepts abgelehnt. Die IDS-Grammatik profiliert sich mit vergleichsweise strengen, ausführlichen Bedeutungsanalysen und legt großen Wert auf die Verwendung authentischen Sprachmaterials. Sätze müssen in der Regel irgendwo vorgekommen sein, sie werden nicht einfach konstruiert. Heringer (1988) schließlich nimmt in seiner ›rezeptiven Grammatik‹ ganz die Perspektive des Hörers oder Lesers ein. Er fragt, wie Sprache verstanden wird, während Grammatiker ja meist so reden, als gehe es um den Aufbau oder die Konstruktion von sprachlichen Einheiten. Einen expliziten Adressatenbezug hat auch Helbig/Buscha mit dem Untertitel »Ein Handbuch für den Ausländerunterricht«, und dasselbe gilt für eine Reihe der hochrangigen deutschen Grammatiken, die außerhalb des deutschen Sprachgebietes für Deutschlerner geschrieben wurden (z.B. Schanen/Confais 2001; Durell 2002). Meist jedoch findet man in dieser Hinsicht nur allgemeine Deklamationen. Ein konsequenter und auch die Darstellungsform bestimmender Adressatenbezug scheint sich mit dem Selbstverständnis unserer Grammatiken als wissenschaftliche nicht recht zu vertragen. Die kleine Demonstration erhebt weder den Anspruch einer Übersicht, noch soll sie gar den Eindruck erwecken, es herrsche Beliebigkeit vor. Besonderheiten bringen die Gemeinsamkeiten erst recht zur Geltung. Was immer Grammatiken im Einzelnen über eine Sprache sagen, sie tun es, indem sie zunächst die Form von sprachlichen Einheiten wie Wortformen und Sätzen beschreiben. Erst wenn die Form sprachlicher Einheiten jeweils hinreichend bekannt ist, kann man fundiert weitergehende Fragen über deren Entwicklung und Verwendung, über ihren Erwerb und ihre Normierung, über das Verhältnis von Dialekt, Soziolekt und Standard, über Unterschiede zwischen Geschriebenem und Gesprochenem stellen. Die Form sprachlicher Einheiten wird als ihre Struktur explizit gemacht. Es ist deshalb unendlich wichtig, dass eine Grammatik den Strukturbegriff expliziert, den sie verwendet (1.3). Die Verwendung des Begriffs ›Struktur‹ setzt voraus, dass man es mit Mengen von Einheiten (z. B. Lauten) zu tun hat, die nach gemeinsamen Eigenschaften klassifiziert sind (z. B. in Vokale und Konsonanten). Eine größere Einheit, etwa eine Wortform, hat Struktur oder ist strukturiert, wenn sie aus solchen kleineren Einheiten nach kombinatorischen Regularitäten aufgebaut ist. Nicht jede Lautfolge ergibt ja eine Wortform. Wie Strukturaussagen aussehen, demonstrieren wir jetzt an einigen Beispielen, freilich jeweils verkürzt, vorläufig und unvollständig. Der Leser wird gebeten, die Beispiele als Schritt zur Verständigung über das Grammatiktreiben zu verstehen und ihnen mit etwas Geduld zu folgen. Sprachliche Einheiten und grammatische Regularitäten Beim Vergleich der Wortformen backen, packen, Dorf, Torf, Gabel, Kabel stellt man fest, dass sie sich im Gesprochenen bezüglich des ersten Lautes sämtlich unterscheiden. Notieren wir die Anfangskonsonanten nach den Konventionen des Internationalen Phonetischen Alphabets (IPA, 2.3.2) als [b], [p], [d], [t], [g], [k]. Alle diese Laute werden durch plötzliches Öffnen eines Verschlusses im Mundraum gebildet. Der Verschluss liegt bei zweien von ihnen vorn an den Lippen ([b], [p]), bei zweien in der Mitte am Zahndamm ([d], [t]) 2 | 1. Rahmen, Zielsetzungen, Grundbegriffe vorn mitten hinten [b] [d] [g] [p] sth (1) stl [t] [k] und bei zweien weiter hinten am sog. Gaumensegel ([g], [k]). Die Laute eines Paares unterscheiden sich in Hinsicht auf Stimmhaftigkeit. [b], [d], [g] sind stimmhaft, [p], [t], [k] sind stimmlos. Insgesamt lassen sie sich mit den genannten Lautmerkmalen zum Schema 1 ordnen. Wieviele solcher Merkmale braucht man, um das Gesamtinventar an Lauten einer bestimmten Sprache zu beschreiben? Warum wählt man gerade diese aus der großen Zahl möglicher Merkmale aus? Wie verhalten sich andere Sprachen in dieser Beziehung? Das sind typische Fragen, wie sie die segmentale Phonologie stellt. Die segmentale Phonologie beschäftigt sich mit den Lauten als den kleinsten segmentalen Einheiten (Kap.3). Aber damit ist nur ein Aspekt der Lautstruktur erfasst. Die Form Blut (nach IPA [blu:t]) beispielsweise besteht aus vier Lauten, die zusammen eine Silbe bilden. Rein kombinatorisch lassen sich mit n verschiedenen Lauten genau n! (Fakultät) Ketten der Länge n bilden, wenn jeder Laut in jeder Kette genau einmal vorkommt. Bei n=4 wären das 24 Ketten mit je 4 Lauten. Von diesen 24 sind aber im Deutschen nur zwei wohlgeformt, nämlich [blu:t] und allenfalls noch [bu:lt], alle anderen sind es nicht. Jede Sprecherin und jeder Sprecher des Deutschen wird feststellen, dass es einsilbige Formen wie *[btu:l], *[bu:tl], *[u:btl], *[lbtu:] im Deutschen nicht geben kann. Die Silbenphonologie klärt, warum das so ist und warum unter den an sich möglichen Silben auch noch bestimmte Bauformen bevorzugt werden (4.1–4.3). Bei Mehrsilbern steht sodann die Frage nach dem Wortakzent. Was ist ein Wortakzent überhaupt? Woher wissen wir, dass in Náchtigall und ´ Ameise die erste Silbe betont ist, in Forélle, Hornísse und Holúnder die zweite? Oder ist es vielleicht gar nicht die zweite, sondern die vorletzte? Bei den im Deutschen so häufigen Zweisilbern vom Typ Ségel, Hámmer, Wágen, Sónne kann man zunächst von der ersten wie von der vorletzten als der betonten Silbe sprechen. Die Wortprosodie stellt fest, wie die Akzente verteilt sind und warum bestimmte Akzentmuster im Deutschen dominieren (4.4, 4.5). Neben der phonologischen weisen Wörter eine zweite Art von Strukturiertheit auf, die man traditionell etwas irreführend als die morphologische bezeichnet: ›morphologisch‹ heißt eigentlich nichts weiter als »die Form/Gestalt betreffend«, und das gilt ja für die phonologische Strukturiertheit genauso wie für die morphologische. Die Form tragbar ist adjektivisch. Anders als klug, müde, faul hat sie zwei morphologische Bestandteile, den Verbstamm trag und das Ableitungssuffix bar. Offenbar ist das Suffix dafür verantwortlich, dass die Gesamtform ein Adjektiv ist. Denselben Aufbau haben lernbar, lesbar, trinkbar, erwartbar und hunderte von weiteren Adjektiven. Aber warum gibt es nicht *schlafbares Bett, *beitretbarer Verein, *sitzbarer Stuhl oder *freubares Ereignis? Den Aufbau und die Bildungsregeln von morphologisch komplexen Wörtern unter- | 3 1.1 Gegenstand und Aufbau von Grammatiken Mask Fem ein – es em en e er er e Nom Gen Dat Akk (2) Neut – es em – sucht die Wortbildungsmorphologie. Sie zeigt, wie aus vergleichsweise wenigen Stämmen und Affixen der riesige Wortschatz aufgebaut wird, über den das Deutsche heute verfügt (Kap.6 und 7, s. a. 1.4). Hier lässt sich gut ein Beispiel für orthographische Strukturiertheit anschließen. Die phonologischen Formen [ne:blIC] und [Rø:tlIC] enden beide mit der Lautfolge [lIC], wobei [C] für den Laut steht, der sich auch am Ende von mich findet. Im Geschriebenen unterscheiden sich die beiden Formen am Ende: 〈neblig〉 vs. 〈rötlich〉 (wenn wir uns ausdrücklich auf das Geschriebene beziehen, setzen wir spitze Klammern). Die orthographische Form verweist auf eine unterschiedliche morphologische Gliederung, nämlich 〈nebl+ig〉 vs. 〈röt+lich〉. Das Suffix 〈ig〉 behält im Geschriebenen seine Gestalt bei, auch wenn es [IC] ausgesprochen wird. Es geht also nicht nur um die Beziehung zwischen Lauten und Buchstaben. In der geschriebenen Form von Wörtern steckt sehr viel mehr strukturelle Information, zum Beispiel morphologische. Das wird in Kap. 8 behandelt. Diesen Teil der Grammatik bezeichnet man häufig und mit guten Gründen auch als Graphematik (1.2; 8.1). Zurück zur Morphologie, die ja neben der Wortbildung auch die Flexion umfasst. Wortformen werden zu Flexionsparadigmen geordnet und nach ihren Formunterschieden beschrieben, wie wir es von fast allen älteren und den meisten neueren Grammatiken her gewohnt sind. Der unbestimmte Artikel ein etwa flektiert in Hinsicht auf die vier Kasus Nom, Gen, Dat, Akk sowie die drei Genera Mask, Fem, Neut. Das ergibt zwölf Positionen im Flexionsparadigma gemäß 2. Warum sind die Endungen gerade so verteilt? Warum sind einige Formen endungslos? Und warum weisen die Flexionsendungen immer wieder dasselbe Lautmaterial auf? In der Flexionsmorphologie des Deutschen gibt es nur einen einzigen Vokal, nämlich den sog. Murmelvokal [@] (›Schwa‹), und das verwendete Konsonantinventar ist ebenfalls sehr beschränkt (Kap.5). Von der Flexionsmorphologie ist es nur ein kleiner Schritt zur Syntax. Die Syntax beschreibt den Aufbau von größeren Einheiten, den syntaktischen Phrasen und Sätzen, aus Wortformen. Eine solche Phrase ist beispielsweise die Nominalgruppe (NGr) ein tragbarer Fernseher. In ihr sind Formen eines Artikels, Adjektivs und Substantivs verknüpft. Die Reihenfolge ist fest. Artikel und Substantiv haben keine Flexionsendung, das Adjektiv hat die Endung er. Die ganze Gruppe steht im Nominativ. Ersetzt man nun ein durch dieser, dann hat das Artikelwort die Flexionsendung er und das Adjektiv e, obwohl die Gesamtgruppe wie eben im Nom steht: dieser tragbare Fernseher. Verschiedene Flexionsformen sind also syntaktisch aufeinander abgestimmt. Die Bildung der einzelnen Formen wird in der Flexionsmorphologie untersucht, die 4 | 1. Rahmen, Zielsetzungen, Grundbegriffe Regeln ihrer Verwendung gehören in die Syntax. Flexionsmorphologie und Syntax sind offenbar nicht voneinander zu trennen. Unsere Beispiele haben weiter gezeigt, dass die Flexionsmorphologie mit der Phonologie, diese mit der Orthographie und die Orthographie mit der Wortbildungsmorphologie verbunden ist. Eine Grammatik besteht nicht aus hermetischen Komponenten. Ihre Teile »halten sich gegenseitig«, wie Ferdinand de Saussure es formuliert. Trotzdem ist es sinnvoll, ja unausweichlich, die einzelnen Komponenten einer Grammatik analytisch zu trennen und jede für sich darzustellen. Nur darf dabei nicht in Vergessenheit geraten, dass sprachliche Einheiten immer gleichzeitig morphologisch, phonologisch bzw. orthographisch und jenseits von Wortformen auch syntaktisch strukturiert sind. Mit Phonologie, Morphologie und Orthographie/Graphematik sowie der sie fundierenden Phonetik (Kap. 2) fassen wir im vorliegenden ersten Band das zusammen, was man die Wortgrammatik des Deutschen nennen kann. In einem weiteren Band wird mit der Syntax als Kerngebiet die Satzgrammatik behandelt. Die Teilung in Wort- und Satzgrammatik ist in der Grammatikographie des Deutschen bestens verankert. Sie kann zu je relativ geschlossenen Darstellungen führen. Weil jedoch gewisse syntaktische Grundbegriffe auch für die Wortgrammatik gebraucht werden, sprechen wir in Abschnitt 1.3 über sprachliche Strukturen allgemein, einschließlich der syntaktischen. Einen textgrammatischen Teil enthält der Grundriss nicht. Gewiss sind Sätze Teile von Texten so wie Wortformen Teile von Phrasen oder Sätzen und Silben Teile von Wortformen sind. Aber es gibt einen wesentlichen Unterschied. Der Aufbau von Silben, Wortformen, syntaktischen Phrasen und Sätzen gehorcht strikten grammatischen Regularitäten, die sich in Wohlgeformtheitsbedingungen niederschlagen. Kompetente Sprecherinnen und Sprecher einer Sprache haben in aller Regel ein sicheres Wissen darüber, ob eine Einheit grammatisch, d.h. wohlgeformt ist oder nicht. Bei Texten ist das anders. Ein Text kann inkonsistent, inkohärent, widersprüchlich und unverständlich sein. Damit wird er aber nicht ungrammatisch. Ein aus korrekt gebildeten Sätzen aufgebauter Text ist weder grammatisch noch ungrammatisch. Am Fehlen handfester, allgemein anwendbarer Kriterien für Wohlgeformtheit sind die textgrammatischen Versuche der siebziger Jahre gescheitert. Wohl werden wir, besonders in der Syntax, immer wieder auf die textuelle Funktion sprachlicher Mittel zu sprechen kommen. Eine Textgrammatik ergibt sich daraus nicht, es sei denn, man weicht das Grammatikkonzept auf (weiter dazu Lang 1973 sowie die Einleitungskapitel in Dressler 1973; Beaugrande/Dressler 1981; Heinemann/ Viehweger 1991). Grammatische Regularitäten vs. grammatische Regeln Fokussieren wir einen weiteren Punkt von herausragender Bedeutung zur Situierung dieses Grammatikkonzeptes in der neueren theoretischen Diskussion. (Der Rest dieses Abschnittes kann bei der ersten Lektüre ohne weiteres überschlagen werden.) Die phonologische Form [bUnt] (bunt) unterscheidet sich von der phonologischen Form [RUnt] (rund) in genau einem Laut, nämlich dem ersten. Alle übrigen Laute und insbesondere der je letzte stimmen überein. In den zwei- | 5 1.1 Gegenstand und Aufbau von Grammatiken (4) a. obstruent stimmhaft obstruent stimmlos s b. obstruent ] [ [ ] stimmlos ] / s silbigen flektierten Formen aus Stamm und Flexionssuffix wie bunt+es und rund+es tritt nun an der betreffenden Stelle ein Lautunterschied auf. Einmal bleibt es beim [t], z. B. [bUnt@s], das andere Mal steht [d], z. B. [RUnd@s]. Der Stamm von bunt bleibt lautlich in allen Formen gleich, der Stamm von rund variiert als [RUnd] vs. [RUnt]. Offenbar steht das [d] dann, wenn der letzte Laut des Stammes am Anfang der zweiten Silbe erscheint wie in [RUn.d@s] (mit dem Punkt als Zeichen für die Silbengrenze). Steht der letzte Laut des Stammes am Ende einer Silbe wie beim Einsilber [RUnt], dann ist er ein [t]. Die dem zugrundeliegende Regularität nennt man Auslautverhärtung. Wir werden sie später genauer beschreiben (4.3.2). Es wird gefragt, warum der Stamm gerade diese beiden lautlichen Varianten hat und wie sie aufeinander bezogen sind. Die Systematik der Darstellung beruht auf einer Beschreibung der Formen, also der sprachlichen Oberfläche, sowie des Verhältnisses der Formen zueinander. Häufig geht man anders vor und ordnet die Stammvarianten im Sinne eines Ableitungsprozesses. Man sagt etwa, [RUnd] sei die ›zugrundeliegende‹ Form des Stammes und [RUnt] sei aus ihr ›abgeleitet‹ (3a). Dazu muss das [d] in ein [t] umgewandelt werden, also seine Stimmhaftigkeit verlieren (3b). (3) a. [RUnd] W [RUnt] b. [d] W [t] Eine solche ›Entstimmung‹ gibt es nicht nur beim [d], sondern auch bei [b] zu [p], [g] zu [k] und anderen Lauten. Bezeichnen wir diese Lautklasse als Obstruenten, dann ergibt sich als allgemeine Formulierung für die Auslautverhärtung: »Stimmhafte Obstruenten werden im Silbenauslaut in stimmlose Obstruenten umgewandelt.« Schematisch kann das wie in 4a dargestellt werden. Man nennt das eine phonologische Regel. Eine Regel dieser Art hat eine bestimmte Form und ist etwas anderes als eine ›Regularität‹ im Sinne von ›Regelhaftigkeit‹. Links vom Pfeil ist ein Laut beschrieben, der in den rechts vom Pfeil beschriebenen umgewandelt wird. Nach dem Schrägstrich (/–) wird ein phonologischer Kontext spezifiziert: Die Regel greift nur dann, wenn der Laut vor einer Silbengrenze ( ]s, mit s für ›Silbe‹) steht (4a). 4a kann vereinfacht werden zu 4b. Die Regel besagt jetzt nur noch »Obstruenten werden im Silbenauslaut stimmlos« (z. B. Hall 2000: 209). Beim [t] wie in [bUnt] läuft die Regel leer, ebenso bei [p], [k] und den übrigen stimmlosen Obstruenten. Man nimmt dieses Leerlaufen in Kauf, um zu einer möglichst einfachen Regelformulierung zu kommen. Der mit 4 illustrierte Regeltyp heißt treffend ›kontextsensitive Ersetzungsregel‹. Ersetzungsregeln spielen in der Phonologie, Morphologie und Syntax von generativen Grammatiken eine bedeutende Rolle. Sie sind Teil der Grammatik. Im Extremfall besteht eine Grammatik nur aus einem Inventar an 6 | 1. Rahmen, Zielsetzungen, Grundbegriffe Basiseinheiten und solchen Regeln. Sprachliche Einheiten werden nicht einfach strukturell beschrieben, sondern sie werden samt ihren Strukturen durch Regeln abgeleitet (›generiert‹). Ein anderer Regeltyp von Ableitungsgrammatiken ist die Transformation. Die NGr ein tragbarer Fernseher wird in der klassischen Transformationsgrammatik aus einem Ausdruck wie ein Fernseher, der tragbar ist abgeleitet (Motsch 1971). Dazu bedarf es einer Reihe von Umstellungen, Tilgungen usw., die man eben mithilfe von Transformationen vollzieht. Andere berühmte Beispiele sind die Passivtransformation, mit der Das Haus wird von Karl verkauft aus dem Aktivsatz Karl verkauft das Haus entsteht oder die zur Herleitung von Komposita wie Holzhaus aus Haus, das aus Holz besteht (Huber/Kummer 1974; Kürschner 1974). In neueren Konzeptionen der generativen Grammatik spielen derartige Ableitungsregeln eine geringere Rolle. Man arbeitet mehr mit formalen Restriktionen für grammatische Strukturen (›Constraints‹) und stellt sich die Grammatik nicht mehr einfach wie eine Maschine vor, die Schritt für Schritt Ausdrücke mit ihren Strukturen generiert (zur Syntax Stechow/Sternefeld 1988; Abraham 1995; Borsley 1997). Diese Entwicklung führt dazu, dass viele Ergebnisse von ähnlicher Art sind, wie man sie in einer Oberflächengrammatik erzielen möchte. Unterschiede bleiben aber. Das generativ geprägte Denken will nicht darauf hinaus, die Form sprachlicher Einheiten zu beschreiben und funktional zu deuten. Das Hauptinteresse besteht vielmehr darin, verschiedene Beschreibungsebenen zu etablieren und diese näher zu charakterisieren. Neben der der sprachlichen Oberfläche gibt es dann, je nach Konzeption, auch eine Tiefenstrukturebene, eine der logischen Form, eine semantische oder auch konzeptuelle. Die Grammatik erfasst Strukturierungsprinzipien in abgrenzbaren Bereichen der verschiedenen Ebenen (häufig ›Module‹ genannt) sowie ihr Verhältnis zueinander, sie erfasst sie aber nicht explizit in Hinsicht auf ihre Funktion. Und natürlich spielen nach wie vor auch einfache Ableitungsregeln eine große Rolle oder sind sogar absolut dominant. Im Konzept der sog. lexikalischen Phonologie beispielsweise werden Wörter phonologisch und morphologisch derivationell beschrieben, d. h. ihre Oberflächenform wird aus anderen Formen abgeleitet. Die Wortgrammatik ist im wesentlichen eine Ableitungsgrammatik (R.Wiese 1996). Ist man darauf aus, das Verhältnis von sprachlicher Form und Sprachfunktionen auf möglichst einfache und aussagekräftige Art und Weise zu beschreiben, dann erweist sich das Konzept einer Ableitungsgrammatik als eher hinderlich. Auch legt es Missdeutungen darüber nahe, was eine Grammatik eigentlich sei, ob sie direkt etwas mit Sprachverarbeitung im Kopf zu tun habe, ob man mit ihrer Hilfe ins Hirn sehen könne, ob ihr Format direkt den Erwerb oder Verlust von Sprache spiegele usw. Solche Missdeutungen begleiten die generative Grammatik seit ihrem Entstehen (instruktiv z.B. schon Chomsky 1957; affirmativ Fanselow/Felix 1987; allgemeiner Pinker 2002). All dem kann man nicht in wenigen Sätzen gerecht werden, gewiss. Außer Frage steht auch, dass das generative Denken für die Grammatik zahlreicher Sprachen viel erreicht hat. Das Deutsche gehört zu diesen Sprachen. Riesige Faktenbereiche wurden einer grammatischen Beschreibung überhaupt erst zugänglich gemacht, wurden neu geordnet oder unter neuer Perspektive analysiert. | 7 1.1 Gegenstand und Aufbau von Grammatiken |
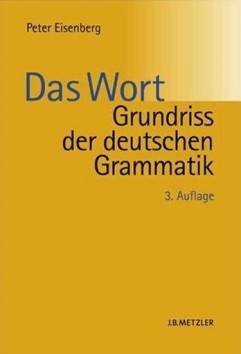
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen