|
|
|
Umschlagtext
Die Ubiquität der Rhetorik ist eine unbeschränkte. Erst durch sie wird Wissenschaft zu einem gesellschaftlichen Faktor des Lebens[...]. An ihrer fundamentalen Funktion innerhalb des sozialen Lebens kann kein Zweifel sein. Alle Wissenschaft, welche praktisch werden soll, ist auf sie angewiesen.
Hans-Georg Gadamer Rezension
Rhetorik war in der Antike eine zentrale und überall geübte Disziplin, heute wird sie kaum noch gelehrt, obwohl sie wichtiger denn je ist in einer medialen Welt ... Und wenn sie gelehrt wird, dann wird sie zumeist auf die Technik der Präsentation reduziert. In der Schule sollten Schüler/innen auch befähigt werden in rhetorischer Kompetenz, damit sie später in Beruf oder Hochschule frei sprechen, gekonnt diskutieren und argumentieren können. Das Redenkönnen war in der Antike ein Essential menschlicher Kultur. Reden - Argumentieren - Überzeugen, diesen Schlüsselkompetenzen, die früher unter dem Stichwort Rhetorik gefasst wurden, wendet sich dieser informative und umfassende Band zu.
Jens Walter, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Umfassender Überblick über alle Bereiche und Themen der Rhetorik Das Standardwerk mit Hinweisen zur neuesten Forschung Inklusive Glossar, Literaturverzeichnis, Personen- und Stichwortregister Rhetorische Fähigkeiten sind gefragt! Gut und wirkungsvoll zu reden und zu verhandeln, ist in unserer medienorientierten Gesellschaft wichtiger denn je. Nach einem umfangreichen historischen Abriss bietet der an Schulen und Universitäten erprobte Klassiker eine grundlegende Einführung in die Technik und Methode der Redekunst. Das Werk stützt sich dabei auf das antike Rhetoriksystem, das bis heute als das theoretisch differenzierteste gilt. Für die 5. Auflage wurde der Band durchgesehen und aktualisiert. Gert Ueding ist Professor em. für allgemeine Rhetorik an der Universität Tübingen. Bernd Steinbrink ist freier Autor. Pressestimmen: Die Rhetorik hat als Kunst der freien Rede eine lange Tradition, die bis in die Philosophie der Antike reicht. Das vorliegende Arbeits- und Lesebuch bietet zunächst einen historischen Teil, der einen guten Überblick in die rhetorischen Ansätze von der Antike bis in die Gegenwart verschafft. Im systematischen Teil werden die rhetorischen Methoden und Techniken vorgestellt, die besonders in den Übungen verdeutlichen, dass Rhetorik eine wirkliche Kunst ist, die erlernt werden kann. Vor allem das umfangreiche Literaturverzeichnis und Sachregister machen das Werk zu einer wertvollen Fundgrube für Studierende und alle, die sich wissenschaftlich mit dem Thema Rhetorik beschäftigen. lehrerbibliothek.de Ob zum vertiefenden Studium, zum Nachschlagen, ob als Fundus für Beispiele und Texte - eine wertvolle Bereicherung... Kultus und Unterricht Inhaltsverzeichnis
Vorwort XI
Einleitung in die Rhetorik 1 Historischer Teil A. Die Begründung der Rhetorik in der Antike 13 1. Anfänge der Rhetorik 13 2. Sophistik und Rhetorik 15 3. Platon und die Rhetorik 18 4. Poetik und Rhetorik des Aristoteles 23 5. Cicero und die Rhetorik 28 6. Kritik am Verfall der Beredsamkeit / Pseudo-Longinos 39 7. Quintilian und die Ausbildung zum Redner 42 B. Christliche Erbschaft der Rhetorik im Mittelalter 48 1. Einleitung 48 2. Augustinus und die christliche Beredsamkeit 50 3. Die artes liberales im Mittelalter 55 4. Die Rhetorik im Trivium 58 5. Die Autoritäten des mittelalterlichen Rhetorikunterrichts 63 6. Juristenrhetorik und ars dictaminis 65 7. Ars poeticae 68 8. Ars praedicandi 71 C. Studia humanitatis und Barockstil – Die Rhetorik vom 15. bis zum 17. Jahrhundert 76 1. Epochenbezeichnungen 76 2. Die Wiederentdeckung und das Studium der alten Schriftsteller 76 3. Luther und die Reformation 81 4. Redekunst und Dichtkunst 86 5. Vir bonus und rhetorisches Bildungsideal 88 6. ›Dinge‹ und ›Worte‹ 91 7. Die Dreistillehre 93 8. Manierismus 97 9. Rhetorik und Muttersprache 99 D. Rhetorik der Aufklärung – Das 18. Jahrhundert in Deutschland 102 1. Aufklärung und Beredsamkeit 102 2. Begriff und Zweck aufklärerischer Redekunst 103 3. Die Bearbeitungsphasen der Rede 110 4. Rhetorische Stillehre 113 5. Redekunst und Dichtkunst 115 6. Rednerideal und bürgerliche Erziehung von Thomasius bis Knigge 117 7. Die Beredsamkeit nach ihren wichtigsten Gattungen 124 8. Rhetorik und Hochsprache 134 E. Ubiquität der Rhetorik – Vom Verfall und Weiterleben der Beredsamkeit im 19. Jahrhundert 136 1. Zäsur in der Wissenschaftsgeschichte 136 2. Romantische Rhetorik 137 3. Rhetorik, Poetik, Stilistik 140 4. Literaturkritik und Literaturgeschichtsschreibung 142 5. Die politische Rede 144 6. Gerichtliche Beredsamkeit 147 7. Geistliche Beredsamkeit 151 8. Rhetorik in der Schule 153 9. Prunk-Rhetorik und Gründerzeit 156 F. Aspekte moderner Rhetorik-Rezeption – Das 20. Jahrhundert 159 1. Rhetorik-Renaissance und apokryphe Rezeption 159 2. Literaturwissenschaft und Literaturkritik 160 3. Hermeneutik und Rhetorik 163 4. Medien- und Kommunikationswissenschaft 164 5. Neue Rhetorik und »New Rhetoric« 167 6. Philosophie und Rhetorik 173 7. Die politische Beredsamkeit 180 8. Pädagogik und Rhetorik 183 9. Jurisprudenz und Rhetorik 186 10. Predigtlehre 189 11. Populäre Rhetoriken 191 12. Tübinger Rhetorik 198 Systematischer Teil Vorbemerkung 210 A. Die Produktionsstadien der Rede (erga tou rhetoros / opera oratoris partes artis) 211 I. Klärung des Redegegenstandes (intellectio) 211 1. Gliederung der Redegegenstände 211 a) Die Gliederung der Redegegenstände nach den Fragen (quaestiones) 212 b) Die Gliederung der Redegegenstände nach dem Verhältnis Redegegenstand/Zuhörer 213 c) Die Gliederung der Redegegenstände nach dem Verhältnis Zuhörer/Redegegenstand 213 II. Das Finden und Erfinden des Stoffes (heuresis / inventio) 214 III. Die Ordnung des Stoffes (taxis / dispositio) 215 1. Das natürliche Ordnungsprinzip (ordo naturalis) 216 2. Das künstliche Ordnungsprinzip (ordo artificialis) 217 3. Ordnungsschemata 217 a) Die zweigliedrige, antithetische Disposition 217 b) Die dreigliedrige Disposition 218 c) Die viergliedrige Disposition 218 d) Die fünfgliedrige Disposition 218 e) Die mehrgliedrige Disposition 218 IV. Der sprachliche Ausdruck (lexis, hermeneia / elocutio) 218 1. Angemessenheit (prepon / aptum, decorum) 221 a) Das innere aptum 223 b) Das äußere aptum 224 2. Sprachrichtigkeit (hellenismos / latinitas, puritas) 226 a) Sprachrichtigkeit bei Einzelwörtern (latinitas in verbis singulis) 227 b) Sprachrichtigkeit in Wortverbindungen (latinitas in verbis coniunctis) 228 3. Deutlichkeit (sapheneia / perspicuitas) 229 a) Die Deutlichkeit der Einzelwörter (perspicuitas in verbis singulis) 230 b) Die Deutlichkeit in Wortverbindungen (perspicuitas in verbis coniunctis) 230 4. Stufenfolge der Rede- und Schreibweisen (charakteres tes lexeos / genera dicendi, genera elocutionis) 231 a) Die schlichte Stilart (charakter ischnos / genus subtile, genus humile) 232 b) Die mittlere Stilart (charakter mesos, charakter miktos / genus medium, genus mixtum) 233 c) Die großartige, pathetisch-erhabene Stilart (charakter megaloprepes, charakter hypselos / genus grande, genus sublime) 234 V. Das Einprägen der Rede ins Gedächtnis (mneme / memoria) 235 VI. Vortrag und Körperliche Beredsamkeit (hypokrisis / pronuntiatio, actio) 236 B. Die Beweise und ihre Fundstätten (pisteis / probationes) 238 I. Einteilung der Beweise 239 1. Natürliche Beweise (pisteis atechnoi / probationes inartificiales) 239 2. Kunstgemäße Beweise (pisteis entechnoi / probationes artificiales) 239 II. Fundstätten der Beweise (topoi / loci) 239 1. Die sich aus der Person ergebenden Fundorte (loci a persona) 243 2. Die sich aus dem Sachverhalt ergebenden Fundorte (loci a re) 249 C. Redeteile (mere tou logou / partes orationis) 259 I. Die Einleitung (prooimion / exordium) 259 1. Die direkte Einleitung (principium) 260 a) Das Erlangen der Aufmerksamkeit (attentum parare) 260 b) Die Erweiterung der Aufnahmefähigkeit (docilem parare) 261 c) Das Erlangen des Wohlwollens (captatio benevolentiae) 261 2. Die indirekte Einleitung (insinuatio) 261 II. Die Erzählung (diegesis / narratio) 262 1. Die Tugenden der Erzählung (aretai tes diegeseos / virtutes narrationis) 262 2. Funktion und Gebrauch der Erzählung 262 3. Die Darlegung des Themas (prothesis / propositio) 263 4. Die Abschweifung (parekbasis / digressio) 263 III. Die Beweisführung (pistis, eikos / argumentatio) 264 1. Gliederung als Eingang der Beweisführung (prothesis, prokataskeue / divisio, partitio) 265 2. Die Teile der Beweisführung 265 3. Beweisarten (pisteis / probationes) 266 a) Beweisführung ohne Kunstmittel (pisteis atechnoi / probationes inartificiales) 266 b) Beweisführung durch Kunstfertigkeit (pisteis entechnoi / probationes artificiales) 266 b1) Zeichen, Indizien (semeion, tekmerion / signa) 267 b2) Die Beweisgründe (syllogismoi, enthymemata / ratiocinatio, argumenta) 267 b3) Das Beispiel (paradeigma / exemplum) 268 b4) Die Sentenz (gnome / sententia) 269 c) Die Vergrößerung oder Steigerung (auxesis / amplificatio) 272 IV. Der Redeschluß (epilogos / peroratio) 275 1. Zusammenfassende Aufzählung (enumeratio) 275 2. Affekterregung (affectus) 276 D. Die Wirkungsfunktionen der Rede (officia oratoris) 278 I. Einsicht und Belehrung (pragma / docere, probare) 280 II. Unterhalten und Vergnügen (ethos / delectare, conciliare) 281 III. Leidenschaftserregung (pathos / movere, concitare) 281 E. Der Redeschmuck (kosmos / ornatus) 284 I. Allgemeine Mittel der Rede zur Steigerung des Ausdrucks 285 II. Der Redeschmuck in den Einzelwörtern (ornatus in verbis singulis) 287 1. Archaismus (antiquitas) 287 2. Neologismus (fictio) 288 3. Tropus (tropos / verbum translatum) 288 III. Der Redeschmuck in Wortverbindungen (ornatus in verbis coniunctis) 300 1. Die Wortfiguren (schemata lexeos / figurae verborum) 302 a) Durch Hinzufügung (per adiectionem) gebildete Wortfiguren 303 b) Durch Auslassung (per detractionem) gebildete Wortfiguren 306 c) Durch Umstellung (per transmutationem) gebildete Wortfiguren 307 2. Die Gedankenfiguren, Sinnfiguren (schemata dianoias, figurae sententiae) 309 a) Durch Veränderung der Satzordnung oder Satzart gebildete Gedankenfiguren 311 b) Durch Sinnpräzisierung oder Sinnaussparung gebildete Gedankenfiguren 314 c) Durch szenische Erweiterung der Rede und Publikumsansprache gebildete Gedankenfiguren 320 3. Die Wortfügung (synthesis / compositio) 324 F. Die Übung (askesis, melete / exercitatio, usus) 329 I. Lese- und Hörübungen (legendo, audiendo) 330 II. Schreibübungen (scribendo) 331 III. Redeübungen (dicendo) 332 Glossar 334 Anmerkungen 341 Literaturverzeichnis 377 Personenregister 399 Sachregister 404 Leseprobe: Einleitung in die Rhetorik 1. Die Frage nach Eigenart und Sinngehalt der Rhetorik begleitet die Redekunst seit ihren Anfängen; es ist immer (anders als etwa bei der ähnlich gewichtigen Frage nach dem Wesen der Philosophie) ein zweifelnder Unterton darin, der nicht nur den Gegenstandsbereich, das Erfahrungswissen, Abgrenzungsprobleme oder die Methode betrifft, sondern auch die Berechtigung der Rhetorik als einer eigenen, selbständigen und gesellschaftlich nützlichen Disziplin. Schon die antiken Rhetoriker verbanden die Erörterung dieser Frage mit ethischen Reflexionen, und Quintilian, der bedeutendste Lehrer der Beredsamkeit im kaiserlichen Rom, hat sein erstes, leider verlorenes Buch über den Verfall der Beredsamkeit geschrieben (»De causis corruptae eloquentiae«); gleich zu Beginn seiner zwölf Bücher über »Die Ausbildung des Redners« (»Institutionis oratoriae«), dem wichtigsten rhetorischen Lehrwerk der europäischen Geschichte, erörtert er den Zusammenhang von Ethik und Rhetorik: »Denn ich möchte nicht zugeben, die Redenschaft über rechtes, ehrbares Leben sei, wie einige gemeint haben, der Zuständigkeit der Philosophen zuzuweisen [...]. Deshalb möchte ich [...] entschieden dafür eintreten, daß diese Dinge von Rechts wegen wirklich unsere Sache sind und ihrem eigentlichen Wesen nach zur Redekunst gehören.« (Vorrede, 10f.) Quintilian schließt sich ausdrücklich Platons Meinung an, wenn er die Kenntnis der Gerechtigkeit als Voraussetzung rhetorischer Vollkommenheit dekretiert. Sicher ist jedenfalls, daß die Redekunst nach ihrer rein technisch-wissenschaftlichen Seite hin keine Gewähr gegen ihren Mißbrauch bietet – sie teilt damit freilich das Schicksal aller anderen Disziplinen, keine Natur- und keine Geisteswissenschaft, die davon ausgenommen ist. Doch liegt der Fall ja noch komplizierter, denn anders als bei den meisten übrigen Wissenschaften liegt die Zweideutigkeit der Rhetorik nicht erst in ihrer Offenheit für gegensätzliche praktische Anwendungen, sondern ist bereits in ihrem theoretischen Erkenntnisziel und wissenschaftlichen Interesse enthalten, nämlich die Möglichkeiten zu erforschen und die Mittel bereitzustellen, die nötig sind, die subjektive Überzeugung von einer Sache allgemein zu machen. Weshalb die großen Rhetoriker seit Isokrates und Aristoteles, Cicero und Quintilian die Redekunst zu einem umfassenden humanistischen Bildungssystem erweiterten, das neben der Philosophie zu dem wichtigsten, differenziertesten und wirkungsmächtigsten der europäischen Kulturgeschichte wurde, dessen unser ganzes Schulwesen prägende Kraft trotz mannigfacher Einbußen im 19. und 20. Jahrhundert doch bis heute spürbar ist. Im 18. Jahrhundert ereignen sich in der Rhetorikgeschichte allerdings Umbrüche so schwerwiegender Art, daß sie häufig als Abschluß der rhetorischen Tradition beschrieben wurden. Genauere historische Forschungen haben diese Auffassung grundsätzlich korrigiert. Gewiß verliert die Schulrhetorik im Ausbildungswesen ihre beherrschende Stellung, was, wie Manfred Fuhrmann gezeigt hat, mit der Krise der Lateinschulen, dem Zurückdrängen des Lateinischen als Unterrichtsfach und Wissenschaftssprache zusammenhängt, darüber hinaus mit dem Aufkommen der Natur- Einleitung in die Rhetorik 2 Einleitung in die Rhetorik wissenschaften und der Differenzierung der europäischen Kultur in Nationalkulturen. Der Geltungsverlust ist dramatisch, daran läßt sich nichts deuteln, er verhindert aber nicht das Weiterleben rhetorischer Theorie unter dem Deckmantel neuer Terminologien und aufgefächert in Disziplinen wie Poetik und Literaturtheorie, Geschichtsschreibung und Pädagogik, Hermeneutik und Psychologie. Statt vom Ende wäre also von eine Transformation der Rhetorik zu reden, dessen praktische Wirksamkeit im Zeitalter der Französischen Revolution, in den Befreiungskriegen, in der Literatur des Vormärz, in der Frankfurter Paulskirche schließlich im Reichstag immer evident gewesen ist. Auch die ökonomische Entwicklung, die Bedürfnisse der Warenwirtschaft in Werbung und Vertrieb, haben die weitere Überlieferung persuasiver Methoden und Techniken garantiert. Gleichwohl geriet die Rhetorik als systematisch verfaßtes Lehrgebäude in Vergessenheit; nur als solches aber hatte sie in 2500 Jahren wechselvoller Geschichte ihre Identität bewahren können. Eine Identität in Differenz und Wandel natürlich. Wie sich Protagoras und Isokrates oder George Campbell und Johann Christoph Gottsched unterscheiden, so schließen sie doch jeweils, wenn auch von verschiedenen Seiten, den prinzipiellen Problemgrundriß auf, der Rhetorik heißt. Auch in diesem Punkt ist der Vergleich mit der Philosophie lehrreich. Die Differenzierung in einzelne Rhetoriken gefährdet die Rhetorik als einheitliches Wissensgebiet ebenso wenig, wie etwa die Philosophie durch ihre Ausprägung in einander oft sich widersprechende Philosophien ihren disziplinären Charakter verliert. Solche Erkenntnisse beginnen sich freilich erst langsam durchzusetzen und die Transformationen der Rhetorik, ob sie nun als disziplinärer Verfall oder als wissenschaftsgeschichtlich begründete Ausdifferenzierungen beschrieben werden, sind trotz entsprechender Publikationen in den letzten Jahren noch längst nicht hinreichend erforscht. Die Vorurteile gegenüber der ars bene dicendi, die Kunst, gut und wirkungsvoll zu reden, haben eine weit zurückreichende Geschichte, ja: sie sind so alt wie die Rhetorik selber. Platons Rhetorikverachtung ist die in der Antike bekannteste und mächtigste; direkt oder indirekt setzt sich jeder Rhetor mit ihr auseinander, immer wieder wurden die entsprechenden Partien aus dem Gorgias-Dialog zitiert, im Mittelalter so gut wie im 18. und 19. Jahrhundert. Daß die Wirkung solcher Urteile nicht einmal in der christlichen Einflußsphäre des Mittelalters wirklich dauerhaft sein konnte, liegt an der Tatsache, daß die Rhetorik eben nie, wie das populäre Mißverständnis glaubt, ein geschlossenes Regelsystem gebildet hat. Ihre Gesetze und Normen waren so weit interpretierbar, daß sie selbst noch für manieristische Dunkelheit und Rätselhaftigkeit die Techniken bereitstellte, ihre Theorie so offen, daß sowohl die Tätigkeit des katholischen Priesters wie das ›spontane‹ Gebet des pietistischen Laien von ihr begriffen werden konnten; ihre immer auf Parteilichkeit ausgerichteten Anweisungen waren so vielfältig interpretierbar, daß sie sowohl höfischer Konversation wie bürgerlichem Emanzipationswillen Ton und Stimme gaben. Ebenso trägt der häufige, in der rhetorischen Tradition selber topisch überlieferte Hinweis auf die wesensgemäße Verbindung von Rhetorik und Republik zur Klärung der wechselvollen Rhetorik-Geschichte nur wenig bei. Das berühmte Lehrbuch Quintilians entstand zur römischen Kaiserzeit, höfische Beredsamkeit, Kanzel- und Briefrhetorik hatten zu allen Zeiten Blüteperioden, und schließlich gelang es der feudalen Reaktion nicht einmal nach 1848 völlig, die kritischen, immer noch von revolutionärem Emanzipationswillen getragenen Bürgerstimmen zum Schweigen zu bringen. Wogegen von Kant bis Schiller und von Goethe bis Hegel die Allianz der Rhetorik-Gegner reicht – und ausgerechnet ein Adam Müller wurde ihr Lobredner! Nie ist Rhetorik im 19. Jahrhundert ausschließlich Herrschaftswissen geworden, wie eine andere Vermutung lautet: Vormärz und sozialistische Beredsamkeit erwiesen sich so rhetorisch geschult wie der schillernde Höfling Müller oder der Verächter des Parlaments Bismarck. Schließlich erscheint auch die Ablösung einer rhetorischen Wirkungsästhetik von der philosophischen Ästhetik des deutschen Idealismus durchaus als keine zwingende gesellschaftliche Notwendigkeit, wenn man berücksichtigt, daß in den Poetiken der Schriftsteller selber Rhetorik, ob genannt oder nicht, immer noch Kern der Argumentation ist. Vollends rätselhaft aber wird die Krise der Rhetorik, wenn man sich vergegenwärtigt, daß die rhetorische Kunstfertigkeit, die Praxis rhetorischer Kunstübung, in alter Höhe weiterbesteht, allerdings ohne rhetorischen Begriff. Gerade die rhetorischen Zweckformen, Zeitungsartikel, Pamphlet, Flugblatt und Polemik, Tendenzpoesie, Reportage und Reisebericht, sind zentrale künstlerische Äußerungen des 19. Jahrhunderts, das zuletzt ja das Jahrhundert der großen Prosa, des Romans und des philosophischen und historischen Diskurses ist – Kunstfertigkeiten, deren Theorie nirgendwo anders als in der Rhetorik zu finden war. Und es ist das Jahrhundert jener massenhaft produzierten und verbreiteten Literatur der Unterhaltung und des Wissens, die so augenfällig wie bereitwillig dem normierten Muster folgt und beinah sämtliche rhetorisch wichtige Techniken und Methoden virtuos anwendet, in einem Maße, daß man gar von einer Rhetorik des Kitsches und der Kolportage sprechen kann. Gerade die ausdrücklich zweckgebundene und häufig nur zum kurzfristigen Gebrauch bestimmte Literatur, Leitartikel wie Kochbuch oder Propagandarede, gehört vorzüglich dazu, derart ohne Theorie, unbegriffen und wenig geachtet von den gebildeten Schichten, die sich in der Poesie an denselben rhetorischen Figuren ergötzten, die sie dort als störend zweckgebunden empfanden. So lebt Rhetorik oft im Werk ihrer Verächter sogar höchst produktiv fort: Das besonders herausragende Beispiel ist immer noch Friedrich Schiller, aber auch Hegel gehört dazu, und eine gründliche Analyse würde nicht nur die rhetorische Struktur seiner Prosa, sondern ebenso manch rhetorisches Moment seiner Philosophie und Ästhetik zutage fördern, von der Gattungspoetik bis hin zur Theorie der Einleitung, wie sie schon früh die »Phänomenologie des Geistes« präzise formuliert. Der Verfall der Beredsamkeit als einer systematischen, wenn auch offenen Theorie ist der Ausdruck einer tiefen kulturellen Krise, und die Entwicklung neuer Medien seit der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert ist der Versuch, diese Krise, die vor allem als eine der Sprache wirkt, produktiv zu überwinden. Man muß sich den ungeheuren Optimismus vergegenwärtigen, mit dem die junge bürgerliche Intelligenz noch im zweiten Drittel des 18. Jahrhunderts der gesellschaftsbildenden Kraft des gesprochenen Worts, des von ihnen gesprochenen Worts, vertraute, um die tiefe Enttäuschung zu verstehen, mit der diese Intellektuellen auf die gesellschaftlich-politische Entwicklung reagierten. Enttäuschung politischer Hoffnungen, Entwicklung neuer Medien: Foto, Bildergeschichte, Film – und nebenher bis zu Hofmannsthals »Brief des Lord Chandos« und weiter die verzweifelnde, aufreibende, doch rhetorisch virtuos formulierte Kritik an der Sprache! Man kann zugespitzt sagen: In dem Maße, in dem das Vertrauen in die öffentliche Macht der Sprache schwand, wurden die Anstrengungen der Schriftsteller größer, in immer neuen sprachlichen Präzisie- Einleitung in die Rhetorik 3 rungsversuchen menschliche Rede dennoch in ihrer weiten individual- und gesellschaftsethischen Bedeutung zu rechtfertigen. Und das mitunter sogar bewußt wieder mit Mitteln und Argumenten der Rhetorik, wie etwa das Beispiel Nietzsche zeigt. Aber das sind alles nur Stichworte zu einer noch nicht geschriebenen Geschichte der Rhetorik im 18. und 19. Jahrhundert, die den Platz bestimmen wird, den Rhetorik in der Gegenwart einzunehmen hat. Der »Grundriß der Rhetorik« versucht, diese Lücke wenigstens den großen Leitlinien nach zu schließen. Das weithin ausufernde Flußdelta der unterirdischen rhetorischen Tradition der letzten 200 Jahre ist kaum überschaubar. Rhetorische Konzeptionen sind sowohl in Kunsttheorie und Philosophie wie in Gesellschaftslehre, Pädagogik und Psychologie eingegangen, Salzmann und Campe sind ebenso wie Knigge und Schubart Zeugen rhetorischer Wirksamkeit an unvermuteter Stelle. Gibt es für die Theorie einer Kunst keinen eigentlicheren Zweck als die Praxis, so mußte gerade die Rhetorik einen sehr umfassenden Praxisbegriff entwickeln, der sich auf die Verwirklichung der Rede im weitesten Sinne zu beziehen und auch die von Platon vorgebrachten Einwände zu berücksichtigen hatte. Denn sollte die Rhetorik nur für diejenige Praxis bestimmt sein, die der Ordnung des ethisch Guten angehört, so galt es, zuerst den Redner so zu bilden, daß er selber Teil dieser Ordnung: vir bonus werden konnte. Verwirklichung der Rede bedeutet zunächst Verwirklichung des Guten im Redner; Erziehung, Bildung und Übung sind ebenso wichtige rhetorische Theoriefelder wie Wirkungsabsicht, Angemessenheit, res verba- Problem. Quintilians berühmte »Institutio oratoria« ist auch ein Erziehbuch und hat als solches mindestens ebenso gewirkt wie als rhetorische Systematik. Noch Schiller lobt es ausdrücklich in dieser Bedeutung. Die Rhetorik ist immer obendrein Darstellung eines Wertesystems gewesen, wie überhaupt die Teilhabe an diesem übergeordneten Wertesystem den jeweils parteilich gebundenen Redner (einer Gerichtsverhandlung etwa) die Möglichkeit eröffnete, Übereinstimmung und Diskrepanz zwischen den Positionen zu erkennen und gegenseitig zu erklären. Der Redner muß also sein Publikum dahingehend zu beeinflussen versuchen, daß es ihn in einer ganz bestimmten, nämlich der seiner Charakterbildung angemessenen Weise erfährt, und das im Vortrag selber. Er darf sich also, so Aristoteles, nicht etwa auf seinen Ruf verlassen. Die Frage, ob sich der vir bonus auch heucheln läßt, ob es möglich ist, unter dem Schein des Richtigen die Täuschungsabsicht zu verbergen, wurde höchst unterschiedlich beantwortet und berührt Gehalt, Zusammenhang und Abgrenzung der Kategorien ›Wahrheit‹ und ›Wahrscheinlichkeit‹. Schillers Überzeugung, daß die Wahrheit noch in der Täuschung fortlebe, und Nietzsches Pointe, daß die Dichter lügen, hängen damit noch aufs engste zusammen, und selbst die modernen Realismusdebatten sind ihre späten Ausläufer. Jedenfalls ist sicher, daß die Kenntnis der rhetorischen Techniken der Wahrscheinlichkeits- und Glaubwürdigkeitsherstellung den rhetorischen Rattenfängern und Dunkelmännern jeglicher Couleur das Geschäft verdirbt. Das macht die kritisch-aufklärerische Potenz der Rhetorik aus, und niemand ist der Lüge hilfloser ausgeliefert als der »natürliche Mensch«, dem ja immer Gold ist, was glänzt. Das zu erfahren, bedarf es freilich nicht des Kulturvergleichs; Werbung und politische Propaganda liefern uns dafür täglich die besten Beispiele. Allein der rhetorische Basis-Satz, daß es keine interesselose Erkenntnis gebe, schafft Distanz zum Gehalt jeder Rede, relativiert ihren Autoritätsanspruch. 4 Einleitung in die Rhetorik Von der Parteilichkeit jeder rhetorischen Handlung (worunter auch die Inszenierung der Rede und die Körperberedsamkeit gefaßt sind) wird auch verständlich, weshalb die Gerichtsrede immer das ausgezeichnete Paradigma der Rhetorik gewesen ist. Doch nicht nur dieser destruktive, Autorität und Geltungsansprüche der Sache bezweifelnde Zug folgt aus rhetorischer Grundüberzeugung, sie vermag auch Sicherheit zu vermitteln, obzwar niemals endgültige, unwiderrufbare Sicherheit. »Sätze worüber alle Menschen übereinkommen sind wahr, sind sie nicht wahr, so haben wir gar keine Wahrheit«, formulierte Georg Christoph Lichtenberg den rhetorischen Probierstein; sein Ideal des Selbstdenkens bleibt daher verankert im gemeinschaftlichen Sinn der Menschen, dem sensus communis, zu dem jeder einzelne beiträgt: »Riefe ich laut aus und hätten meine Worte den Klang der Posaune des letzten Tags: höre, du bist ein Mensch, so gut als Newton, oder der Amtmann oder der Superintendent, deine Empfindungen, treulich und so gut als du kannst in Worte gebracht, gelten auch im Rat der Menschen über Irrtum und Wahrheit. Habe Mut zu denken, nehme Besitz von deiner Stelle!« Lichtenberg knüpft mit seiner Berufung auf den »Rat der Menschen über Irrtum und Wahrheit« an die Aristotelische Theorie des Fürwahrhaltens an, wie wir sie in seiner »Topik« finden können; glaubwürdig ist demnach ein Satz, der »entweder allen oder den meisten oder den Weisen und von den Weisen entweder allen oder den meisten oder den Angesehensten glaubwürdig erscheint, ohne für die allgemeine Meinung unglaubwürdig zu sein.« Die Konsequenzen aus dieser rhetorischen Auffassung von Plausibilität sind vielfältig. Sie bestimmen den genuinen Gegenstandsbereich der Rhetorik auf das Problem- und Meinungswissen, messen der öffentlichen Meinung bei der Erörterung problematischer Fragen eine entscheidende Rolle zu und machen alle Überzeugungen, die nicht durch Messen oder Wägen oder durch mathematische Beweisführung gewonnen wurden, in ihrer situativen, kontextuellen, historischen und sozialen Abhängigkeit sichtbar. Die eigentümliche Toleranz der Rhetorik, die sich in der Stellung des Redners gegenüber diskrepanten Auffassungen zeigt, hat hier ihre Wurzel. Geht man einmal davon aus, daß die geschichtliche Erscheinung des Glaubwürdigen nicht eine Wahrheit ist, die sich als bare Münze fraglos einstreichen läßt (und davon geht die Rhetorik selbstverständlich aus), nicht das Schema, das über Recht und Unrecht, Gut und Böse manichäisch waltet, sondern daß Recht und Unrecht historisch variable Größen sind, die je neu zur Erscheinung und in der jeweiligen Zeit und ihrer Gesellschaft zur Darstellung gebracht werden müssen, so bedeutet jeder antagonistische Streit nicht ein Scheingefecht um eine von vornherein schon feststehende, wenn auch verdeckte Wahrheit, sondern ist der Prozeß, in dem das Richtige sich erst herauskristallisiert. Aus der Unsicherheit ante diem folgt die Notwendigkeit der Toleranz auch der Redner untereinander. Denn sie sind sowohl Teil wie Ausdruck eines Prozesses, der mit ihnen entschieden wird, und so wenig der »Sieger« die ganze Wahrheit für sich reklamieren kann, so wenig fällt dem »Verlierer« die Last der ganzen Unwahrheit zu. Auch der Unterlegene hat seinen Anteil daran, daß eine Allgemeinüberzeugung sich herausbilden konnte. Der Teufel ist der Geburtshelfer des richtigen Urteils in der kirchlichen Rechtsprechung noch heute. Das ist der Punkt, an dem sich rhetorische Dialektik und Hegelsche Dialektik als Dialektik der geschichtlichen Veränderung durchdringen. Die These berichtigt sich an der Antithese und umgekehrt das Widersprechende am ursprünglich Gesetzten, und so kommt es zu einem neuen Stadium in der Genese des Wissens. »Es ist [...] die Flüssigkeit der Begriffe, es ist dies Einleitung in die Rhetorik 5 durchaus Historische und Werdende, worin die Dialektik bei Hegel ihr Leben hat und den Inhalt des Lebens so ausdrückt wie ausmacht.« (Ernst Bloch) So liegt Hegels Philosophie gerade in ihrem Kerngedanken Rhetorik zugrunde, und die Überzeugung, »die Wahrheit ist ihre dialektische Entwicklung selbst oder der Prozeß« (Bloch), wird durchsichtig auf das rhetorische Verständnis von Handlungsorientierung als Ergebnis eines freien Streits der Argumente, von Rede und Gegenrede, und damit zugleich auf die Einsicht von der Interessegebundenheit und Parteilichkeit jeder Rede. Wandlungsfähigkeit und Offenheit der Rhetorik folgen dieser Auffassung, sind nicht etwa Zeichen eines grenzenlosen Relativismus, sondern ihres geschichtlichen Wesens, das sich ontologischer oder metaphysischer Festlegung widersetzt. Das gilt auch für die Sphäre ästhetischer Theorie. Die Wirkung der platonischen Philosophie hat die Reflexion der Entstehung des Kunstwerks, der Bedingungen und Möglichkeiten, die seiner Wirklichkeit vorhergingen, lange verhindert. Wenn göttliche Kraft den Dichter in Begeisterung versetzt und er nur als eine Art Sekretär fungiert, so ist die Technik der Herstellung des Schönen dem menschlichen Beurteilungsvermögen und damit jeder rationalen Betrachtung entzogen. Mit Aristoteles, der als Lehrer der Rhetorik zwanzig Jahre lang an Platons Akademie tätig war und von dem uns neben rhetorischen Lehrschriften auch die (fragmentarisch überlieferte) »Poetik« erhalten geblieben ist, begann auch die ontologische Bedeutung des Schönen in der ästhetischen Diskussion zu schwinden. Die Fundierung der Kunst auf Geschichte, ihre Verpflichtung, nicht das Zeitlos und ideal Schöne zu offenbaren, sondern menschliche Möglichkeiten vorzuführen, bedeutet den Bruch mit der ontologisch begründeten Ästhetik. Der Einfluß der Rhetorik auf Kunsttheorie und Ästhetik ist damit von Anfang an aufklärender Art. Das Kunstwerk wird zum Produkt eines Herstellungsprozesses, eines Arbeitsprozesses, über dessen Verlauf diskutiert und Rechenschaft abgelegt werden kann. Reflexion des Künstlers auf die Bedingungen und den Verlauf seiner Produktion ist eng verbunden mit der Theorie der Beredsamkeit, die die Kategorien dafür bereitstellte. Da die Rhetorik als wirkungsvolle und auf tätige Wirkung abzielende aktive Teilnahme am politischen und gesellschaftlichen Leben dem Bereich der vita activa anzurechnen ist, so läßt sich sagen, daß der mit Formkultur verbundene positive Begriff von Arbeit, der Antike fremd, durch die Rhetorik in die Ästhetik Eingang findet. Die Arbeit wird in dem historischen Augenblick zum Mittel menschlicher Vervollkommnung, als eine Klasse versucht, an die Herrschaft zu gelangen, die ihr Selbstverständnis nicht den ererbten Privilegien entnehmen konnte und einsehen mußte, daß sie nur auf ökonomischem Wege zur Macht zu gelangen vermochte. Der unbewußt schaffende Künstler benötigt diese Selbstlegitimierung nicht: Ob er in göttlicher Begeisterung, durch Inspiration, als verlängerter Arm der Natur oder unter dem Diktat des Unbewußten sein Werk hervorbringt, der schöpferische Vorgang vollzieht sich an ihm mit einer elementaren Gewalt, der er willenlos und passiv gehorcht. Er gehört einer Klasse an, deren Herrschaft qua ihrer Privilegien gesichert ist – oder die den Anspruch auf Herrschaft aufgegeben hat und somit zur politischen Untätigkeit verurteilt ist. Die häufige Personalunion von Dichter und Lehrer der Beredsamkeit, Verfasser von Dramen und Verfasser von Rhetoriklehrbüchern, wie sie im 17. und 18. Jahrhundert üblich ist, verweist auf eine Theorie, die im Wandel des Arbeitsbegriffes das Emanzipationsstreben des Bürgertums reflektiert und derzufolge auch Kunst lernbar, der Dichter nur als Gelehrter denkbar ist. 6 Einleitung in die Rhetorik 2. Betrachten wir den gegenwärtigen Stand rhetorischer Theoriebildung, so scheint sich die Rhetorik in eine unübersichtliche Vielzahl von Wissensgebieten zu zersplittern. Die Rezeption einzelner Aussagen, Analyse- und Produktionstechniken in den Einzelwissenschaften, in interdisziplinären Institutionen der Wissenschaftstheorie und -geschichte, in Erziehungsprogrammen und pragmatischen Ausbildungskonzepten etwa der Lehrerseminare und nicht zuletzt in den populären Ausprägungen des Reden- und Kommunikationstrainings, der Werbung, der Public Relation, des Mediengebrauchs hat den Rhetorik-Begriff derart unscharf werden lassen, wenn nicht gar entleert, daß begriffliche Klärung eine notwendige und vorgängige Aufgabe aller rhetorikwissenschaftlichen Arbeit geworden ist. Vier Ansätze versuchen eine Klärung der unübersichtlichen Lage. Der erste gibt den disziplinären Charakter der Rhetorik auf, ihre Geschichte sei abgeschlossen, ihr System »unwiederbringlich historisch « (H. Schanze) geworden. Ein antiquarischer Geschichtsbegriff verbindet sich hier mit der Auffassung vom System als einer geschlossenen und fixierten Ganzheit. Der zweite Ansatz löst die Rhetorik in die geschichtliche Reihe ihrer Konkretionen auf. Rhetorik wird als das definiert, wozu sie – in wechselnden disziplinären Rahmungen – jeweils erklärt wurde, weil sie sich an irgendeine der historischen Varianten ihrer theoretischen Formation anschließen läßt. Auch diese Position gibt den systematischen und disziplinären Charakter der Rhetorik auf und fußt auf einem historischen Relativismus, dem die Identität seines Gegenstandes verlorengeht, und sei es einer Identität, die in der Invarianz der Fragestellungen oder wenigstens der Richtung besteht, in der sich die Rhetorik wissenschaftlich und theoretisch entfaltet hat. Einen dritten Ausweg eröffnet der normative Begriff von Rhetorik, der dem Status von System und Disziplin verpflichtet bleibt, den die antiken Theoretiker von Isokrates und Aristoteles bis zu Cicero und Quintilian entwickelt haben und der Transformationen und Paradigmenwechsel nur in diesem Rahmen zulassen will. Am meisten verbreitet und aus der antiquarischen Geschichtsauffassung folgend ist viertens eine bloß selektive Rezeption, die aus dem umfänglichen, systematisch und historisch differenzierten Theorie-Gebäude einzelne Teile, Zugriffe, Fragestellungen, Theoreme gleichsam, herausbricht und den eigenen Absichten dienstbar macht: Texttheorie, Hermeneutik, Semiotik, Dekonstruktivismus, Argumentationstheorie sind die geläufigsten Beispiele, doch die Reihe geht noch sehr viel weiter und umfaßt inzwischen eine unübersehbare Vielfalt von Disziplinen, Teilsdisziplinen, wissenschaftlichen oder halbwissenschaftlichen Erklärungs- und Analysemodellen. Aus Sicht der Tübinger Rhetorik sind diese Rezeptionsweisen Reduktionen, die gewiß sinnvoll sind und in den meisten Fällen auch zu erfolgreichen Weiterentwicklungen und Ergebnissen geführt haben, die aber das Potential der geschichtlich gewachsenen Rhetorik längst nicht ausschöpfen. Von ihr ist (wie von der mit ihr seit der Antike konkurrierenden Philosophie) nur sinnvoll im systematischen Zusammenhang zu denken und zu reden. Dieser in der Antike begründete systematische Zusammenhang ist zwar historischen Veränderungen unterworfen, innerhalb derer auch Verkürzungen, Ausweitungen oder Verwerfungen (gemessen an früheren geschichtlichen Stufen) zu konstatieren sind, die aber die Systembindung als solche gar nicht in Frage stellen. Erst Systembindung nämlich sichert den wissenschaftlichen und disziplinären Charakter der Rhetorik dauerhaft und bereichert im Gegenzug wiederum die Einzelrezeptionen, weil der Rezeptionsprozeß dann nicht einseitig als bloße Resteverwertung, sondern dialogisch als gegenseitiges Befruchten stattfin- Einleitung in die Rhetorik 7 det. Modellhaft leitend kann für die Rhetorik dabei durchaus ihre Begründungsgeschichte bleiben, insofern sie auch exemplarisch die Entwicklung von der Beobachtung praktischer Redefertigkeit zur Kunst und schließlich zur Wissenschaft genommen hat – eine Entwicklung, zu geordneten Zusammenhängen, zum hochdifferenzierten System, das vorbildlich für die Systematisierung der anderen Wissenschaften wurde. Dieses System integriert theoretisches, praktisches und poietisches Wissen, es umfaßt die Fragen nach der Verfassung und den Regeln menschlicher Kommunikation in natürlichen und künstlichen Zeichen, Theorie und Praxis der Argumentation, Informationswesen (Information, Dokumentation, Medien), die anthropologischen Verhältnisse, soziale, politische, rechtliche und ökonomische Verkehrsformen, Herstellung und Untersuchung kultureller und künstlerischer Produkte und schließlich, anknüpfend an anthropologische Konzepte, die rhetorisch immer schon vermittelten Zielinhalte der Bewertung (Ethik in den Geistes- und Naturwissenschaften) und Ausbildung. Rhetorisches Denken ohne Systematik ist Dilettantismus, landet entweder in der Gegend gängiger Populär-Rhetoriken oder verliert sich in Spezialisierungen, die, so elaboriert sie auch sein mögen, ohne wenigstens perspektivische Ordnung reduktionistische Denkformen bleiben. Zu warnen ist dabei freilich vor einer Gefahr, der die Schulrhetorik schließlich erlegen ist. Ihr Systemdenken war im 18. und 19. Jahrhundert wesentlich am Verfall der öffentlichen Geltung beteiligt, der die Rhetorik seit 1750 zunehmend um ihre disziplinäre Bedeutung gebracht hat. Der Schulrhetorik geriet der Systemanspruch zur Karikatur, zum Schubladenwissen mit numerierten Etiketten: zum Schematismus. Der Grund liegt in dem zu eng gefaßten Systembegriff, den die Schulrhetorik auf Neben-, Ein- und Unterordnung sowie Ableitung festlegte. Entwicklungsformen, die eine Vermittlung von aktuellen Bedürfnissen mit dem überlieferten System gestattet hätten, hatten in dem erstarrten System der Schulrhetorik keinen Platz, weshalb Rede (ob als sprachliche, bildliche oder musikalische verstanden) aus dem vorgängigen Regelsystem abgeleitet und ihm formal untergeordnet wurde. Für jede lebendige Rhetorik führt der Weg in die umgekehrte Richtung, die Rede ist der Ausgangspunkt (Leitkategorien wie »rhetorische Situation«, »Kairos«, »aptum« sind Entwicklungsformen dieser Art), sie rhetorisch qualifizieren, heißt aufzeigen, wie sie aus ihrer rhetorischen Form geworden ist, wie sie sie nach Ort, Zeit und Umständen aktualisiert – d. h., wie in jeweiliger besonderer Rede sich das systematisch Allgemeine stets neu und anders bestimmt. Durch Rückwirkung der konkreten rhetorischen Entwicklungsform als Rede auf das System verändert sich auch dieses. D.h.: Jede Aktualisierung der in der Rhetorik historisch angelegten Potentialität bildet die systematische Form weiter, indem sie sie konkretisiert. Der Zweckinhalt rhetorischer Theorie bleibt auch unter solchem Systemanspruch die sie verändernde rednerische Praxis. Im Lichte dieses Prinzips gestaltet sich die Ordnung der drei an jeder Redehandlung grundlegend beteiligten Instanzen von Redner, Rede(-Gegenstand) und Adressat. Aristoteles hat sie in ihrem systematischen Zusammenhang bereits eingeordnet und ihrer Funktion entsprechend klassifiziert. Danach ist nicht der Redner, sondern der Zuhörer die richtunggebende Instanz. Rednerkonzentrierte rhetorische Theorien betrachten den Adressaten naturgemäß nur als Mittel zur Erreichung des rednerischen Zwecks, als Objekt der Redehandlung, das den eigenen Strategien entsprechend geformt, verändert, im extremen Falle sogar besiegt werden soll. Anders die Formung vom Adressaten aus. Um ihn zu 8 Einleitung in die Rhetorik überzeugen, bedarf es zuvor einer Situations- und Tendenzanalyse, die seine Vormeinungen, seinen latenten Willen ermittelt. Persuasion bedeutet dann eben nicht Inkorporation des rednerischen Willens im Publikum (»daß die Hörer so werden, wie er sie haben will«, E. Geißler), sondern Entfaltung des im Publikum Angelegten. Der Erfolg der Redehandlung liefert von Fall zu Fall den Beweis für die prinzipielle Übereinstimmung der rednerischen Meinungen und Überzeugungen mit denjenigen des Publikums. Diesem Rhetorik-Begriff folgend, bildet Rede aber nicht nur die Vormeinungen des Publikums ab, an die sie anknüpft, sondern treibt das in ihnen angelegte, dem Publikum teilweise oder ganz latente Wunsch- oder Bedürfnispotential weiter, setzt es rhetorisch formgebend frei, vollendet es gegebenenfalls und erreicht derart ihren persuasiven Zweck. Aus diesem fortbildenden Bezug des Redners zu seinem Publikum erwächst schließlich Idee und Gehalt rhetorischer Erziehung. Dem Menschen der sokratischen Belehrsamkeit oder (mit Hegel zu sprechen) »Verstandesallgemeinheit « setzt die Rhetorik seit ihrem Auftreten im Griechenland des 5. Jahrhunderts das konkrete Subjekt entgegen, das von seinen Gewohnheiten, Überzeugungen, Stimmungen und Affekten nicht zu trennen ist (als gleichsam bereinigte Fassung), d.h. immer schon voreingenommen ist. Die Rhetorik gewinnt daraus zwei Klassen von Überzeugungsgründen, die Aristoteles als ethos und pathos systematisiert hat. Das ist die anthropologische Seite der Rhetorik, ihr entspricht eine handlungstheoretische Einsicht, die von der konkreten Situation ausgeht, nicht von einer ideal oder rational abstrakten Problemlage. Richtige und kluge Entscheidungen entstehen also nicht durch ihre abstrakt-rationalistische Erörterung, sondern dadurch, daß die strittige Frage der Konkurrenz oder dem Streit der Meinungen ausgesetzt wird. Dabei bilden Logos, Ethos und Pathos die drei Dimensionen, in deren Lichte die Frage geprüft, bewertet und entschieden wird – ein Verfahren, das zu sehr viel glaubhafteren Ergebnissen kommt als die streng rationale Argumentation allein. Auch dies übrigens ein Grund für das schon von Hannah Arendt angesprochene Mißtrauen gegen alles bloße Expertenwissen, dem sich die Betroffenen dann oftmals mit fassungsloser Entgeisterung konfrontiert sehen. Auf welchen Wegen die Sokratische Gleichung Tugend = Einsicht oder Vernunft = richtiges Handeln durch die Jahrtausende gewandert sein mag – von Platon über Descartes und Hegel bis zu den modernen Naturwissenschaften: Ihre aktuell so zweideutige Überzeugungskraft entspricht mehr dem Wunsch als der Wirklichkeit und erweist sich gerade deshalb als so hartnäckig. Die fatalen Folgen kennen wir alle, weil nicht nur im politischen Leben das Expertenunwesen die politisch-rhetorische Rationalität überwuchert, sondern Bildung überhaupt als wissenschaftliche Ausbildung verstanden wird und alle anderen menschlichen Anlagen verkümmern. Womit die Funktion des Wissenschaftsbegriffs umgeschlagen ist. »Die vielberufene methodische Sauberkeit, allgemeine Kontrollierbarkeit, der Consensus der zuständigen Gelehrten, die Belegbarkeit aller Behauptungen, selbst die logische Stringenz aller Gedankengänge ist nicht Geist [...].« Adorno redet hier einem Wissenschaftsbegriff das Wort, dessen humanistische, den menschlichen Gegebenheiten und schließlich einer idealen humanitas verpflichtete Orientierung sich die Tübinger Rhetorik seit ihren Anfängen zu eigen gemacht hat. Die einzelwissenschaftlichen Interessen, die sich rhetorischer Theoriebildungen bedienen, sind so weit gestreut und trotz terminologischer Umformulierungen offensichtlich, daß hier einige exemplarische Hinweise genügen. Ihnen allen liegt die Erkenntnis zugrunde, daß jedes Wissen an Sprache gebunden ist und es kein Spre- Einleitung in die Rhetorik 9 chen gibt, das sich rhetorischer Form oder Absicht entziehen könnte. Diese in Analogie zum »linguistic turn« als »rhetorical turn« beschriebene Wendung hat sehr unterschiedliche Konsequenzen für die Rezeption rhetorischer Theorie-Elemente. Schon die Bezugsstelle kann einschränkend (Nietzsche) sein, oder der Zugriff erfolgt nur auf ein Teilgebiet, wie es der Aristotelischen Rhetorik erging, die von Perelman vor allem argumentationstheoretisch verarbeitet wurde, während sich auf die klassisch-antike Elocutio-Lehre de Man und Lausberg ebenso wie Plett (1977) und Breuer (1974) konzentrierten. Auch wenn sie das Potential der Rhetorik nicht ausschöpften, lassen sich die meisten dieser selektiven Anknüpfungen doch als eigener Beitrag in die Systementwicklung integrieren. Wobei festzuhalten bleibt, daß im Verständnis der Rhetorik als eines Entwicklungssystems die herausragende Bedeutung der historischen Art der Anordnung enthalten ist, so daß man eine von der geschichtlichen Bewegung abgehobene Rhetorik nur als verdinglichte, fragmentierte Theorie betrachten kann, die sie gerade um ihr eigentümliches Merkmal bringt: Nämlich als ein Wissen, das sich der Erzeugung und Fortbildung verdankt und in der jeweiligen rhetorischen Situation immer wieder aufs neue aktualisiert werden muß, in Abhängigkeit von Wirtschafts- und Gesellschaftsgeschichte. Historische Forschung ist daher für die Rhetorik nicht eine Forschungsrichtung unter vielen, sondern ihr wesentlich. Denn rhetorische Produktion, auf welchem Felde immer, findet in Form des Geschehens statt, und ihre Geschichte stellt das Werden des rhetorischen Wissens und seiner praktischen Verwirklichung dar, damit das Werden der Rhetorikwissenschaft. Auch Erneuerung ist nicht durch Abkoppeln von der Vergangenheit, sondern nur durch Weiterentwicklung und Fortbildung möglich und setzt die genaue Kenntnis dessen, was »die ganze Vorwelt zusammengespart hat« (Hegel), voraus. Solches, auf Erbschaft und Fortzeugung gerichtetes Geschichtsverständnis schärft die Erkenntnis und kritische Würdigung gerade jener sehr reichhaltigen historischen Forschungen, die die rhetorische Theorie und Praxis in bestimmten Zeitabschnitten rekonstruieren und sich nicht selten historistisch darin verlieren. Sie zu beerben bedeutet, die Bedeutungsgeschichte der theoretischen Entwürfe, Ideen, Probleme und Sachen aufzuklären, soweit sie eine rhetorisch-begriffliche Fassung erhalten haben. Ebenso wichtig aber ist es, die Überlieferung aus dem Schema vergangener Epochen herauszubrechen und als Auftrag an die Gegenwart zu erkennen, sie also für die gegenwärtige wissenschaftliche Forschung in der Rhetorik und allen anderen Disziplinen fruchtbar zu machen, die sich mit dem Menschen als eines vernunft- und sprachbegabten Mängelwesens beschäftigen. Die Definition einer Sache ist ebenso wie die ihres Begriffs identisch mit ihrer Geschichte, die freilich nicht abgeschlossen und fertig, sondern offen und für Folgen bereit ist. Der historische Bezug erlaubt es zudem, wirkliche von scheinbaren Fortschritten in der rhetorischen Theoriebildung zu unterscheiden und die Ideenplagiate oder verkappten rhetorischen Schwundstufen in anderen Wissenschaften zu erkennen. |
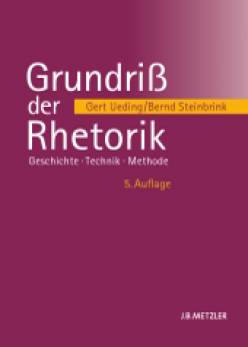
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen