|
|
|
Umschlagtext
Die Ubiquität der Rhetorik ist eine unbeschränkte. Erst durch sie wird Wissenschaft zu einem gesellschaftlichen Faktor des Lebens[...]. An ihrer fundamentalen Funktion innerhalb des sozialen Lebens kann kein Zweifel sein. Alle Wissenschaft, welche praktisch werden soll, ist auf sie angewiesen.
Hans-Georg Gadamer Rezension
Die Rhetorik hat als Kunst der freien Rede eine lange Tradition, die bis in die Philosophie der Antike reicht. Viele Menschen bemühen sich darum, ihre rhetorischen Fähigkeiten zu schulen und zu verbessern. Das vorliegene Arbeits- und Lesebuch von Gert Ueding und Bernd Steinbrink bietet zunächst einen historischen Teil, der einen guten Überblick in die rhetorischen Ansätze von der Antike bis in die Gegenwart verschafft. Im systematischen Teil werden die rhetorischen Methoden und Techniken vorgestellt, die besonders in den Übungen verdeutlichen, dass Rhetorik eine wirkliche Kunst ist, die erlernt werden kann. Vor allem das umfangreiche Literaturverzeichnis und Sachregister machen das Werk zu einer wertvollen Fundgrube für Studierende und alle, die sich wissenschaftlich mit dem Thema Rhetorik beschäftigen.
Arthur Thömmes, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Gert Ueding ist Professor für allgemeine Rhetorik an der Universität Tübingen. Bernd Steinbrink ist Professor für Multimedia Applications an der Fachhochschule Kiel Inhaltsverzeichnis
Vorwort XI
Vorwort zur vierten Auflage XII Einleitung in die Rhetorik 1 Historischer Teil A. Die Begründung der Rhetorik in der Antike 13 1. Anfänge der Rhetorik 13 2. Sophistik und Rhetorik 15 3. Platon und die Rhetorik 18 4. Poetik und Rhetorik des Aristoteles 23 5. Cicero und die Rhetorik 28 6. Kritik am Verfall der Beredsamkeit / Pseudo-Longinos 39 7. Quintilian und die Ausbildung zum Redner 42 B. Christliche Erbschaft der Rhetorik im Mittelalter 48 1. Einleitung 48 2. Augustinus und die christliche Beredsamkeit 50 3. Die artes liberales im Mittelalter 55 4. Die Rhetorik im Trivium 58 5. Die Autoritäten des mittelalterlichen Rhetorikunterrichts 63 6. Juristenrhetorik und ars dictaminis 65 7. Ars poeticae 68 8. Ars praedicandi 71 C. Studia humanitatis und Barockstil – Die Rhetorik vom 15. bis zum 17. Jahrhundert 76 1. Epochenbezeichnungen 76 2. Die Wiederentdeckung und das Studium der alten Schriftsteller 76 3. Luther und die Reformation 81 4. Redekunst und Dichtkunst 86 5. Vir bonus und rhetorisches Bildungsideal 88 6. ›Dinge‹ und ›Worte‹ 91 7. Die Dreistillehre 93 8. Manierismus 97 9. Rhetorik und Muttersprache 99 D. Rhetorik der Aufklärung – Das 18. Jahrhundert in Deutschland 102 1. Aufklärung und Beredsamkeit 102 2. Begriff und Zweck aufklärerischer Redekunst 103 3. Die Bearbeitungsphasen der Rede 110 4. Rhetorische Stillehre 113 5. Redekunst und Dichtkunst 115 6. Rednerideal und bürgerliche Erziehung von Thomasius bis Knigge 117 7. Die Beredsamkeit nach ihren wichtigsten Gattungen 124 8. Rhetorik und Hochsprache 134 E. Ubiquität der Rhetorik – Vom Verfall und Weiterleben der Beredsamkeit im 19. Jahrhundert 136 1. Bruch in der Wissenschaftsgeschichte 136 2. Romantische Rhetorik 137 3. Rhetorik, Poetik, Stilistik 140 4. Literaturkritik und Literaturgeschichtsschreibung 142 5. Die politische Rede 144 6. Gerichtliche Beredsamkeit 147 7. Geistliche Beredsamkeit 151 8. Rhetorik in der Schule 153 9. Prunk-Rhetorik und Gründerzeit 156 F. Aspekte moderner Rhetorik-Rezeption – Das 20.Jahrhundert 159 1. Rhetorik-Renaissance und apokryphe Rezeption 159 2. Literaturwissenschaft und Literaturkritik 160 3. Hermeneutik und Rhetorik 163 4. Medien- und Kommunikationswissenschaft 164 5. Neue Rhetorik und »New Rhetoric« 167 6. Philosophie und Rhetorik 173 7. Die politische Beredsamkeit 180 8. Pädagogik und Rhetorik 183 9. Jurisprudenz und Rhetorik 186 10. Predigtlehre 189 11. Populäre Rhetoriken 191 12. Tübinger Rhetorik 198 Systematischer Teil Vorbemerkung 209 A. Die Produktionsstadien der Rede (erga tou rhetoros / opera oratoris partes artis) 211 I. Klärung des Redegegenstandes (intellectio) 211 1. Gliederung der Redegegenstände 211 a) Die Gliederung der Redegegenstände nach den Fragen (quaestiones) 212 b) Die Gliederung der Redegegenstände nach dem Verhältnis Redegegenstand/Zuhörer 213 c) Die Gliederung der Redegegenstände nach dem Verhältnis Zuhörer/Redegegenstand 213 II. Das Finden und Erfinden des Stoffes (heuresis / inventio) 214 III. Die Ordnung des Stoffes (taxis / dispositio) 215 1. Das natürliche Ordnungsprinzip (ordo naturalis) 216 2. Das künstliche Ordnungsprinzip (ordo artificialis) 217 3. Ordnungsschemata 217 a) Die zweigliedrige, antithetische Disposition 217 b) Die dreigliedrige Disposition 218 c) Die viergliedrige Disposition 218 d) Die fünfgliedrige Disposition 218 e) Die mehrgliedrige Disposition 218 IV. Der sprachliche Ausdruck (lexis, hermeneia / elocutio) 218 1. Angemessenheit (prepon / aptum, decorum) 221 a) Das innere aptum 223 b) Das äußere aptum 224 2. Sprachrichtigkeit (hellenismos / latinitas, puritas) 226 a) Sprachrichtigkeit bei Einzelwörtern (latinitas in verbis singulis) 227 b) Sprachrichtigkeit in Wortverbindungen (latinitas in verbis coniunctis) 228 3. Deutlichkeit (sapheneia / perspicuitas) 229 a) Die Deutlichkeit der Einzelwörter (perspicuitas in verbis singulis) 230 b) Die Deutlichkeit in Wortverbindungen (perspicuitas in verbis coniunctis) 230 4. Stufenfolge der Rede- und Schreibweisen (charakteres tes lexeos / genera dicendi, genera elocutionis) 231 a) Die schlichte Stilart (charakter ischnos / genus subtile, genus humile) 232 b) Die mittlere Stilart (charakter mesos, charakter miktos / genus medium, genus mixtum) 233 c) Die großartige, pathetisch-erhabene Stilart (charakter megaloprepes, charakter hypselos / genus grande, genus sublime) 234 V. Das Einprägen der Rede ins Gedächtnis (mneme / memoria) 235 VI. Vortrag und Körperliche Beredsamkeit (hypokrisis / pronuntiatio, actio) 236 B. Die Beweise und ihre Fundstätten (pisteis / probationes) 238 I. Einteilung der Beweise 239 1. Natürliche Beweise (pisteis atechnoi / probationes inartificiales) 239 2. Kunstgemäße Beweise (pisteis entechnoi / probationes artificiales) 239 II. Fundstätten der Beweise (topoi / loci) 239 1. Die sich aus der Person ergebenden Fundorte (loci a persona) 243 2. Die sich aus dem Sachverhalt ergebenden Fundorte (loci a re) 249 C. Redeteile (mere tou logou / partes orationis) 259 I. Die Einleitung (prooimion / exordium) 259 1. Die direkte Einleitung (principium) 260 a) Das Erlangen der Aufmerksamkeit (attentum parare) 260 b) Die Erweiterung der Aufnahmefähigkeit (docilem parare) 261 c) Das Erlangen des Wohlwollens (captatio benevolentiae) 261 2. Die indirekte Einleitung (insinuatio) 261 II. Die Erzählung (diegesis / narratio) 262 1. Die Tugenden der Erzählung (aretai tes diegeseos / virtutes narrationis) 262 2. Funktion und Gebrauch der Erzählung 262 3. Die Darlegung des Themas (prothesis / propositio) 263 4. Die Abschweifung (parekbasis / digressio) 263 III. Die Beweisführung (pistis, eikos / argumentatio) 264 1. Gliederung als Eingang der Beweisführung (prothesis, prokataskeue / divisio, partitio) 265 2. Die Teile der Beweisführung 265 3. Beweisarten (pisteis / probationes) 266 a) Beweisführung ohne Kunstmittel (pisteis atechnoi / probationes inartificiales) 266 b) Beweisführung durch Kunstfertigkeit (pisteis entechnoi / probationes artificiales) 266 b1) Zeichen, Indizien (semeion, tekmerion / signa) 267 b2) Die Beweisgründe (syllogismoi, enthymemata / ratiocinatio, argumenta) 267 b3) Das Beispiel (paradeigma / exemplum) 268 b4) Die Sentenz (gnome / sententia) 269 c) Die Vergrößerung oder Steigerung (auxesis / amplificatio) 272 IV. Der Redeschluß (epilogos / peroratio) 275 1. Zusammenfassende Aufzählung (enumeratio) 275 2. Affekterregung (affectus) 276 D. Die Wirkungsfunktionen der Rede (officia oratoris) 278 I. Einsicht und Belehrung (pragma / docere, probare) 280 II. Unterhalten und Vergnügen (ethos / delectare, conciliare) 281 III. Leidenschaftserregung (pathos / movere, concitare) 281 E. Der Redeschmuck (kosmos / ornatus) 284 I. Allgemeine Mittel der Rede zur Steigerung des Ausdrucks 285 II. Der Redeschmuck in den Einzelwörtern (ornatus in verbis singulis) 287 1. Archaismus (antiquitas) 287 2. Neologismus (fictio) 288 3. Tropus (tropos / verbum translatum) 288 III. Der Redeschmuck in Wortverbindungen (ornatus in verbis coniunctis) 300 1. Die Wortfiguren (schemata lexeos / figurae verborum) 302 a) Durch Hinzufügung (per adiectionem) gebildete Wortfiguren 303 b) Durch Auslassung (per detractionem) gebildete Wortfiguren 306 c) Durch Umstellung (per transmutationem) gebildete Wortfiguren 307 2. Die Gedankenfiguren, Sinnfiguren (schemata dianoias, figurae sententiae) 309 a) Durch Veränderung der Satzordnung oder Satzart gebildete Gedankenfiguren 311 b) Durch Sinnpräzisierung oder Sinnaussparung gebildete Gedankenfiguren 314 c) Durch szenische Erweiterung der Rede und Publikumsansprache gebildete Gedankenfiguren 320 3. Die Wortfügung (synthesis / compositio) 324 F. Die Übung (askesis, melete / exercitatio, usus) 329 I. Lese- und Hörübungen (legendo, audiendo) 330 II. Schreibübungen (scribendo) 331 III. Redeübungen (dicendo) 332 Glossar 334 Anmerkungen 341 Literaturverzeichnis 377 Personenregister 398 Sachregister 403 |
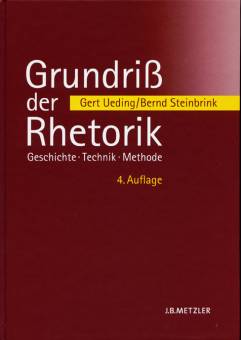
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen