|
|
|
Umschlagtext
Sätze wie ,das ist mein letztes Wort' rufen heute nur noch Kopfschütteln hervor - es sei denn, sie stehen im Testament eines Verstorbenen. Lässt sich angesichts der Relativierung aller Wertvorstellungen, die unserer Gesellschaft bislang Halt zu geben schienen, das ,Ein-für-allemal' Jesu Christi überhaupt noch als das Wort eines Lebenden vertreten? Diese Frage stellt sich verstärkt aufgrund des entschiedenen Plädoyers Johannes Pauls II. in der Enzyklika Fides et ratio: Wenn es keinen rational verantwortbaren dritten Weg zwischen abschottenden Fundamentalismus gibt, dann wird nicht nur die Überzeugungskraft der großen monotheistischen Religionen untergraben. Auch der zum Leitprinzip erhobene Dialog selbst verkehrt sich schließlich zum bloßen Gedankenaustausch, dem mit der Wahrheitsfrage der Ernst zwischenmenschlicher Begegnung abhanden kommt.
Die anhaltende lebhafte Diskussion dieses Grundrisses der Fundamentaltheologie machte inzwischen die 4. Auflage nötig. Durch die Übersetzung der 3., vollständig überarbeiteten Auflage ins Italienische (2001) erhielt auch die Debatte im romanischen Sprachraum neuen Auftrieb. Hansjürgen Verweyen, Dr. theol., Dr. phil., geboren 1936. Nach langjähriger Lehrtätigkeit in den USA und an der Universität Essen ist er seit 1984 Professor für Fundamentaltheologie an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Freiburg im Breisgau. Rezension
Fundamentaltheologie, das katholische Äquivalent zu den evangelischen Prolegomena, bildet den grundlegenden Eingangsteil einer jeden theologischen Dogmatik. Dabei werden so elementare Themen behandelt wie: Religion, Glaube und Vernunft, Offenbarung oder Glaubenssprache. Dass in der römisch-katholischen Variante der Kirche dabei ein eigenes Kapitel gewidmet wird, muss einen Protestanten in Erstaunen versetzen ... Überhaupt hat diese Fundamentaltheologie einen bedeutsamen Umfang. Für die Neuauflage wurde insbesondere der Bereich "Theologie und Philosophie" überarbeitet, nachdem der 1. Auflage der Vorwurf einer "philosophischen Letztbegründung des Glaubens" gemacht worden war.
Jens Walter, lehrerbibliothek.de Inhaltsverzeichnis
Vorwort zur dritten Auflage9
Vorwort zur ersten Auflage 11 Einleitung 13 Teil I: vernehmbar? 1 Ziel und Weg der Fundamentaltheologie 33 1.1 'Eine kaiserliche Botschaft' 33 1.2 Fundamentaltheologie als Apo-logie 37 1.2.1 'Apo-logia' nach dem Ersten Petrusbrief 37 1.2.2 Verantwortung vor welchem Forum? 39 1.2.3 Ein phänomenologischer Versuch 43 1.2.4 Philosophie und Theologie: ein vorläufiges Fazit 46 2. Der Ausgangspunkt der Fundamentaltheologie 50 2.1 Traditio als inhaltliche Mitte von Offenbarung und Glaube 51 2.2 Letztgültigkeit als Kennzeichen christlicher Offenbarung 56 3 Hermeneutische und Erste Philosophie als Aufgaben der Fundamentaltheologie 58 3.1 Terminologische Abgrenzungen 58 3.2 Fundamentaltheologie und hermeneutisches Verstehen 61 3.3 Fundamentaltheologie und Erste Philosophie 63 3.4 Die gegenseitige Verwiesenheit von hermeneutischem Verstehen und Erster Philosophie67 3.4.1 Die Verwiesenheit hermeneutischen Verstehens auf eine Erste Philosophie 67 3.4.2 Die Verwiesenheit von Erstphilosophie auf das hermeneutische Verstehen 70 4 Der Stellenwert der klassischen 'Gottesbeweise' im Rahmen der Frage nach dem 'Hören des Wortes' 73 4.1 Das kosmologische Argument74 4.2 Das ontologische Argument 82 4.3 Das transzendentallogische Argument 89 4.3.1 Der Ausfall der Frage nach der zureichenden Möglichkeitsbedingung 'regulativer Ideen' bei Kant 90 4.3.2 Der 'Gottesbeweis' in der dritten Meditation Descartes'91 4.3.3 Eine neuscholastische Variante 94 4.3.4 Die Urform des Arguments bei Augustinus und seine Weiterführung im Gottesbegriff Anselms 96 4.4 Der 'moralische Gottesbeweis' 101 5 Zum Diskussionsstand der Frage nach der Verwiesenheit des Menschen auf Offenbarung 110 5.1 Die augustinische Tradition 110 5.2 Der philosophische Ansatz Maurice Blondeis 113 5.3 Karl Rahners 'Hörer des Wortes' (1941) 115 5.4 Der Ausfall einer erstphilosophischen Reflexion beim späten Rahner und bei Johann Baptist Metz 122 5.5 Der handlungstheoretische Ansatz von Helmut Peukert 129 6 Die Frage nach Kriterien für Letztgültigkeit 133 6.1 Zur Tragweite transzendentalpragmatischer 'Letztbegründung' 133 6.2 Sinnfrage 142 6.2.1 Das 'Problem Mensch' am Leitfaden des mathematischen Punkts 142 6.2.2 Das 'Problem Mensch' als Ergebnis radikaler Subjektreflexion 147 6.3 Sinnbegriff 151 6.3.1 Eine metaphysische Lösung der Sinnfrage? 151 6.3.2 Das Absolute und sein Bild 154 6.3.3 Der Begriff unbedingten Sollens 159 6.3.4 Exkurs: Verschmelzung mit dem Absoluten? 164 6.3.5 Bild-Sein als 'In-karnation' 166 6.3.6 Bild-Werden im 'Ikonoklasmus' 169 6.3.7 Der Stoff, aus dem das Bild gemacht 175 7 Die Möglichkeit geschichtlicher Offenbarung 186 7.1 Sinnbegriff und Offenbarung 186 7.2 Die interpersonale Konstituierung des Ichs als Sollen 188 7.3 Offenbarung und ihre Vermittlung 192 8 Letztgültiger Sinn trotz sich verweigernder Freiheit? 196 8.1 Problemstellung 196 8.2 Drei Ebenen von Gemeinheit 198 8.3 Traditio als Ermöglichung letztgültigen Sinns 201 Teil II: ergangen? 9 Offenbarungsbegriff und philosophische Vernunft 211 9.1 Zum Begriff 'Offenbarung' 211 9.2 Das Verhältnis von Theologie und Philosophie in der Patristik 213 9.3 'Fides quaerens intellectum' bei Anselm von Canterbury 216 9.4 Das 'Übereinander' von natürlicher Vernunft und Offenbarung bei Thomas von Aquin 218 9.5 Offenbarung als Problem in der Neuzeit 223 9.5.1 Herbert von Cherbury und John Toland 224 9.5.2 Gotthold Ephraim Lessing 225 9.5.3 Offenbarung im Horizont der Kantischen Kritik: Johann Gottlieb Fichte 227 9.6 Die Antwort der Apologetik und Fundamentaltheologie 231 9.6.1 Die Frage nach der Notwendigkeit von Offenbarung im sich entwickelnden Offenbarungstraktat 231 9.6.2 Der Neuaufbruch bei Maurice Blondel 233 9.6.3 Der transzendentale Ansatz Karl Rahners 239 10 Zeichen wirklich ergangener Offenbarung 247 10.1 Wunder in den neutestamentlichen Apokryphen 247 10.2 Der Vorrang des Weissagungsbeweises bei Justin dem Märtyrer 250 10.3 Wunder im Kontext von Heilsgeschichte: Irenäus von Lyon 251 10.4 Der 'Beweis des Geistes und der Kraft' nach Origenes 253 10.5 Die Theologie der Zeichen bei Augustinus 257 10.6 Das Wunderverständnis bei Thomas von Aquin 259 10.7 Wunder als Widerspruch gegen Gott: Baruch de Spinoza 261 10.8 Die Unerkennbarkeit von Wundern: David Hume 262 10.9 'Wunder aus zweiter Hand': Gotthold Ephraim Lessing 263 10.10 Radikalisierung der Wunderkritik: von Immanuel Kant bis David Friedrich Strauß 266 11 Begriff und Zeichen der Offenbarung nach der Lehre des Zweiten Vatikanischen Konzils 270 12 Die Rückfrage nach dem 'historischen Jesus' 278 12.1 Die 'alte Frage' nach dem historischen Jesus und ihre Überwindung 278 12.2 Die 'neue Suche' nach dem historischen Jesus und ihre ungelösten Probleme 285 13 Auf dem Weg zu einer neuen Hermeneutik der Rückfrage 292 13.1 Das Problem: Letztgültigkeit in geschichtlicher Kontingent 292 13.2 Traditio als Grundgestalt letztgültiger Offenbarung und ihrer Vermittlung 298 13.3 Traditio und Schrift: historisch-kritische Exegese im Rahmen der Fundamentaltheologie 307 14 Zur Rückfrage nach den Wundern Jesu 318 14.1 Zwei Modelle der Rückfrage 318 14.2 Ein Testfall: die Heilung der blutflüssigen Frau (Mk 5,25-34 parr) 322 14.3 Der Zeichencharakter der Wunder Jesu nach den Evangelien 330 15 Zur Basis des Osterglaubens 338 15.1 Ein Paradigmenwechsel 338 15.2 Die fundamentaltheologische Kernfrage. Drei Thesen 341 15.2.1 Der 'Ostergraben' im Lichte der Religionskritik 342 15.2.2 Inkarnation oder Inspiration des eschatologischen Wortes Gottes? 344 15.2.3 Zwei Klassen von Offenbarungsempfängern? 346 15.3 Die Basis des Osterglaubens nach dem Zeugnis des Neuen Testaments 347 15.4 Der geschichtliche 'Ort' der Osterevidenz 357 Teil III: gegenwärtig? 16 Zur Legitimation von Kirche 365 16.1 Die Kirche im Plural von Kirchen 365 16.2 Kirchenstiftung durch Jesus? 366 16.3 Ein neuer Frageansatz. Kirche und Kanon 371 17 Kirche und Volk Gottes 378 17.1 Die Wiederentdeckung eines Begriffs 378 17.2 Kirche im Rahmen der Sammlung und Reinigung des einen Gottesvolks 380 18 Kirche im Ernstfall - aus der Perspektive des Markusevangeliums 385 19 Kirche und Leib Christi 392 19.1 'Leib Christi' in den unumstrittenen Paulusbriefen 392 19.1.1 Soteriologische Vorgegebenheit 393 19.1.2 Sakramentale Vermittlung 396 19.1.3 Ekklesiale Konsequenz 398 19.2 'Leib Christi' im Kolosser- und Epheserbrief 400 19.3 Die Enzyklika 'Mystici Corporis' 403 19.4 Das Mysterium der Kirche in der Sicht des Zweiten Vatikanischen Konzils 408 20 Apostelamt und apostolische Nachfolge 417 20.1 Aposteldienst im Gefüge der Geistesgaben 417 20.2 Apostolische Nachfolge 420 20.3 Petrusdienst im Neuen Testament 424 20.4 Petrusdienst im Ringen um seine adäquate Gestalt 430 Anhang Literaturverzeichnis 437 Personenregister 481 |
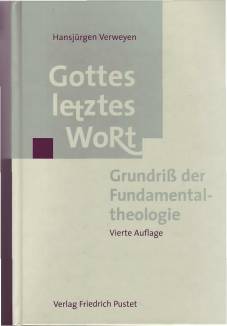
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen