|
|
|
Umschlagtext
Im Bewusstsein, dass Aufklärung ein stets unabgeschlossener Prozess ist, weist die vorliegende Studie zunächst in kritischer Auseinandersetzung mit Kant nach, auf welche Weise eine um ihre Fremdbestimmtheit wissende Vernunft nicht nur die biblische Offenbarungsgeschichte erhellt, sondern dabei auch umgekehrt ihrer eigenen Defizite innewird. In kritischer Auseinandersetzung mit Nietzsches Religionskritik und Girards Theorie der Gewalt gelingt so der Nachweis, in welcher Gestalt Vernunft und Offenbarung nicht Gegner, sondern Partner sind, die einander wechselseitig herausfordern und in diesem Sinne aufeinander angewiesen sind.
Der Autor versteht es hervorragend, komplexe Gedankengänge elementar zu veranschaulichen und erfahrungsorientiert zu präsentieren. Dadurch empfiehlt sich das Werk auch für die Vorbereitung des Unterrichts in der Sekundarstufe II. Gerd Neuhaus, Dr. theol., geb. 1952, ist apl. Professor für Fundamentaltheologie an der Universität Bochum und Lehrer am Abtei-Gymnasium in Dortmund-Hamborn. Rezension
Fundamentaltheologie - das ist der katholische Begriff (der evangelische Begriff lautet: Prolegomena) für den Teil der Dogmatik, der die grundlegenden, also fundamentalen, Aspekte der (christlichen) Religion beschreibt, z.B. das Verhältnis von Glaube und Vernunft (oder: Offenbarung und Rationlität, vgl. den Untertitel!). Das hier anzuzeigende Werk des an der Ruhr-Universität Bochum tätigen Hochschullehrers Dr. Gerd Neuhaus fasst dessen 20-jährige Lehrtätigkeit in der Fundamentaltheologie zusammen und verortet sich - wie der Untertitel betont - zwischen kritischer Vernunft und dem, was Vernunft nicht mehr zu sagen im Stande ist, und was theologisch Offenbarung heißt. Das Buch ist aber nicht nur für eine akademische Leserschaft verfasst sondern explizit auch für den schulischen Religionsunterricht, in dem der Verfasser ebenfalls seit Jahrzehnten tätig ist; mithin ist es um Anschaulichkeit und Verständlichkeit bemüht, - was bei Fundamentaltheologien keineswegs selbstverständlich ist ...
Thomas Bernhard, lehrerbibliothek.de Inhaltsverzeichnis
0. Fundamentaltheologie 11
0.1. Glaubensbegründung zwischen Offenbarungs- und Rationalitätsanspruch 11 0.1.1. Der Rationalitätsanspruch des Glaubens zwischen offenbarungsfeindlichem Intrinsezismus und vernunftfeindlichem Extrinsezismus 11 0.1.2. „Was in seinem Herzen verborgen ist, wird aufgedeckt" — Die entdeckungsgeschichtliche Aposteriorität des materialen Apriori 13 0.1.3. Eine religionspädagogische Konkretisierung 15 0.2. Glaubensbegründung auf der Ebene autonomer Vernunft — Zu einer Tendenz in der aktuellen Fundamentaltheologie 19 0.3. Zum Aufbau der vorliegenden fundamental theologischen Glaubensbegründung 22 1. Gott - ein angeborenes Bedürfnis menschlicher Vernunft 24 1.1. Anselms ontologischer Gottesbeweis und seine bleibende Aktualität 24 1.1.1. Der Grundgedanke 24 1.1.2. Seine bleibende Bedeutung 26 1.1.3. Zusammenfassung 32 1.2. Die Gottesidee in der Moralphilosophie Kants 33 1.2.1. Die Transzendentalität des Ich 33 1.2.2. Die Antinomie der praktischen Vernunft 37 1.2.3. Das Gottespostulat39 1.2.4. Der von der Vernunft entworfene Gottesbegriff 42 1.2.5. Die reine Vernunft und ihre gebrochene Realisationsgestalt 43 1.2.6. Korrelation oder Korrespondenz von Vernunft und Offenbarung? 46 1.3. Anselms Gottesbegriff als Implikation des Urvertrauens 48 1.3.1. Die transzendentale Funktion des Urvertrauens 48 1.3.2. Die Ambivalenz des Urvertrauens — dargestellt an zwei Filmen der jüngeren Vergangenheit 51 1.3.3. Die Rationalität der im Urvertrauen wirksamen Implikationen 57 1.4. Die Herausforderung des neuzeitlichen Atheismus 59 1.4.1. Vorbemerkung 59 1.4.2. Feuerbachs Versuch einer anthropologischen Hermeneutik des Gottesglaubens 60 Religiotiskritik als Hermeneutik des religiösen Beivusstseins 60 Das Vorbild biblischer Religionskritik 62 Der Preis von Feuerbachs Hermeneutik 64 1.4.3. Karl Marx' Bestimmung der Religion als „Opium des Volkes" 67 1.4.4. Horkheimers Kritik an religiöser Heilsgewissheit und sein Weg zur Formulierung religiöser Sehnsucht 70 1.4.5. Zusammenfassung 77 1.5. Jenseits von Theismus und Atheismus - Nietzsches Wort vom „Tod Gottes" 79 1.5.1. Der Tod einer als solche durchschauten Illusion 79 1.5.2. Eine Fortsetzung der von Kant formulierten Vernunftkritik 83 1.5.3. Die Metamorphose vom Menschen zum Übermenschen — eine Katastrophe 84 1.5.4. Von Kant zu Nietzsche - oder: Vom Postulat zur Usurpation des neuen Menschen 86 1.5.5. Der Versuch einer genetischen Destruktion von Religion und Moral 87 „Moral" und Moral- „Wahrheit" und Wahrheit, 87 Die Triebkraft des Ressentiments und ihre Ausdrucksgestalten von Herren- und Sklavenmoral 91 Konkretisierungen: Moralkritik in Büchners „Dantons "Tod" und in den Evangelien 92 Die Fortsetzung des Ressentiments in seiner Aufdeckung und die Einigkeit Jesu 95 1.5.6. Theologische Implikationen und Anregungen im Werk Nietzsches 99 Ein aus der Christentumskritik geborener Zugang zu Jesus Christus 99 Ein Neuverständnis - der Sündenfallserzählung und Girards mimetische Theorie 100 Mimetisches Verhalten als Angstverhalten 104 Von der Sünde zur Erbsünde 109 Erbsünde und Freiheit 113 Eine Gegenbewegung der tendenziellen Gewaltfreiheit und Liebe 115 1.5.7. Der bleibende Rationalitätsanspruch eines postulatorischen Gottesglaubens 117 1.6. Zusammenfassung 119 2. Der Gott Jesu Christi 121 2.1. Die Entwicklung des biblischen Glaubens 121 2.1.1. „Mischtexte" und die unabschließbare Aufgabe ihrer „Entmischung" 121 2.1.2. Ein Neuverständnis des Sündenfalls: der Rückfall in die Natürlichkeit 125 2.1.3. Von der Monolatrie zum Monotheismus 128 Die gentilreligiöse Prägung des Anfangs 128 Monolatrie und Opfer 130 Der biblische Umgang mit Paradoxieerfahrungen 135 Konsequenzen der monotheistischen Neuorientierung 139 2.1.4. Ein Gestaltwandel des ursprünglich gentilistischen „ingroup-outgroup-Schemas" 142 2.2. Jesus und das Judentum 146 2.3. Die Bergpredigt 152 2.4. Eine größere Gerechtigkeit 157 2.5. Paulus und das Gesetz 161 2.6. Konsequenzen für die Lektüre der Evangelien 163 2.7. Jesus und die Ehebrecherin (Joh 8,2-11) 164 2.7.1. Ein Ikonoklasmus des Wortes 165 2.7.2. Der erste Stein 168 2.8. Die Heilung von Besessenen und Kranken 170 2.9. Eine erste „Wiederkehr des Verdrängten im Verdrängenden" 171 2.10. Zur theologischen Bedeutung der Wunder 174 2.10.1. Das apologetische Wunderverständnis und seine Grenzen 174 2.10.2. Eine Zwischenüberlegung: Historizität und Bedeutung geschichtlicher Ereignisse 176 2.10.3. Jesus als der „perfectissimus communicator" und die zweite „Wiederkehr des Verdrängten im Verdrängenden" 179 2.11. Vom Kultbild über den Text und das Fleisch zum Geist - Eine Evolutionsgeschichte des religiösen Bewusstseins 182 2.12. Von der Gnade zur „billigen Gnade" 183 2.13. Vorläufiger Ausblick: Wort, Fleisch, Geist und die Zeugnisgestalt der Kirche 187 2.14. Das Kreuz Jesu als äußerste Offenbarungsgestalt 193 2.14.1. Die unüberbietbare Gestalt göttlicher Barmherzigkeit 193 Gestorben für unsere Sünden — Z« einem missverstandenen Glaubensartikel 193 Gefangen in den Mechanismen der Sünde — Der Besessene von Gerasa 197 Die Vollendungsgestalt der Inkarnation 201 Kreuz und Auferstehung 203 Paulus und seine Verstrickung in das „Gesetz" — oder: Die Gefangenschaft der Vernunft und der Freiheit 208 Realisationsgestalt und Wahmehmungsgestalt von Offenbarung 212 2.14.2. Aufklärung und Offenbarung 216 2.14.3. Die Trinitätslehre als chrisdiche Gestalt des Bilderverbots 219 2.15. Der im Kreuz offenbare Gott und das Leid seiner Schöpfung 222 2.15.1. Ein Problem praktischer Vernunft 222 2.15.2. Theologische Antwortversuche 224 Ein erster Antwortversuch: Das Böse als Kontrastgrund des Guten 225 Ein zweiter Antwortversuch: Die Instrumentalisierung des Bösen 226 Ein dritter Antwortversuch: Das Leiden als Preis der Freiheit 228 2.15.3. Eine Weiterführung der freiheitstheoretischen Antwortperspektive und deren Grenze 233 Unfreie und frei gewählte Ohnmacht 233 Die Usurpation einer Vogelperspektive 235 Der Opfermechanismus — ein Problem aller Theodizeeansätze 237 Die Wiederkehr des gleichen Problems in der Genese des sittlichen Bewusstseins 239 2.15.4. Die „Frömmigkeit der Theologie" 242 3. Gottes Drama mit seiner Schöpfung — Die Kirche auf dem Weg zur Vollendung der Welt 247 3.1. Ein Drama in fünf Akten 247 3.2. Ein in seiner Historizität umstrittenes Jesuswort 250 3.2.1. Die Herausforderung des „Modernismus" und ein Dogmatismus des Faktischen 250 3.2.2. Eine hilfreiche sprachphilosophische Überlegung 253 3.3. Der Verlauf dieses Dramas 255 3.3.1. Vorbemerkung 255 3.3.2. Akt 1 bis 4: von der Vorausbedeutung zur Offenbarung der Kirche 255 3.3.3. Heiligkeit und Sündigkeit der Kirche — oder: Vom vierten zum fünften Akt des Dramas 257 Die „subsistit-Formel" 258 „Leib" und „Braut Christi" — „Jungfrau und Dirne" 259 Sündige Kirche oder Kirche der Sünder? 260 Religionstheologische Konsequenzen 262 3.4. Das Sakrament Kirche 264 3.4.1. Ein quantitatives sowie qualitatives Verhältnis von Identität und Differenz 264 3.4.2. Konsequenzen für die geschichtliche Gestalt der Kirche 266 3.5. Das kirchliche Zeugnis des Heils und seine Brechung im Sog der Sünde 268 3.5.1. Die Entwicklung zur Staatsreligion und ihre Konsequenzen 267 3.5.2. Die Auseinandersetzung mit dem Kaisertum: der Investiturstreit 272 3.5.3. Von der Dirne des Kaisers zur Dirne der Fürsten: die Reformation 273 3.5.4. In der Auseinandersetzung mit dem Gallikanismus und den nationalstaatlichen Bewegungen des 19. Jahrhunderts — Zum Kontext des Unfehlbarkeitsdogmas 276 Der Gallikanismus als Herausforderung und die Vergöttlichung der Kirche 276 Das Unfehlbarkeitsdogma und die Bedingungen seiner Gültigkeit 281 Die päpstliche Unfehlbarkeit im Lichte des II. Vaticanums 282 3.5.5. Zwischen Dogmatismus und Relativismus — Zum Verhältnis von kirchlichem Lehramt und Pluralismus in Kirche und Gesellschaft 284 Zur gegenwärtigen Diskussionslage 284 Religionsunterricht und Verkündigung in einem Pluralismus der Beliebigkeit 286 Ein schleichendes horizontales Schisma in der gegenwärtigen Kirche 289 Die sündige Kirche auf dem Weg %ur Vollendung ihres heiligen Wesens 291 3.6. Konsequenzen für den Dialog mit konkurrierenden Wahrheitsansprüchen 292 4. Zusammenfassung 296 4.1. Die Vernunft auf den Spuren Gottes 296 4.1.1. Gott — ein Vernunftbedürfnis 296 4.1.2. Zwischen Aufklärungs- und Offenbarungsanspruch 298 Die Unabschließbarkeit des Aufklärungsprozesses 298 Die Wiederkehr des Gottesgedankens in der atheistischen Bestreitung 298 Nietzsches Moralkritik — eine Neuauflage der kritisierten Moral 299 4.2. Der Gott Jesu Christi 300 4.2.1. Die biblische Glaubensgeschichte - mit Nietzsche gelesen 300 4.2.2. Jesus Christus - der wahre Mensch 302 4.3. Die heilige Kirche der Sünder 304 4.3.1. Die wahre und die wirkliche Kirche 304 4.3.2. Der Wahrheitsanspruch der Kirche 305 5. Literaturverzeichnis 307 6. Personenverzeichnis 316 |
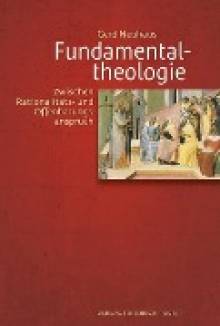
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen