|
|
|
Umschlagtext
»Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann« - dieser Satz, bekannt als »Böckenförde-Diktum«, wirft die Frage auf, welchen Beitrag Religionen zum Funktionieren eines freiheitlich-demokratischen Staates leisten können. Sauer widmet sich dem Recht auf Religionsfreiheit als Thema einer politischen Ethik. Er reflektiert systematisch die Bedeutung der Religionsfreiheit im Werk Ernst-Wolfgang Böckenfördes, stellt die Geschichte der Anerkennung der Religionsfreiheit durch die katholische Kirche dar, akzentuiert Anfragen der Gegenwart und lässt erkennen, wie kontrovers Religionsfreiheit mittlerweile verstanden wird.
Ewald Sauer, geb. 1969 in Bamberg, nach dem Studium der katholischen Theologie in Bamberg und Innsbruck seit 1996 Priester. Von 2004 bis 2015 Pfarrer eines Seelsorgebereiches in Erlangen, seit 2015 Regens im Erzbischöflichen Priesterseminar Bamberg und Ausbildungsleiter der Kapläne. Seit 2022 zusätzlich Leiter der Hauptabteilung Pastorales Personal im Erzbischöflichen Ordinariat und Ordinariatsrat. Rezension
Welchen Beitrag können Religionen zum Funktionieren eines freiheitlich-demokratischen Staates leisten? Das ist ebenso die die Grundfrage dieses Buchs wie eine zentrale Frage des Religionsvefassungsrechts in einem modernen, säkularen Rechtsstaat. Dabei ist das sog. »Böckenförde-Diktum« (nach Ernst-Wolfgang Böckenförde) grundlegend: »Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann.« Die Religions- und Weltanschauungsfreiheit ist in Deutschland grundgesetzlich verankert und hat damit u.a. entscheidende Bedeutung auch für den schulischen Religionsunterricht, der konfessionell angelegt ist. Religionsfreiheit ist die Basis für ein friedliches Miteinander und Voraussetzung für einen Dialog zwischen den Religionen und nichtreligiösen Weltanschauungen. Aber die aktuellen Debatten über z.B. Kopftuch, Kruzifix, Karikaturen, Moscheebau, Schächten, Beschneidung oder kirchliches Arbeitsrecht zeigen den Wandel unserer Gesellschaft von einer weitgehend homogen christlichen zu einer religiös und weltanschaulich pluralen Gesellschaft auf und verschiedene Grundrechte geraten in Konflikt miteinander: Beschneidung versus körperliche Unversehrtheit oder Presse- und Meinungsfreiheit versus Blasphemievorwurf. Religionsfreiheit kann dann u.U. sogar zu anderen Grundrechten moderner Verfassungsstaaten in Konflikt geraten. Dieses Buch reflektiert die Bedeutung der Religionsfreiheit, stellt die Geschichte der Anerkennung der Religionsfreiheit durch die katholische Kirche dar, akzentuiert Anfragen der Gegenwart und zeigt, wie kontrovers Religionsfreiheit mittlerweile verstanden wird.
Thomas Bernhard, lehrerbibliothek.de Inhaltsverzeichnis
Vorwort 5
Thematische Hinführung 13 I. Das Verhältnis von Kirche und Staat - eine historische Skizzierung hinsichtlich des Rechts auf Religionsfreiheit 1. Grundlegende Verhältnisbestimmung 50 1.1 Das Verhältnis von Kirche und Staat als philosophisch-theologische Fragestellung 51 1.1.1 Neues Testament 51 1.1.2 Augustinus 54 1.1.3 Scholastik 58 1.1.4 Neuscholastik 65 1.2 Die traditionelle Lehre der Kirche über den Staat am Beispiel von Oswald von Nell-Breuning von 1948 75 1.2.1 Staatsbegriff und Staatsidee 76 1.2.2 Subsidiarität und Gemeinwohl 77 1.2.3 Gefährdung der Staatsidee 78 1.2.4 Staat und Kirche 79 1.2.5 Objektiver Staat 81 1.3 Der Verfassungsstaat als Derivat des Christentums in der Betrachtung von Josef Isensee 83 1.3.1 Politische Wirkung des Evangeliums 83 1.3.2 Gegenüber von Kirche und Staat 85 1.3.3 Menschenbild und Staatsverfassung 87 1.3.4 Ethik der Grundrechte 89 1.4 Fazit 92 2. Die Haltung der katholischen Kirche anderen Konfessionen und Religionen gegenüber von Anfang des 19. Jahrhunderts bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil (Grundlinien) 94 2.1 Die Entwicklung seit der Reformation 97 2.1.1 Notwendigkeit der Befriedung des Konflikts der Konfessionen 99 2.1.2 Rechtsphilosophische Beiträge zum Friedenserhalt 100 2.1.3 Erklärung der Menschenrechte 105 2.2 Die Situation der katholischen Kirche in Europa zu Beginn des 19. Jahrhunderts 110 2.2.1 Historische Vorbedingungen 111 2.2.2 Geistesgeschichtliche Vorbedingungen 114 2.2.3 Immanentes Freiheitsverständnis 116 2.3 Der Liberalismus des 19. Jahrhunderts 117 2.3.1 Restaurative Gegenwehr 118 2.3.2 Joseph de Maistre 119 2.3.3 FElicite de Lamennais 121 2.4 Die lehramtliche Verurteilung des Liberalismus 126 2.4.1 Enzyklika „Mirari vos" von Papst Gregor XVI 126 2.4.2 Enzyklika „Quanta cura" von Papst Pius IX 128 2.5 Die Entwicklungen der Staatslehre und des Freiheitsgedankens vom Ende des 19. Jahrhunderts bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil 130 2.5.1 Freiheitsbegriff bei Papst Leo XIII. 130 2.5.2 Subsidiarität und Personalität bei Papst Pius XI 137 2.5.3 Würdigung der Demokratie und die Betonung des Toleranzgedankens bei Papst Pius XII. 139 2.5.4 Verbindung von Gemeinwohlprinzip und Würde der Person bei Papst Johannes XXIII 147 2.6 Fazit 153 3. Die Konzilserklärung „Dignitatis humanae" und ihre lehramtliche Rezeption 156 3.1 Die Erklärung „Dignitatis humanae" 157 3.1.1 Entstehungsgeschichte der Konzilserklärung in ihren wichtigsten Etappen 157 3.1.2 Darstellung der Konzilserklärung in ihren wesentlichen Aussagen 163 3.2 Lehramtliche Rezeption des Konzilstextes 170 3.2.1 Menschenwürde und Evangelium: Papst Paul VI. 172 3.2.2 Kategorisches Verständnis der Freiheitsrechte: Papst Johannes Paul II. 173 3.2.3 Fundamentaltheologische Prinzipienlehre: Papst Benedikt XVI. 177 3.2.4 Gesellschaftspolitische Dimension: Papst Franziskus 185 3.3 Fazit 195 II. Das Recht auf Religionsfreiheit in ausgewählten Werken von Ernst-Wolfgang Böckenförde 1. Religionsfreiheit in Kirche und Staat 202 1.1 Religionsfreiheit als Aufgabe der Christen 204 1.1.1 Toleranz und Religionsfreiheit als Leidensweg der abendländischen Christenheit 205 1.1.2 Kritik der traditionellen kirchlichen Lehre 207 1.1.3 Ausblick: Religionsfreiheit als Aufgabe der Christen 209 1.2 Würdigung der „Erklärung über die Religionsfreiheit" 211 1.2.1 Vom Recht der Wahrheit zum Recht der Person 212 1.2.2 Moralische Verpflichtung gegenüber der Wahrheit 215 1.2.3 Konsequenzen aus dem Grundrecht auf Religionsfreiheit 216 1.3 Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation 218 1.3.1 Gegenüber von sakraler Ordnung und politischer Ordnung im Investiturstreit 219 1.3.2 Emanzipation des Staates und Souveränitätsidee im Dienst der Friedensordnung 222 1.3.3 Wagnis der Freiheit und „Böckenförde — Diktum" 225 1.4 Fazit 227 2. Freiheit als Prinzip des Rechts 228 2.1 Das Recht auf Freiheit 229 2.1.1 Gewährleistung von Freiheit durch das Recht 230 2.1.2 Begrenzung des Staates als Bedingung der Freiheit 234 2.1.3 Aufgaben des Staates zur Freiheitsverwirklichung 236 2.2 Das Verhältnis des Rechts zur sittlichen Ordnung 237 2.2.1 Aufgabe und Funktion des Rechts 239 2.2.2 Reziprokes Verhältnis zwischen Recht und sozialer Wirklichkeit 240 2.2.3 Recht als Erhaltungsordnung 243 2.3 Der Staat als sittlicher Staat 244 2.3.1 Staat als Herrschafts- und Friedensordnung 245 2.3.2 Inhaltliche Zweckausrichtung des Staates 246 2.3.3 Grenzen staatlicher Tätigkeit 247 2.4 Fazit 250 3. Anthropologische Grundbestimmung 252 3.1 Das Bild vom Menschen in der Rechtsordnung 252 3.1.1 Individuum als Voraussetzung des Rechts 254 3.1.2 Verlust der metaphysisch-transzendenten Dimension 254 3.1.3 Problematik des Pluralismus 256 3.2 Die Unterscheidung zwischen Staat und Gesellschaft 258 3.2.1 Historische Grundlagen und Voraussetzungen 259 3.2.2 Verfassungsorganisatorisches Prinzip 262 3.2.3 Staat und Gesellschaft in der Demokratie 264 3.3 Das Grundrecht auf Gewissensfreiheit 267 3.3.1 Gewissensfreiheit als Ergebnis historischer Entwicklungen 269 3.3.2 Neuakzentuierung von Artikel 4 Grundgesetz 272 3.3.3 Gewissensbegriff 275 3.4 Fazit 278 4. Christsein im politischen Prozess 279 4.1 Die Stellung und die Bedeutung der Religion in einer „civil society" 280 4.1.1 Religionsfreiheit und Rechtsordnung 281 4.1.2 Rechtsstatus der Religion 283 4.1.3 Bedeutung und Wirksamkeit der Religion 285 4.2 Die Formen kirchlicher Wirksamkeit in Staat und Gesellschaft 289 4.2.1 Verhältnis von kirchlichem Handeln und politischer Wirksamkeit 291 4.2.2 Politisches Handeln durch kirchliche Amtsträger 292 4.2.3 Politisches Handeln durch Laien 295 4.3 Das politisches Mandat der Kirche 298 4.3.1 Theologische Aspekte der Kirchenverfassung 300 4.3.2 Konsequenzen für das politische Mandat 302 4.4 Fazit 305 5. Abschließende Systematisierung und Einordnung 307# 5.1 Zugänge zur Religionsfreiheit als Kriterien der Systematisierung 307 5.1.1 Historischer Zugang 310 5.1.2 Rechtsphilosophischer Zugang 312 5.1.3 Sozialethischer Zugang 315 5.1.4 Ekklesiologischer Zugang 319 5.2 Verfassung und Politik als Kriterien der Einordnung 322 5.2.1 Religionsfreiheit im Grundgesetz 324 5.2.2 Begrenzung verfassungsrechtlicher Bestimmungen 331 5.2.3 Bedeutung des Politischen 338 5.3 Fazit 340 III. Zusammenfassung und Ausblick auf Herausforderungen der Gegenwart 1. Zusammenfassung 343 1.1 Vom Konfessionalismus bis zur Anerkennung der Religionsfreiheit 344 1.1.1 Zur grundlegenden Verhältnisbestimmung von Kirche und Staat 345 1.1.2 Zur Entwicklung des Rechts auf Religionsfreiheit in der katholischen Kirche vom Zeitalter der Reformation bis zu Beginn des Zweiten Vatikanischen Konzils 347 1.1.3 Zur Konzilserklärung „Dignitatis humane" und ihrer Rezeption 352 1.2 Religionsfreiheit als verfassungsrechtlich garantiertes Grundrecht 358 1.2.1 Zur Religionsfreiheit in Kirche und Staat 359 1.2.2 Zur Freiheit als Prinzip des Rechts 360 1.2.3 Zur anthropologischen Grundbestimmung 362 1.2.4 Zum Christsein im politischen Prozess 363 1.2.5 Zur Systematisierung und Einordnung 365 1.3 Ergebnissicherung 366 1.3.1 Vielfalt ethischer Prinzipien 368 1.3.2 Religionsfreiheit als Ergebnis anthropologischer und theologischer Prinzipien 370 1.3.3 Recht ist Friedens- und Freiheitsordnung 372 1.3.4 Verfassungsbindung und politische Wirksamkeit 373 2. Ausblick 374 2.1 Religionsfreiheit und Pluralismus 376 2.1.1 Pluralismus als religiöses Phänomen 377 2.1.2 Konsequenzen für die Religionsfreiheit 380 2.1.3 Problematisierung und Einordnung 384 2.2 Religionsfreiheit und Fundamentalismus 388 2.2.1 Der Begriff „Fundamentalismus" 389 2.2.2 „Online-Hassrede" als Bedrohung der Religionsfreiheit 391 2.2.3 Bewertung und Konsequenzen 393 Epilog 397 Abkürzungen 400 Bibliographie 402 |
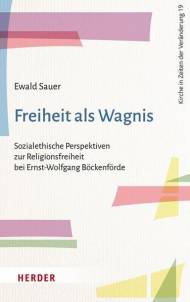
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen