|
|
|
Verlagsinfo
Grundlagen- und Fachwissen für das gesamte Berufsfeld Elektrotechnik mit dem Schwerpunkt Energietechnik für Handwerks- und Industrieberufe. Unterstützt den handlungsorientierten Unterricht. Überarbeitung aller Kapitel. Aktualisierung von Normen. Anordnung der Kapitel nach didaktischen und technologischen Gesichtspunkten. Arbeits- und Unfallschutz. Gebäudetechnik. Telekommunikation (ISDN). Automatisierungstechnik. Regelungstechnik. Seiten zum "Wiederholen - Vertiefen - Anwenden" am Kapitelende. Inhaltsverzeichnis
1 Arbeits- und Unfallschutz
1.1 Sicherheit am Arbeitsplatz 1.2 Gerätesicherheitsgesetz 1.3 Gefahrstoffverordnung 1.4 Sicherheitszeichen 1.5 Erste Hilfe 2 Grundbegriffe der Elektrotechnik 2.1 Elektrischer Stromkreis 2.2 Umgang mit physikalischen Größen Masse und Kraft Mechanische Arbeit Energie Mechanische Leistung 2.3 Elektrische Ladung (Elektrizitätsmenge) Aufbau der Atome 2.4 Elektrische Spannung 2.4.1 Spannungsquellen 2.4.2 Potenzial 2.4.3 Arten der Spannungserzeugung 2.4.4 Messen elektrischer Spannung 2.5 Elektrischer Strom 2.5.1 Elektrischer Strom in Metallen 2.5.2 Messen elektrischer Stromstärke 2.5.3 Wirkungen des elektrischen Stromes 2.5.4 Stromarten 2.5.5 Stromdichte 2.6 Elektrischer Widerstand Widerstand und Leitwert 2.7 Ohmsches Gesetz 2.8 Leiterwiderstand 2.9 Temperaturabhängigkeit des Widerstands 2.10 Bauformen von Widerständen 2.11 Elektrische Energie und Arbeit 2.11.1 Gewinnung elektrischer Energie 2.11.2 Elektrische Arbeit 2.12 Elektrische Leistung 2.13 Wirkungsgrad 2.14 Elektrowärme Wiederholungsseite zu Kapitel 2 3 Grundschaltungen der Elektrotechnik 3.1 Reihenschaltung 3.1.1 Gesetze der Reihenschaltung 3.1.2 Vorwiderstände 3.1.3 Messbereichserweiterung von Spannungsmessern 3.1.4 Spannungsfall an Leitungen 3.2 Parallelschaltung 3.3 Gemischte Schaltungen 3.3.1 Spannungsteiler 3.3.2 Messbereichserweiterung von Strommessern 3.3.3 Brückenschaltung 3.3.4 Widerstandsbestimmung durch Strom- und Spannungsmessung 3.4 Innenwiderstand von Spannungsquellen 3.4.1 Messungen an Spannungsquellen 3.4.2 Ersatzspannungsquelle und Ersatzstromquelle 3.4.3 Anpassung 3.4.4 Schaltungen von Spannungsquellen Wiederholungsseite zu Kapitel 3 4 Elektrisches Feld 4.1 Eigenschaften des elektrischen Feldes 4.2 Grundbegriffe 4.2.1 Elektrische Feldstärke 4.2.2 Elektrische Influenz und Polarisation 4.2.3 Elektrische Felder in der Praxis 4.3 Kondensator im Gleichstromkreis 4.3.1 Verhalten eines Kondensators 4.3.2 Kapazität eines Kondensators 4.3.3 Laden und Entladen eines Kondensators 4.3.4 Energie des geladenen Kondensators 4.4 Schaltungen von Kondensatoren 4.4.1 Parallelschaltung 4.4.2 Reihenschaltung 4.5 Kenngrößen und Bauformen von Kondensatoren 4.5.1 Kenngrößen 4.5.2 Bauformen Wiederholungsseite zu Kapitel 4 5 Magnetisches Feld 5.1 Magnete 5.1.1 Pole des Magneten 5.1.2 Magnetisches Feld und seine Darstellung 5.2 Elektromagnetismus 5.2.1Stromdurchflossener Leiter und Magnetfeld 5.2.2 Stromdurchflossene Spule und Magnetfeld 5.3 Magnetische Größen 5.3.1 Magnetischer Fluss 5.3.2 Elektrische Durchflutung 5.3.3 Magnetische Feldstärke 5.3.4 Magnetische Flussdichte 5.4 Eisen im Magnetfeld einer Spule 5.5 Magnetischer Kreis 5.6 Strom und Magnetfeld 5.6.1 Stromdurchflossener Leiter im Magnetfeld 5.6.2 Stromdurchflossene Spule im Magnetfeld 5.6.3 Stromdurchflossene parallele Leiter 5.7 Spannungserzeugung durch Induktion 5.7.1 Generatorprinzip {Induktion der Bewegung) 5.7.2 Lenzsche Regel 5.7.3 Transformatorprinzip (Induktion der Ruhe) 5.7.4 Selbstinduktion 5.7.5 Wirbelströme. Wiederholungsseite zu Kapitel 5 6 Schaltungstechnik 6.1 Schaltungsunterlagen 6.2 Installationsschaltungen 6.2.1 Lampenschaltungen 6.2.2 Stromstoßschaltung 6.2.3 Treppenhaus-Zeitschaltung 6.2.4 Hausrufanlagen 6.2.5 Haussprechanlagen 6.3 Elektromagnetisch betätigte Schaltgeräte 6.3.1 Relais 6.3.2 Schütze Wiederholungsseite zu Kapitel 6 7 Wechsel. und Drehstromtechnik 7.1 Kenngrößen der Wechselstromtechnik 7.1.1 Periode und Scheitelwert 7.1.2 Frequenz und Periodendauer 7.1.3 Frequenz und Wellenlänge 7.1.4 Frequenz und Polpaarzahl 7.1.5 Zeitlicher Verlauf von Wechselgrößen 7.2 Sinusförmige Wechselgrößen 7.2.1 Zeigerdarstellung von Sinusgrößen 7.2.2 Kreisfrequenz 7.2.3. Erzeugung von Sinusspannungen 7.2.4 Scheitelwert und Effektivwert 7.2.5 Arithmetischer Mittelwert 7.2.6 Phasenverschiebung 7.2.7 Wirkwiderstand 7.2.8 Scheinwiderstand 7.3 Spule im Wechselstromkreis 7.3.1 Induktiver Blindwiderstand 7.3.2 Reihenschaltung aus Wirkwiderstand und induktivem Blindwiderstand 7.3.3 Spannungsdreieck 7.3.4 Widerstandsdreieck 7.3.5 Parallelschaltung aus Wirkwiderstand und induktivem Blindwiderstand 7.3.6 Stromdreieck und Leitwertdreieck 7.3.7 Schaltungen von Spulen 7.4 Wechselstromleistung 7.4.1 Wirkleistung 7.4.2 Scheinleistung 7.4.3 Blindleistung 7.4.4 Leistungsdreieck bei induktiver Last 7.4.5 Leistungsfaktor 7.4.6 Verlustleistung bei Spulen 7.5 Kondensator im Wechselstromkreis 7.5.1 Kapazitiver Blindwiderstand 7.5.2 Reihenschaltung aus Wirkwiderstand und kapazitivem Blindwiderstand 7.5.3 Parallelschaltung aus Wirkwiderstand und kapazitivem Blindwiderstand 7.5.4 Verlustleistung bei Kondensatoren 7.6 Schaltungen aus Spulen. Kondensatoren und Wirkwiderständen 7.6.1 Reihenschaltung aus Wirkwiderstand, induktivem und kapazitivem Blindwiderstand 7.6.2 Parallelschaltung aus Wirkwiderstand, induktivem und kapazitivem Blindwiderstand 7.7 Schwingkreise 7.7.1 Resonanz 7.7.2 Reihenschwingkreis 7.7.3 Parallelschwingkreis 7.8 Dreiphasenwechselstrom (Drehstrom) 7.8.1 Entstehung der Dreiphasenwechselspannung 7.8.2 Verkettung 7.8.3 Sternschaltung 7.8.4 Dreieckschaltung 7.8.5 Anwendung von Sternschaltung und Dreieckschaltung 7.8.6 Leistung bei Dreiphasenwechselstrom 7.8.7 Leistungsmessung bei Dreiphasenwechselstrom 7.9 Kompensation 7.9.1 Kompensationsarten 7.9.2 Bemessung von Kompensationskondensatoren 7.9.3. Kompensation bei elektronischen Stromrichterschaltungen 7.9.4 Tonfrequenzsperrkreise 7.10 Funkentstörung 7.10.1 Entstehung von Funkstörungen 7.10.2 Maßnahmen zur Funkentstörung Wiederholungsseite zu Kapitel 7 8 Messtechnik 8.1 Elektrische Messgeräte 8.1.1 Grundbegriffe der Messtechnik 8.1.2 Anzeigearten von Messgeräten 8.1.3 Analoge Messgeräte 8.1.4 Digitale Messgeräte 8.1.5 Messfehler von Messgeräten. 8.1.6 Praktisches Messen. 8.2 Elektrische Messwerke 8.2.1 Drehspulmesswerk 8.2.2 Dreheisenmesswerk 8.2.3 Elektrodynamisches Messwerk 8.3 Elektrizitätszähler 8.3.1 Wirkverbrauchszähler 8.3.2 Elektronische Elektrizitätszähler 8.4 Messen von Widerständen Messbrücken 8.5 Messen mit Stromzangen 8.6 Oszilloskop 8.6.1 Analoges Oszilloskop 8.6.2 Zweikanal-Oszilloskop 8.6.3 Digital-Oszilloskop 8.6.4 Messen mit dem Oszilloskop 8.7 Messen nichtelektrischer Größen mit Sensoren 8.7.1 Aktive und passive Sensoren 8.7.2 Analoge Sensoren 8.7.2.1 Sensoren zur Weg- und Winkelmessung 8.7.2.2 Sensoren zur Messung von Dehnung, Kraft, Druck und Drehmoment 8.7.2.3 Sensoren zur Messung von Temperaturen 8.7.3 Binäre Sensoren 8.7.4 Digitale Sensoren Wiederholungsseite zu Kapitel 8 9 Elektronik 9.1 Halbleiterwerkstoffe 9.2 Halbleiterwiderstände 9.2.1Spannungsabhängige Widerstände (Varistoren) 9.2.2 Heißleiter (NTC-Widerstände) 9.2.3 Kaltleiter (PTC-Widerstände) 9.2.4 Feldplatte 9.3 Hallgenerator 9.4 Halbleiterdioden 9.4.1 Wirkungsweise 9.4.2 Leistungsdioden 9.4.3 Z-Dioden (Begrenzerdioden) 9.4.4 Halbleiterkennzeichnung 9.5 Transistoren 9.5.1 Bipolare Transistoren 9.5.1.1 Einstellung des Arbeitspunktes 9.5.1.2 Stabilisierung des Arbeitspunktes 9.5.1.3 Transistor als Schalter 9.5.1.4 Verstärkerschaltungen Grundbegriffe der Verstärkertechnik Grundschaltungen des bipolaren Transistors Einstufiger bipolarer Transistorverstärker in Emitterschaltung Mehrstufiger Verstärker Leistungsverstärker 9.5.2 Feldeffekt-Transistoren Verstärkerschaltungen mit Feldeffekt-Transistoren 9.6 Optoelektronik 9.6.1 Optoelektronische Sender (Leuchtdioden) 9.6.2 Optoelektronische Empfänger 9.6.3 Optokoppler 9.6.4 Flüssigkristallanzeigen 9.6.5 Schaltungsbeispiele optoelektronischer Empfänger 9.7 Integrierte Schaltungen 9.8 Operationsverstärker 9.8.1 Grundlagen 9.8.2 Analoge Schaltungen mit Operationsverstärkern 9.8.3 Digitale Schaltungen mit Operationsverstärkern 9.9 Digitaltechnik 9.9.1 Signalarten der Digital- und Steuerungstechnik 9.9.2 Grundverknüpfungen 9.9.2.1 UND-Verknüpfung (Konjunktion) 9.9.2.2 ODER-Verknüpfung (Disjunktion) 9.9.2.3 NICHT-Verknüpfung (Negation) 9.9.3 Grundverknüpfungen mit Ausgangsoder Eingangsnegation 9.9.3.1 Verknüpfungen mit Ausgangsnegation 9.9.3.2 Verknüpfungen mit Eingangsnegation 9.9.3.3 Eingangsbeschaltung log. Verknüpfungen 9.9.4 Schaltkreisfamilien 9.9.4.1 TTL-Schaltkreisfamilie 9.9.4.2 CMOS-Schaltkreisfamilie 9.9.5 Schaltalgebra 9.9.6 Schaltungen in NAND- und in NOR- Technik 9.9.7 KV-Diagramm 9.9.8 Kippschaltungen 9.9.9 Kippglieder 9.9.10 Schaltungen mit Kippgliedern 9.9.10.1 Duales Zahlensystem 9.9.10.2 Zähler 9.9.10.3 Schieberegister 9.9.10.4 Analog-Digital-Umsetzer und Digital-Analog-Umsetzer 9.10 Leistungselektronik 9.10.1 Bauelemente der Leistungselektronik 9.10.1.1 Thyristor 9.10.1.2 GTO-Thyristor 9.10.1.3 Thyristordioden 9.10.1.4 Triac 9.10.1.5. IG BT 9.10.2 Schaltungen der Leistungselektronik 9.102.1 Begriffe Gleichrichtung 9.10.2.2 Ungesteuerte Gleichrichter 9.10.2.3 Gesteuerte Gleichrichter 9.10.2.4 Wechselrichterbetrieb von Gleichrichtern 9.10.2.5 Wechselstromumrichter 9.10.2.6 Gleichstromumrichter 9.10.2.7 Wechselrichter 9.10.2.8 Netzgeräte 9.102.9 Betriebsarten elektrischer Antriebe 9.10.2.10 Gleichstrom-Antriebe 9.10.2.11 Wechselstrom-Antriebe 9.11 Kühlung von Halbleiter-Bauelementen Wiederholungsseite zu Kapitel 9 10 Elektrische Anlagen 10.1 Energieerzeugung und Energieübertragung 10.1.1 Kraftwerke 10.1.1.1 Wärmekraftwerke 10.1.1.2 Umweltschutz in Wärmekraftwerken 10.1.1.3 Wasserkraftwerke 10.1.1.4 Erneuerbare Energien 10.1.2 Umspannwerke 10.1.2.1 Spannungsebenen 10.1.2.2 Umspannanlagen 10.1.2.3 Hochspannungsschalter 10.1.3 Übertragungsnetze 10.1.3.1 Höchst-. Hoch- und Mittelspannungsnetze 10.1.3.2 Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung 10.1.3.3 Netzformen 10.1.4 Niederspannungsanlagen 10.1.4.1Netzaufbau 10.1.4.2 Hausanschluss 10.1.4.3 Erdungsanlagen 10.1.4.4 Hauptpotenzialausgleich 10.1.4.5 Hauptstromversorgungssysteme 10.2 Isolierte Leitungen, Kabel und Freileitungen 10.2.1 Farbkennzeichnung von isolierten Leitungen und Kabeln 10.2.2 Isolierte Leitungen 10.2.3 Kabel für Mittelspannungs- und Niederspannungsanlagen 10.2.4 Freileitungen für Hoch- und Mittelspannungsanlagen 10.3 Schutz elektrischer Leitungen und Verbraucher 10.4 Schutzschalter Auslösekennlinien von Überstrom-Schutzeinrichtungen 10.5 Bemessung von fest verlegten Kabeln und Leitungen 10.5.1 Spannungsfall an Leitungen 10.5.2 Anordnung von Überstrom-Schutzeinrichtungen 10.5.3 Beispiel einer Leitungsberechnung 10.6 Räume und Anlagen besonderer Art 10.6.1 Räume mit Badewanne oder Dusche 10.6.2 Überdachte Schwimmbäder und Schwimmbäder im Freien 10.6.3 Sauna-Anlagen 10.6.4 Baustellen 10.6.5landwirtschaftliche und gartenbauliche Anwesen 10.6.6 Feuergefährdete Betriebsstätten 10.6.7 Explosionsgefährdete Bereiche 10.6.8 Medizinisch genutzte Räume 10.6.9Übersicht der Raumarten und Betriebsstätten 10.6.10 Elektrische Ausrüstung von Industriemaschinen 10.7 Brandbekämpfung in elektrischen Anlagen 10.7.1 Verhalten bei Brand in elektrischen Anlagen 10.7.2 Löschmittel Wiederholungsseite zu Kapitel 10 11 Schutzmaßnahmen 11.1 Gefahren im Umgang mit dem elektrischen Strom 11.1.1 Wirkungen des elektrischen Stromes im menschlichen Körper 11.1.2 Direktes und indirektes Berühren 11.1.3 Fachbegriffe Schutzmaßnahmen 11.2 Sicherheitsbestimmungen für Niederspannungsanlagen 11.3. Begriffe und Kenngrößen 11.3.1 Schutzklassen 11.3.2 IP-Schutzarten (nach DIN VDE 0470) 11.3.3 Maßnahmen bei Arbeiten an elektrischen Anlagen 11.3.4 Fehlerarten 11.3.5 Spannungen im Fehlerfall 11.4 Schutz gegen elektrischen Schlag 11.5 Schutz sowohl gegen direktes als auch bei indirektem Berühren 11.5.1 Schutz durch Kleinspannung SELV und PELV 11.5.2 Schutz durch Begrenzung von Ladung 11.6 Schutz gegen elektrischen Schlag unter normalen Bedingungen (Schutz gegen direktes Berühren oder Basisschutz) 11.7 Schutz gegen elektrischen Schlag unter Fehlerbedingungen (Schutz bei indirektem Berühren oder Fehlerschutz) 11.7.1 Drehstromsysteme 11.7.2 Schutzmaßnahmen im TN-System 11.7.3 Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) 11.7.4 Schutzmaßnahmen im TT-System 11.7.5 Schutzmaßnahmen im IT-System Schutz durch Verwendung von Betriebsmitteln der 11.7.6 Schutzklasse II oder durch gleichwertige Isolierung (Schutzisolierung) 11.7.7 Schutz durch nicht leitende Räume 11.7.8 Schutztrennung 11.7.9 Schutz durch erdfreien, örtlichen Potenzialausgleich 11.8 Prüfen der Schutzmaßnahmen 11.8.1 Prüfen der Schutzmaßnahmen SELV, PELV und Schutztrennung 11.8.2 Isolationswiderstandsmessung in elektrischen Anlagen 11.8.3Messen der Isolationswiderstände von Fußböden und Wänden 11.8.4 Prüfungen im TN-System und TT-System 11.8.5 Messen der Schleifenimpedanz 11.8.6 Messen des Erdungswiderstandes 11.8.7 Prüfen der Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) 11.8.8 Prüfen des Hauptpotenzialausgleichs 11.9 Schutz gegen elektrostatische Aufladung Wiederholungsseite zu Kapitel 11 12 Gebäudetechnik 12.1 Licht- und Beleuchtungstechnik 12.1.1 Licht 12.1.2 Größen der Lichttechnik 12.1.3 Anforderungen an eine gute Beleuchtung 12.1.4 Beispiel zur Ermittlung einer Lampenzahl 12.1.5 Glühlampen 12.1.6 Gasentladungslampen 12.1.6.1 Leuchtstofflampen 12.1.6.2 Quecksilberdampf- und Natriumdampflampen 12.1.7 Leuchtröhrenanlagen 12.2 Elektrogeräte 12.2.1 Allgemeines über Elektrogeräte 12.2.2 Elektrische Warmwasserbereiter 12.2.3 Elektrische Raumheizung 12.2.4 Elektrische Geräte zur Nahrungsvorratshaltung und Zubereitung 12.2.5 Prüfen von Elektrogeräten nach Instandsetzung und Änderung 12.2.6 Wiederholungsprüfungen an elektrischen Geräten 12.3 Antennentechnik 12.3.1 Wirkungsweise der Antennen 12.3.2 Empfangsantennen 12.3.3 Satelliten-Empfangsanlagen 12.3.4 Breitband-Kommunikationsanlagen 12.3.5 Aufbau von Antennenanlagen 12.3.6 Verstärkungsmaß, Dämpfungsmaß und Pegel 12.3.7 Berechnung einer Empfangsantennenanlage 12.3.8 Errichten von Empfangsantennen-Anlagen 12.3.9 Vorschriften zur Errichtung von Antennenanlagen 12.4 Telekommunikation 12.4.1Datenübertragung 12.4.2 Analoges Telekommunikationssystem 12.4.3 Digitales Telekommunikationssystem 12.5 Gebäudeautomation 12.5.1Gebäudeleittechnik 12.5.2 Gebäudesystemtechnik 12.5.3 EIB-Projekt 12.6 Gefahrenmeldeanlagen 12.6.1 Einbruchmeldeanlagen 12.6.2 Brandmeldeanlagen 2.7 Blitzschutz 12.7.1 Entstehung des Blitzes 12.7.2 Wirkungen des Blitzstromes 12.7.3 Gebäude-Blitzschutz 12.7.3.1 Äußerer Blitzschutz 12.7.3.2 Innerer Blitzschutz Wiederholungsseite zu Kapitel 12 13 Elektrische Maschinen 13.1 Transformatoren 13.1.1 Einphasentransformatoren 13.1.1.1 Leerlaufspannung 13.1.1.2 Übersetzungen 13.1.1.3 Leerlauf und Belastung 13.1.1.4 Kurzschlussspannung 13.1.1.5 Kurzschlussstrom 13.1.1.6 Wirkungsgrad von Transformatoren 13.1.2 Kleintransformatoren 13.1.2.1 Aufbau 13.1.2.2 Arten von Kleintransformatoren 13.1.2.3 Prüfspannungen bei Kleintransformatoren 13.1.3 Sondertransformatoren 13.1.3.1 Spartransformatoren 13.1.3.2 Streufeldtransformatoren 13.1.3.3 Lichtbogen-Schweißtransformatoren 13.1.4 Messwandler 13.1.4.1 Spannungswandler 13.1.4.2 Stromwandler 13.1.5 Drehstromtransformatoren 13.1.5.1 Aufbau und Prinzip 13.1.5.2 Schaltungen 13.1.5.3 Unsymmetrische Belastung bei Drehstromtransformatoren 13.1.5.4 Gebräuchliche Schaltgruppen 13.1.6 Parallelschalten von Transformatoren 13.2 Motoren und Generatoren 13.2.1 Grundlagen. 13.2.1.1 Entstehung des Drehfeldes 13.2.1.2 Leistung und Drehmoment 13.2.1.3 Aufbau umlaufender Maschinen 13.2.1.4 Leistungsschild 13.2.1.5 Drehsinn 13.2.2 Drehstrommotoren ohne Stromwender 13.2.2.1 Drehstromasynchronmotoren 13.2.2.2 Motoren mit Kurzschlussläufer 13.2.2.3Anlassen von Kurzschlussläufermotoren (Ständeranlassverfahren) 13.2.2.4 Schleifringläufermotoren 13.2.25 Anlassen von Schleifringläufermotoren (Läuferanlassverfahren) 13.2.2.6 Polumschaltbare Motoren 13.2.2.7Bremsbetrieb von Drehstromasynchronmotoren 13.2.2.8 Drehstromlinearmotoren 13.2.2.9 Synchronmotor 13.2.3 Sonstige Drehfeldmotoren 13.2.3.1 Anwurfmotor 13.2.3.2 Drehstrommotor an Wechselspannung (Steinmetzschaltung) 13.2.3.3 Einphaseninduktionsmotoren 13.2.3.4 Einphasenmotor mit Widerstandshilfsstrang 13.2.3.5 Kondensatormotor 13.2.3.6 Spaltpolmotoren 13.2.3.7 Schrittmotor 13.2.3.8 Elektronikmotor 13.2.4 Synchrongenerator 13.2.5 Stromwendermaschinen 13.2.5.1 Aufbau von Gleichstrommaschinen 13.2.5.2 Wirkungsweise von Gleichstromgeneratoren 13.2.5.3 Arten von Gleichstromgeneratoren 13.2.5.4 Ankerquerfeld 13.2.5.5 Anschlussbezeichnung von Stromwendermaschinen 13.2.5.6 Wirkungsweise von Gleichstrommotoren 13.2.5.7 Arten von Gleichstrommotoren 13.2.5.8 Scheibenläufermotor 13.2.5.9 Universalmotoren 13.2.6 Umformer 13.2.7 Betriebsarten elektrischer Maschinen 13.2.8 Bauformen elektrischer Maschinen 13.2.9 Isolierstoffklassen 13.2.10 Kühlung elektrischer Maschinen 13.2.11Wicklungen von Motoren 13.2.11.1 Drehstromwicklungen 13.2.11.2 Einphasenwicklungen 13.2.12 Gleichstromwicklungen 13.2.13 Wartung und Prüfung elektrischer Maschinen Wiederholungsseite zu Kapitel 13 14 Computertechnik 14.1 Grundbegriffe der Computertechnik 14.1.1 Arbeitsweise eines Computers 14.2 Hardware 14.2.1 Mikroprozessor 14.2.2 Speicher 14.2.3 Eingabegeräte 14.2.4 Ausgabegeräte 14.2.5 Datenaustausch 14.3 Computerprogramme 14.3.1 Systemprogramme 14.3.2 Anwendungsprogramme 14.3.3 Arbeiten mit dem Computer 14.4 Programmiersprachen 14.5 Internet 14.6 Datensicherung und Datenschutz 14.6.1 Datensicherung 14.6.2 Datenschutz Wiederholungsseite zu Kapitel 14 15 Automatisierungstechnik 15.1 Steuerungstechnik 15.1.1 Steuern 15.1.1.1 Fachbegriffe der Steuerungstechnik 15.1.1.2 Steuerungsarten 15.2 Kleinststeuergeräte 15.3 Speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) 15.3.1 Aufbau 15.3.2 Programmiersprachen 15.3.3 Arbeitsweise einer SPS 15.3.4 Programmierung 15.3.4.1 Grundverknüpfungen 15.3.4.2 Öffner und Schließer 15.3.4.3 Speicherfunktionen 15.3.4.4 Zeitfunktionen 15.3.4.5 Zähler 15.3.4.6 Vergleicher 15.3.5 Ablaufsteuerungen 15.3.5.1 Arten von Ablaufsteuerungen 15.3.5.2 Betriebsarten 15.3.5.3 Ablaufkette 15.3.5.4 Programmierung einer Ablaufkette mit SPS 15.4 Regelungstechnik 15.4.1 Aufgaben und Begriffe 15.4.2 Regelstrecken 15.4.2.1Statisches Verhalten von Regelstrecken 15.4.2.2 Dynamisches Verhalten von Regelstrecken 15.4.3 Regler 15.4.3.1 Unstetige Regler 15.4.3.2 Stetige Regler 15.4.5 Regelkreis 15.4.5.1 Schwingungsverhalten 15.4.5.2 Reglerauswahl 15.4.5.3 Reglereinstellung 15.4.6 Universalregler 15.4.7 Entwurf einer Regelung (Beispiel) Wiederholungsseite zu Kapitel 15 16 Physik, Chemie, Werkstoffe, Fertigungsverfahren und Umweltschutz 16.1 Physikalische und chemische Grundlagen 16.1.1 Wichtige physikalische Größen und Einheiten 16.1.1.1 Länge, abgeleitete Größen 16.1.1.2 Masse und Dichte 16.1.1.3 Kraft und Moment 16.1.1.4 Druck. 16.1.1.5 Mechanische Beanspruchungsarten 16.1.1.6 Kohäsion, Aggregatzustand 16.1.1.7 Temperatur 16.1.2 Wichtige Grundstoffe und chemische Verbindungen 16.1.2.1 Chemische Grundbegriffe 16.1.2.2 Chemische Bindungsarten 16.1.2.3 Wichtige chemische Grundstoffe 16.2 Elektrochemie 16.2.1 Umwandlung elektrischer Energie in chemische Energie 16.2.2 Umwandlung chemischer Energie in elektrische Energie 16.2.2.1 Grundlagen 16.2.2.2 Primärelemente 16.2.2.3 Sekundärelemente (Akkumulatoren) 16.2.3 Elektrochemische Korrosion 16.2.3.1 Korrosion durch Elementbildung. 16.2.3.2 Fremdstromkorrosion 16.2.3.3 Schutz gegen elektrochemische Korrosion 16.3 Werkstoffe der Elek1rotechnik 16.3.1 Eisen und Stahl 16.3.1.1 Herstellung von Stahl und Gusseisen 16.3.1.2 Normung des Stahls und der Eisen- Gusswerkstoffe 16.3.2 Leiterwerkstoffe 16.3.2.1 Kupfer(Cu) 16.3.2.2 Aluminium(AI) 16.3.2.3 Kupfer- und Aluminium-Legierungen 16.3.3 Widerstandswerkstoffe 16.3.4 Kontaktwerkstoffe 16.3.5 Magnetwerkstoffe 16.3.5.1 Magnetisch harte Werkstoffe 16.3.5.2 Magnetisch weiche Werkstoffe 16.3.6 Isolierstoffe 16.3.6.1 Elektrische Beanspruchung von Isolierstoffen 16.3.6.2 Anorganische Isolierstoffe 16.3.6.3 Organische Isolierstoffe 16.3.6.4 Flüssige und gasförmige Isolierstoffe 16.4 Fertigungsverfahren und Werkstoffbearbeitung 16.4.1 Urformen 16.4.2 Umformen 16.4.3 Trennen 16.4.3.1 Spanende Verfahren 16.4.3.2 Abtragen 16.4.4 Zerteilen 16.4.5 Verbindungen (Fügen) 16.4.5.1 Lösbare Verbindungen in der Elektrotechnik 16.4.5.2 Unlösbare Verbindungen in der Elektrotechnik 16.4.6 Lasertechnik 16.4.7 Gedruckte Schaltungen 16.4.7.1 Subtraktiv-Technik 16.4.7.2 Additiv- Technik 16.4.7.3 Mehrlagen-Leiterplatten (Multilayer) 16.4.7.4 Drucktechniken 16.4.7.5 Prüfen von gedruckten Schaltungen 16.4.8 SMD Technik 16.4.8.1 Bestückungsverfahren 16.4.8.2 Kleben von SMD-Bauteilen 16.4.8.3 Lötverfahren der SMD- Technik 16.5 Umweltschutz 16.5.1 Umweltschutz im Betrieb 16.5.2Wiederverwertung und Entsorgung von Abfallstoffen Wiederholungsseite zu Kapitel 16 Rechenergebnisse der Wiederholungsseiten Firmenverzeichnis Sachwortverzeichnis |
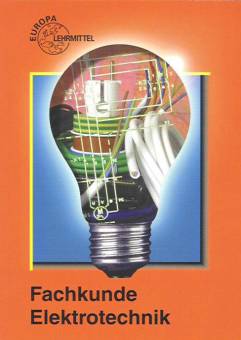
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen