|
|
|
Umschlagtext
Der zunehmend schnelle gesellschaftliche Wandel hat frühere Selbstverständlichkeiten in Lebensanschauung und Lebensführung überholt. An ihre Stelle ist eine verbreitete Verhaltensunsicherheit getreten. Die Frage: »Warum soll ich eigentlich was tun?« wird ganz neu gestellt. Auch christliche Sitte und christliche Normen sind von dieser Unsicherheit erfasst. Die hier vorgelegte Ethik versucht, in dieser Situation Orientierungshilfe zu geben. Sie tut es in sorgfältiger Berücksichtigung der Wirklichkeit wie in der steten Rückbesinnung auf das als maßgeblich angesehene Zeugnis der Heiligen Schrift. Auf diese Weise ist ein eigenständiger, systematisch durchdachter Entwurf theologischer Ethik entstanden, der zugleich offen ist für das Gespräch mit anderen Ansätzen, auch solchen, die nicht von christlichen Voraussetzungen ausgehen.
Dr. theol. Helmut Burkhardt, geboren 1939 in Breslau, war Dozent für Systematische Theologie am Theologischen Seminar St. Chrischona/Schweiz. Jetzt Vorsteher des Diakonissen-Mutterhauses von St. Chrischona/Schweiz. Rezension
Die Ethik wird üblicherweise unterteilt ist die materiale Ethik, in der die Frage im Mittelpunkt steht: „Wie soll ich handeln?“ und in die Fundamentalethik, in der die Frage nach den Grundlagen sittlichen Verhaltens gestellt wird. Dieser Band wendet sich nun in dezidiert christlicher Perspektive der materialen Ethik zu, nachdem die Fundamentalethik in einem ersten Band bereits behandelt worden ist („Was ist Ethik?“, „Entwürfe säkularer Ethik“, spezifisch „theozentrischen Ethik“). Die Materialethik ist unter dem Untertitel „Das gute Handeln“ in diesem zweiten Band (in zwei Teilbänden) erschienen. Dieser 1. Teilband der Materialethik geht von den 10 Geboten aus, die in die Religionsethik (Gebot 1-4) und die Humanethik (Gebot 5-7) unterteilt werden. Der Rest bleibt dem 2. Teilband vorbehalten.
Jens Walter, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Ethisch verantwortliches Handeln braucht Orientierungshilfen! Der zunehmend schnelle gesellschaftliche Wandel hat frühere Selbstverständlichkeiten in Lebensanschauung und Lebensführung überholt. An ihre Stelle ist eine weit verbreitete Verhaltensunsicherheit getreten. Die Frage: "Warum soll ich eigentlich was tun?" wird ganz neu gestellt. Auch christliche Normen sind von dieser Unsicherheit erfasst. Die hier vorgelegte Ethik versucht, in dieser Situation Orientierungshilfe zu geben. Sie tut es unter sorgfältiger Berücksichtigung der Wirklichkeit und in der steten Rückbesinnung auf das als maßgeblich angesehene Zeugnis der Heiligen Schrift. Auf diese Weise ist ein eigenständiger, systematisch durchdachter Entwurf theologischer Ethik entstanden, der zugleich offen ist für das Gespräch mit anderen Ansätzen, auch solchen, die nicht von christlichen Voraussetzungen ausgehen. Dr. theol. Helmut Burkhardt ist Dozent für Systematische Theologie am Theologischen Seminar St. Chrischona bei Basel. Weitere lieferbare Titel des Autors: "Die Inspiration heiliger Schriften bei Philo von Alexandrien"; " Einführung in die Ethik"; "Christ werden. Bekehrung und Wiedergeburt als Anfang des christlichen Lebens"; "Wirtschaft ohne Ethik"; "Christliche Ethik im Wandel der Systeme". Inhaltsverzeichnis
I. Überlegungen zum Aufbau inhaltlicher Ethik 11
1. Subjektiver Ansatz oder Tugendethik 11 1.1 Antike Tugendethik 12 1.2 Die Aufnahme antiker Tugendethik in der christlichen Theologie 13 1.3 Der Tugendgedanke in der Bibel 13 1.4 Kritik der Tugendethik 14 1.5 Das bleibende Recht der Tugendethik 15 2. Objektiver Ansatz oder Gebote- bzw. Pflichtenethik 16 2.1 Pflicht- oder Feldethik 16 2.2 Gebote-Ethik 17 2.3 Am Gebot orientierte Feldethik 18 3. Der Dekalog als Grundnorm allgemeiner Ethik 19 3.1 Die besondere Stellung des Dekalogs in der Bibel und in der jüdisch-christlichen Überlieferung 19 3.2 Die Zählung der Gebote des Dekalogs 20 3.3 Die inhaltliche Gliederung des Dekalogs 20 3.4 Zur Hermeneutik des Dekalogs 21 3.4.1 Wortsinn und Synekdoche 21 3.4.2 Negative und positive Fassung der Gebote 22 3.4.3 Die Geltung des Dekalogs 22 4. Allgemeine und spezifisch christliche Ethik 23 5. Individual- und Sozialethik 24 II. Religionsethik (Ethik der I.Tafel des Dekalogs) 26 1. Der Problernbegriff Religion 26 2. Grundgestalten des menschlichen Verhaltens gegenüber Gott 27 2.1 Furcht Gottes 27 2.1.1 Heidnische Schicksals- und Dämonenfurcht 28 2.1.2 Furcht Gottes unter dem Gesetz 28 2.1.3 Furcht Gottes unter dem Evangelium 29 2.1.4 Demut als positive Gestalt der Furcht Gottes 31 2.2 Glaube an Gott 33 2.2.1 Glaube als ethische Forderung 33 2.2.2 Gott glauben und Glaube an Gott 34 2.3 Liebe zu Gott 35 2.3.1 Moderne Vorbehalte und ihre Vorgeschichte 35 2.3.2 Das biblische Zeugnis von der Liebe zu Gott 36 2.3.3 Die Bedeutung der Liebe zu Gott für die Ethik 39 2.3.4 Liebe zu Gott und Liebe zu den Menschen 40 3. Konkretionen der christlichen Religion im Sinne der 1. Tafel des Dekalogs 41 3.1 Der Ausschließlichkeitsanspruch Gottes (Erstes Gebot) 41 3.1.1 Das biblische Ausschließlichkeitsgebot 41 3.1.2 Die Begründung des Ausschließlichkeitsanspruchs Gottes 42 3.1.2.1 Das Schöpfersein Gottes als Grund des Ausschiießlichkeitsanpruchs 42 3.1.2.2 Die Sünde des Menschen als Anlass des Ausschließlichkeitsanspruchs 43 3.1.2.3 Die Erlösung als Ziel des Ausschließlichkeitsanspruchs 46 3.1.3 Die Verwirklichung des Ausschließlichkeitsanspruchs Gottes 47 3.1.3.1 Christlicher Glaube und fremde Religionen 47 3.1.3.1.1 Nichtchristliche Religionen in ihrem Verhältnis zueinander 47 3.1.3.1.2 Biblischer Glaube und fremde Religionen im Urteil der Bibel 48 3.1.3.1.3 Modelle des Umgangs mit fremden Religionen 50 a. Die totale Toleranz des Synkretismus 50 b. Die totale Intoleranz des Heiligen Kriegs 5> c. Bezeugung des Glaubens im missionarischen Dialog 52 3.1.3.2 Christlicher Glaube und Pseudoreligion (Aberglaube) 54 3.1.3.2.1 Beschreibung pseudoreligiöser Phänomene und Praktiken in der Bibel 54 3.1.3.2.2 Zum Umgang des Christen mit pseudoreligiösen Phänomenen und Praktiken 56 3.1.3.3 Christlicher Glaube und Quasireligion 58 3.2 Die Abwehr des Gottesbildes (Zweites Gebot) 59 3.2.1 Das biblische Verbot des Gottesbildes 59 3.2.2 Der historische Sinn des biblischen Bilderverbots 61 3.2.3 Die Bedeutung des Zweiten Gebots heute 62 3.2.3.1 Bilder im Volksaberglauben 62 3.2.3.2 Bilder im Gottesdienst 62 3.2.3.3 Gedachte Gottesbilder 64 3.3. Brauch und Missbrauch des Namens Gottes (Drittes Gebot) 65 3.3.1 Der historische Sinn des Dritten Gebots 65 3.3.2 Die Bedeutung des Dritten Gebots heute 66 3.4 Die Heiligung des Feiertags (Viertes Gebot) 69 3.4.1 Der historische Sinn des Gebots der Feiertagsheiligung 69 3.4.1.1 Der Sabbat und seine Bedeutung im Alten Testament 69 3.4.1.2 Der Sabbat und seine Bedeutung im Neuen Testament 72 a. Jesu Konflikt mit der jüdischen Sabbatfrömmigkeit seiner Zeit 72 b. Die Ersetzung des Sabbats durch den frühchristlichen Herrentag 73 3.4.1.3 Zur weiteren Geschichte der Sonntagsruhe in Kirche und Gesellschaft 74 3.4.2 Zur gegenwärtigen Bedeutung des Gebots der Heiligung des Feiertags 77 3.4.2.1 Die bleibende Bedeutung des Sabbatgebots 77 3.4.2.2 Die allgemein-menschliche Bedeutung der Sonntagsruhe 79 3.4.2.3 Die Bedeutung des Gebots der Sonntagsheiligung für Christen 80 3.4.2.4 Die Bedeutung des Gebots der Sonntagsheiligung in geistlichen Berufen 81 4. Die Geltung religionsethischer Normen im Rahmen allgemeiner Ethik 84 4.4.1Das Problem der Anwendbarkeit religionsethischer Normen im Rahmen allgemeiner Ethik 84 4.2 Möglichkeiten öffentlicher Förderung von Religion in einer weltanschaulich offenen Gesellschaft 86 4.3 Grenzen öffentlicher Förderung von Religion 90 III. Humanethik (Fünftes bis siebtes Gebot) 92 0. Vorbemerkung 92 1.Lebensethik (Sechstes Gebot) 93 1.1 Das Sechste Gebot als Grundordnung Gottes zum Schutz menschlichen Lebens 93 1.1.1 Die Unverfügbarkeit menschlichen Lebens 93 1.1.1.1 Der Wortlaut des biblischen Gebots „Du sollst nicht töten" 93 1.1.1.2 Die Begründung des biblischen Gebots 95 1.1.1.3 Die Unverfügbarkeit menschlichen Lebens in der gegenwärtigen Diskussion 95 1.1.2 Menschliches Leben nicht beschädigen 97 1.1.2.1 Physische Gewalt 97 1.1.2.2 Geistige Gewalt 98 1.1.2.3 Strukturelle Gewalt 99 1.1.2.4 Innere Voraussetzungen der Gewalt gegen andere 100 1.1.3 Menschliches Leben fördern 101 1.1.3.1 Nächstenliebe 102 a. Der Nachsatz: Selbstliebe als Mindestmaß der Nächstenliebe 102 b. Das Prädikat des Hauptsatz: Liebe 103 c. Das Objekt des Satzes: der Nächste 103 d. Der ferne Nächste 104 1.1.3.2 Praktische Gestalten der Förderung menschlichen Lebens 105 1.1.3.3 Feindesliebe 106 a. Die Eigenart der Feindesliebe 106 b. Kritik an der Forderung der Feindesliebe 109 c. Der Sinn des Gebots der Feindesliebe 111 1.2 Konkretionen des Schutzes menschlichen Lebens 113 1.2.1 Der Schutz ungeborenen Lebens (Abtreibung) 113 1.2.1.1 Zur Terminologie 113 1.2.1.2 Zur Geschichte des Problems 114 1.2.1.3 Wann beginnt menschliches Leben? 115 a. Persönlichkeit oder Bildungsfähigkeit 116 b. Die Geburt 117 c. Die Ausbildung des Gehirns 117 d. Die Individuation 118 e. Die Nidation und Plazentation 118 f. Die Befruchtung 119 1.2.1.4 Rechtliche Regelungen zur Freigabe der Abtreibung 119 a. Die Indikationslösung 120 b. Die Fristenlösung 123 1.2.1.5 Hintergründe 123 1.2.1.6 Konsequenzen 123 a. Generelle Konsequenzen 123 b. Praktische Konsequenzen 124 1.2.2 Biotechnik 125 1.2.2.1 Methoden der Biotechnik 126 1.2.2.2 Ethische Bewertung der biotechnischen Methoden 126 1.2.3 Gentechnik 128 1.2.3.1 Zur Terminologie 128 1.2.3 2 Verfahren der Gentechnik 128 1.2.3.3 Ziele der Gentechnik 129 1.2.3.4 Ethische Beurteilung gentechnischer Verfahren 130 1.2.4 Embryonenforschung 132 1.2.4.1 Möglichkeiten der Embryonenforschung 132 a. Präimplantationsdiagnostik 132 b. Stammzellenforschung 132 c. Klonieren 133 1.2.4.2 Ethische Beurteilung der Embryonenforschung 133 1.2.5 Euthanasie 135 1.2.5.1 Zur Geschichte der Euthanasie 135 1.2.5.2 Zur Terminologie 137 1.2.5.3 Ethische Beurteilung der verschiedenen Möglichkeiten von Sterbehilfe 138 1.2.6 Selbsttötung 142 1.2.6.1 Zur Geschichte des Themas der Selbsttötung 142 1.2.6.2 Zur ethischen Beurteilung der Selbsttötung 143 1.2.7 Organtransplantation 144 1.2.7.1 Die medizinischen Möglichkeiten der Organtransplantation 144 1.2.7.2 Chancen und Probleme der Organtransplantation 145 1.2.7.3 Entscheidungskriterien 146 1.2.8 Staatliche Anwendung von Gewalt 146 1.2.8.1 Militärische Gewaltanwendung 146 1.2.8.1.1 Krieg und Kriegsdienst in der Bibel und in christlicher Theologie 147 1.2.8.1.2 Nichtchristliche Theorien zur Rechtfertigung militärischer Gewaltanwendung 151 a. Naturalistische Rechtfertigung des Krieges 151 b. Idealistische Rechtfertigung des Krieges 152 1.2.8.1.3 Zur christlichen Lehre von militärischer Gewaltanwendung 152 1.2.8.1.4 Ein säkulares Ende der Kriege? 154 a. Das Problem der modernen Waffentechnik 154 b. Friedenspolitische Chancen der Globalisierung 155 1.2.8.1.5 Die Verantwortung des Einzelnen für Krieg und Frieden 156 a. Die staatsbürgerliche Pflicht zum Wehrdienst 156 b. Die sittliche Pflicht zur Förderung des Friedens 157 c. Die Verweigerung des Wehrdienstes 157 1.2.8.2 Die Todesstrafe 159 1.2.8.2.1 Das hermeneutische Problem der Todesstrafe 160 1.2.8.2.2 Zum Sinn von Strafe 161 1.2.8.2.3 Argumente für die Todesstrafe 162 1.2.8.2.4 Argumente gegen die Todesstrafe 163 2. Sozialethik 164 2.1 Die Familie als natürliche Grundform sozialen Lebens 164 2.1.1 Die Familie im Zeugnis der Bibel 164 2.1.2 Wesen und Funktion der Familie 167 2.1.3 Ethik der Familie 171 2.1.3.1 Das biblische Gebot der Ehrung der Eltern 171 2.1.3.2 Das Problem der Ehrung der Eltern in der neueren Diskussion 172 2.1.3.3 Die Begründung der elterlichen Autorität 173 2.1.3.3.1 Die Urheberschaft als Wirkgrund der elterlichen Autorität 173 2.1.3.3.2 Die Erziehung des Kindes als Zielgrund der elterlichen Autorität 175 2.1.3.4 Die Verwirklichung der elterlichen Autorität 179 2.1.3.5 Sachliche Grenzen der elterlichen Autorität 184 2.1.3.6 Zeitliche Grenzen der elterlichen Autorität 186 2.1.3.6.1 Die Differenzierung der elterlichen Autorität nach Lebensphasen 186 2.1.3.6.2 Die Verantwortung des Kindes für die altgewordenen Eltern 187 2.1.3.6.2.1 Die Problematik der Altenpflege 187 2.1.3.6.2.2 Praktische Konsequenzen 189 2.2 Ethik außerfamilialer sozialer Strukturen 191 2.2.1 Die Achtung des Alters 191 2.2.2 Institutionalisierte außerfamiliale Strukturen 192 2.2.2.1 Die Übertragung des Gebots der Ehrung der Eltern auf andere soziale Strukturen 192 2.2.2.2 Personautorität und Amtsautorität 194 2.2.2.3 Autoritätsstrukturen im Bereich der christlichen Gemeinde 195 2.3 Politische Ethik 196 2.3.1 Das Wesen staatlicher Ordnung 196 2.3.1.1 Individualistische Abwertung des Staates 196 2.3.1.2 Kollektivistische Absolutsetzung des Staates 197 2.3.1.3 Der Staat als geschichtliche Gestalt menschlicher Sozialität 198 2.3.2 Ethische Prinzipien staatlicher Ordnung 202 2.3.2.1 Das Solidaritätsprinzip 202 2.3.2.2 Das Subsidiaritätsprinzip 202 2.3.2.3 Solidarität und Subsidiarität in ihrer Bezogenheit aufeinander 203 2.3.3 Grundformen staatlicher Ordnung 203 2.3.2.1 Die Stellung der Bibel zur Frage der Staatsform 204 2.3.3.2 Die drei klassischen Staatsformen 205 2.3.3.3 Die moderne Demokratie 206 2.3.4 Die Verantwortung des Einzelnen gegenüber der staatlichen Ordnung 208 2.3.4.1 Die politische Verantwortung des Einzelnen nach biblischem Zeugnis 208 2.3.4.2 Möglichkeiten der Wahrnehmung individueller politischer Verantwortung im modernen, demokratischen Staat 213 2.3.5 Das Problem des Widerstands gegen die Staatsgewalt 216 Stichwortregister 219 Namenregister 224 Bibelstellenregister 227 |
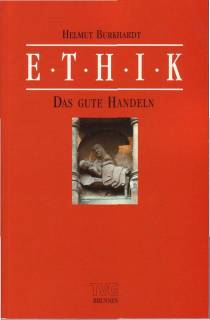
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen